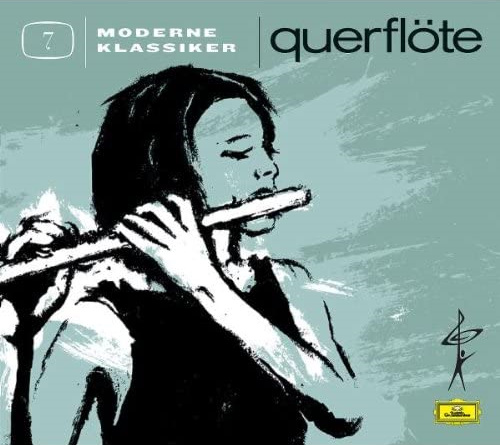 |
|
1 CD -
472 642-2 - (p) & (c) 2003
|
 |
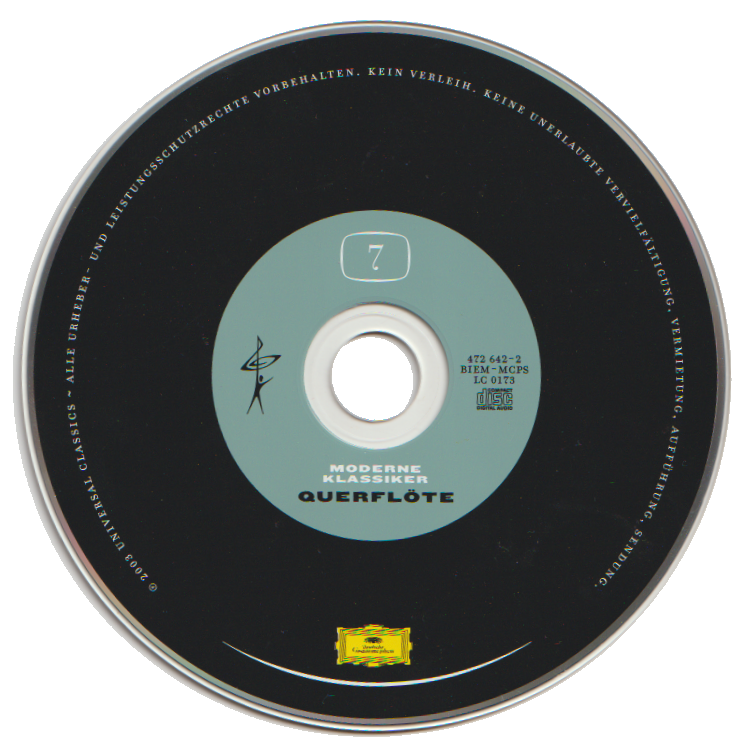 |
|
7 - MODERNE
KLASSIKER | querflöte
|
|
|
|
|
|
|
|
| Francis POULENC
(1899-1963) |
Sonate
für Flöte und Klavier
|
|
12' 09" |
|
|
-
Allegro malinconico
|
4' 29" |
|
1 |
|
-
Cantilena: Assez lent
|
4' 07" |
|
2 |
|
-
Presto giocoso
|
3' 33" |
|
3 |
|
Wolfgang
Schulz, Flöte | Ensemble
Wien-Berlin | James Levine,
Dirigent
|
|
|
|
| Claude DEBUSSY
(1862-1918) |
Sonate
pour flûte, alto et harpe |
|
15' 23" |
|
|
-
Pastorale |
5' 57" |
|
4 |
|
-
Interlude |
5' 04" |
|
5 |
|
-
Finale |
4' 22" |
|
6 |
|
Osian
Ellis, Harfe | Melos
Ensemble |
|
|
|
| Albert ROUSSEL (1869-1937) |
Sérénade
für Flöte, Harfe, Violine, Viola
und Violoncello
|
|
15' 53" |
|
|
-
Allegro
|
3' 56" |
|
7 |
|
-
Andante
|
7' 54" |
|
8 |
|
-
Presto
|
4' 03" |
|
9 |
|
Osian
Ellis, Harfe | Melos
Ensemble
|
|
|
|
| Maurice RAVEL (1875-1937) |
Introduktion
und Allegro für Harfe,
Streichquartett, Flöte und
Klarinette |
|
11' 26" |
10 |
|
Nicanor
Zabaleta, Harfe |
Monique
Frasca-Colombier, 1.
Violine | Marguerite
Vidal, 2. Violine | Anka
Moraver, Viola | Hamisa
Dor, Violoncello |
Christian Larde, Flöte |
Guy Deplus, Klarinette
|
|
|
|
| Toru TAKEMITSU (1930-1996) |
I
Hear The Water Dreaming
|
|
10' 50" |
11 |
|
Patrick
Gallois, Flöte | Göran
Söllscher, Gitarre | BBC
Symphony Orchestra |
Andrew Davis, Dirigent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
-
Salzburg, Aula der Universität |
aprile 1989 | Poulenc (1-3)
- London, Walthamstow Assembly
Hall | ottobre 1961 | Debussy
(4-6) & Roussel (7-9)
- Paris, Notre Dame du Liban |
ottobre 1966 | Ravel (10)
- London, Abbey Roas Studios,
Studio One | settembre 1996 |
Takemitsu (11)
|
|
|
Original Editions |
|
-
Deutsche Grammophon | 427 639-2 |
1 CD | (p) 1989 | DDD | Poulenc
(1-3)
- L'Oiseau-Lyre | SOL 60048 | 1 LP
| (p) 1962 | ANA | Debussy (4-6)
& Roussel (7-9)
- Deutsche Grammophon | 139 304 |
1 LP | (p) 1967 | ANA | Ravel (10)
- Deutsche Grammophon | 453 459-2
| 1 CD | (p) 2000 | DDD |
Takemitsu (11)
|
|
|
Edizione "Moderne
Klassiker"
|
|
Universal
Classics | 472 642-2 | LC 0173 | 1
CD | (p) & (c) 2003 | ADD/DDD
| 0028947264224
|
|
|
Project |
|
Christian
Kellermann | Martin Hossbach |
Justus Beier | Per O. Hauber
|
|
|
Direction |
|
Justus
Beier
|
|
|
Illustrations |
|
Olaf
Becker | Franz Scholz
|
|
|
Design |
|
Olaf
Becker | Becker-Design.net |
|
|
|
|
|
ORIGINAL
EDITIONS
|
MODERNE KLASSIKER:
QUERFLÖTE
Die Flöte, einst sowohl als
Göttergeschenk wie als Instrument
der Götter verehrt und mit
vielerlei symbolischen Bedeutungen
versehen, erlebte den Höhepunkt
ihrer Popularität im 18.
Jahrhundert, wurde zum bevorzugten
Modeinstrument der Liebhaber,
Dilettanten und Virtuosen und
setzte sich auch als
Orchesterinstrurnent durch.
Es waren die französischen
Impressionisten, die sich im 20.
Jahrhundert vom delikaten Klang
und den spieltechnischen
Veränderungen der Querflöte
inspirieren ließen und sie neu
entdeckten. Beispielsweise Claude
Debussy: in seinem 1892-94,
entstandenen Vorspiel zum
Nachmittag eines Fauns (Prélude
à l'après-midi d'un faune)
setzte er Flötentöne von geradezu
unverschämter Lüsternheit und
traumverlorener Laszivität ein.
Aufreizenderes als diese
Flötenklänge hatte man kaum
gehöit. Kein Wunder, dass die
Uraufführung auf geteilte
Reaktionen traf: Begeisterung und
Unverständnis. Debussy,
der auch ein kluger
Musikwissensehaftler war und sich
als solcher Monsieur Croche
nannte, werte sich 1901 gegen
jeglichen akademischen
Schematismus: „Mir sind einige
Töne aus der Flöte eines
ägyptischen Hirtenknaben lieber.
Er gehört zur Landschaft und
hört Harrnonien, die ihre
Lehrbucher ignorieren". In
der letzten seiner drei Sonaten,
in denen er mit unterschiedlichen
Besetzungsmöglichkeiten
experimentierte, erzeugte Debussy
im Zusammenspiel von Flöte, Harfe
und Viola geheimnisvolle
Stimmungen. Die 1916 uraufgeführte
Sonate für Flöte, Viola und
Harfe F-Dur erhält durch die
Beteiligung der Harfe anstelle des
konventionellerweise üblichen
Klaviers einen durchaus
ungewöhnlichen und reizvoll
aparten Klang.
Ein ebenso raffiniertes Spiel der
Klangfarben und schwebenden
Rhythmen zeichnet Maurice
Ravels Introduktion und
Allegro von 1905 aus. 13 Jahre
jünger als Debussy ließ
sich Ravel von dessen
Impressionismus inspirieren, aber
auch von der Klanglichkeit
russischer und spanischer Folklore
und von den Einwürfen der modernen
Unterhaltungsmusik bis hin zum
Jazz. Wahrscheinlich haben diese
bemerkenswert vielseitigen
Einflüsse, die Ravel
kunstvoll wie in einem magischen
Teppich miteinander verknüpfte,
zur großen Popularität Ravels
(man denke nur an den Boléro)
beigetragen, die ihn zu einem der
meistgespielten Komponisten des
20. Jahrhunderts werden ließ.
Äußerste Durchsichtigkeit,
Vereinfachung und Konzentration,
vielfach ein Merkmal französischer
Musik, ist auch das Kennzeichen
von Albert Roussels Musik.
Im Gegensatz zu dem frühgenialen Ravel
fuhr Roussel erst mehrere
Jahre als Fähnrich zur See, bevor
er 1893 als 25 jahriger die Marine
gegen die Musik eintauschte. In
der Musik des spätreifen Roussel
finden sich impressionistische
Anklänge ebenso wie
neoklassizistische Nüchternheit.
Die Flöte war eines der
Lieblingsinstrumente Roussels,
was man der höchst originellen Sérénade
für Flöte, Harfe, Violine, Viola
und Cello von 1925 denn auch
deutlich anmerkt.
Witz und Trivialität, höchster
Anspruch und geistreiche
Unterhaltung bieten alle Stücke
von Francis Poulenc, einem
der Mitglieder der Groupe des Six.
Als Musiker und Komponist standen
Poulenc von Anfang an alle
Türen offen: er wurde von seinen
Eltern intensiv gefördert, war
Meisterschüler des spanischen
Klaviervirtuosen Viñes,
war mit vielen Musikern befreundet
und erlebte seinen Durchbruch mit
der Musik, die er für den
russischen Impressario Diaghilew
und dessen Ballets Russes
komponierte. Poulenc war
ein brillant vielseitiger
Komponist, der Ballette,
Orchesterstücke und Opern
(darunter Gespräche der
Karmeliterinnen) schrieb,
doch vor allem durch seine Lieder
und seine Kammermusik überlebt
hat. Wie wenigen Komponisten
gelang ihm das Kunststück, pures
Amüsement mit Witz und Tiefsinn zu
verbinden. Ein Beispiel für die
eminente Qualität seiner
Kammermusik ist die aus der Mitte
der 50er Jahre stammende Sonate
für Flöte und Klavier.
MODERNITÄT KENNT KEIN ALTER
Keine Musik ist uns so nah wie
Musik unserer Zeit. Moderne
Klassiker sind Klassiker des
20.Jahrhunderts. Die Musik ist
erst wenige Jahrzehnte alt und
Schock und Erstaunen, die sie
auslöste, gerade erst überwunden.
Für uns zählen sie bereits zu den
Klassikern: exemplarisch für
unsere und ihre Zeit und
revolutionierend für die Kunst.
Die Auswahl der Beispiele zeigt,
wie sich manche Instrumente erst
im 20. Jahrhundert aus dem
Orchesterplenum zu neuer
Wirksamkeit emanzipierten und in
Schlüsselwerken der Moderne
hervortraten. Modernität kennt
kein Alter.
Manche der hier vorgestellten
Komponisten wirken wie
Zeitgenossen von heute, andere
verlieren in der Gegenüberstellung
an Originalität. Alles findet sich
in dieser Musik, die Gebrochenheit
und Vielfältigkeit des 20.
Jahrhunderts: Auflehnung und
Provokation, innere Emigration,
Anpassung und schöner Schein.
Packend: Prokofieffs
2.Violinsonate trifft auf das fast
gleichzeitig entstandene
Violinkonzert seines Widersachers
Kabalewski. Noch Jahrzehnte
nach seiner öffentlichen
Brandmarkung spürt man in Schostakowitschs
Cellokonzert seine gebrochene
Seele. Die späten Konzerte von Richard
Strauss sind ein Abgesang
auf eine untergegangene Welt, eine
Welt, für die alle Komponisten
nach neuen Gesangstönen suchten,
sei es als ekstatischer
Liebestaumel, als Schrei um
Erbarmen vor dem Verdammtsein oder
als pure spätromantische
Schönheitstrunkenheit. Aber die
Modernen Klassiker besitzen auch
kauzigen Humor, Ironie und ein
charmantes Unterhaltungsbedürfnis.
Rolf
Fath
|
|
|
|