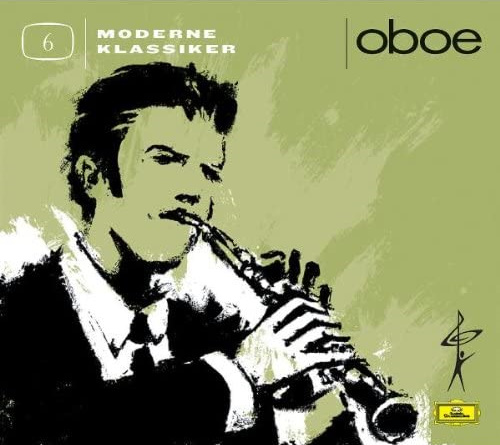 |
|
1 CD -
472 644-2 - (p) & (c) 2003
|
 |
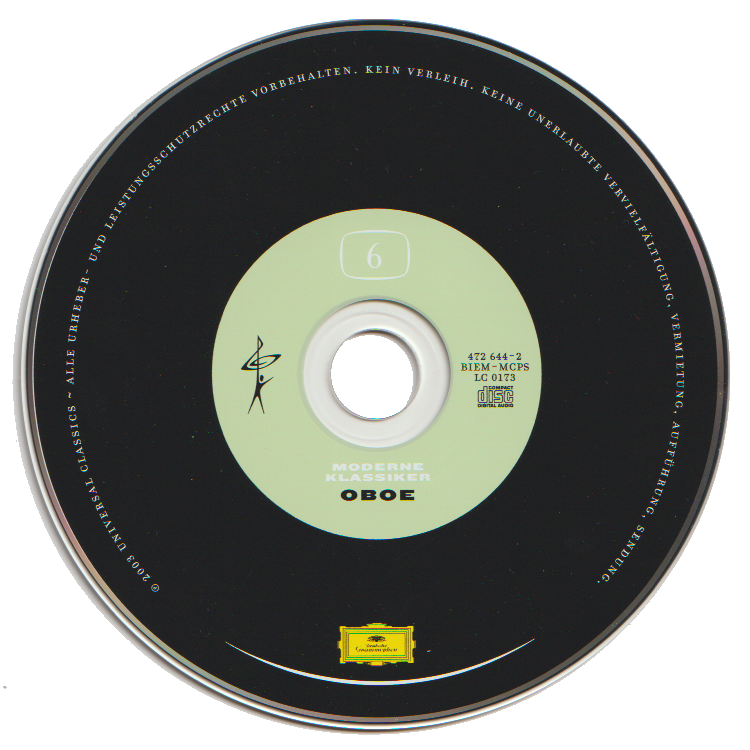 |
|
6 - MODERNE
KLASSIKER | oboe
|
|
|
|
|
|
|
|
| Richard STRAUSS
(1864-1949) |
Konzert
für Oboe und kleines Orchester
D-dur
|
|
26' 19" |
|
|
-
Allegro moderato
|
8' 37" |
|
1 |
|
-
Andante
|
9' 47" |
|
2 |
|
-
Vivace
|
4' 45" |
|
3 |
|
-
Allegro |
3' 10" |
|
4 |
|
Hansjörg
Schellenberger, Oboe | Berliner
Philharmoniker | James Levine,
Dirigent
|
|
|
|
| Francis POULENC
(1899-1963) |
Trio
für Klavier, Oboe und Fagott |
|
13' 13" |
|
|
-
Presto: Lent · Presto · Le double
plus lent · Presto |
5' 26" |
|
5 |
|
-
Andante: Andante con moto |
4' 39" |
|
6 |
|
-
Rondo: Très vif |
3' 08" |
|
7 |
|
James
Levine, Klavier |
Hansjörg Schellenberger,
Oboe | Milan Turkovic,
Fagott |
|
|
|
| Ralph VAUGHAN WILLIAMS
(1872-1958) |
Oboe
Concerto
|
|
18' 21" |
|
|
-
Rondo pastorale
|
7' 33" |
|
8 |
|
-
Minuet and musette
|
2' 47" |
|
9 |
|
-
Finale
|
8' 01" |
|
10 |
|
Celia
Nicklin, Oboe | Academy
of St
Martin-in-the-Fields |
Sir Neville Marriner,
Dirigent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
-
Berlin, Jesus-Christus-Kirche |
maggio 1989 | studio | Strauss
(1-4)
- Salzburg, Aula der Universität |
aprile 1989 | Poulenc (5-7)
- London, St. John's Smith Square
| 15 giugno 1977 | Vaughan
Williams (8-10)
|
|
|
Original Editions |
|
-
Deutsche Grammophon | 429 750-2 |
1 CD | (p) 1990 | DDD | Strauss
(1-4)
- Deutsche Grammophon | 427 639-2
| 1 CD | (p) 1989 | DDD | Poulenc
(5-7)
- Argo | ZRG 881 | 1 LP | (p) 1977
| ANA | Vaughan Williams (8-10)
|
|
|
Edizione "Moderne
Klassiker"
|
|
Universal
Classics | 472 644-2 | LC 0173 | 1
CD | (p) & (c) 2003 | ADD/DDD
| 0028947264422
|
|
|
Project |
|
Christian
Kellermann | Martin Hossbach |
Justus Beier | Per O. Hauber
|
|
|
Direction |
|
Justus
Beier
|
|
|
Illustrations |
|
Olaf
Becker | Franz Scholz
|
|
|
Design |
|
Olaf
Becker | Becker-Design.net |
|
|
|
|
|
ORIGINAL
EDITIONS
|
MODERNE KLASSIKER: OBOE
Obwohl seit 1650 als
Soloinstrument bekannt, wurde die
Oboe in der Klassik und Romantik
nur spärlich mit Sololiteratur
bedacht. Erst im 20. Jahrhundert
trat das Holzblasinstrument aus
dem Orchesterplenum heraus und zu
einem neuen Siegeszug an. Wie für
so manches andere Instrument, dem
er zu Individualität verhalf,
schuf der erfindungsreiche Francis
Poulenc mit seinem Trio für
Klavier. Oboe und Fagott bereits
1926 für die Oboe ein
selbstbewusstes, pfiffiges Stück.
Poulenc war damals 27 Jahre
alt und einer seiner größten
Erfolge. das Ballett Les
Biches, das er für den
russischen Impressario Diaghilew
und dessen Ballets Russes
geschrieben hatte, lag immerhin
schon zwei Jahre zurück. Poulenc
war ein Kind des Erfolgs. Daher
ist auch die Leichtigkeit zu
erklären, mit der er gleichermaßen
anmutige und kunstvolle Stücke
zauberte und nie den Blick auf
seine Zuhörer verlor. Einst ein
Aushängeschild der
Avantgarde-Gruppe Les Six
kultivierte Poulenc einen
eigenständigen, von keiner Mode
angekränkelten Individualstil
zwischen tiefer Religiosität und
typischen französischen Charme.
Während des Zweiten Weltkriegs
bekannte er sich aktiv zum Kampf
gegen die Okkupanten und schrieb
auf Texte von Aragon und Eluard
Werke für die Résistance.
Eines der zentralen Werke für die
Oboe ist das Konzert für Oboe
und kleines Orchester von Richard
Strauss, das er 1945 als
erstes Werk in seinem Schweizer
Refugium komponierte. ein
heiter-gelöstes Alterswerk mit
allen Kennzeichen handwerklicher
Meisterschaft und dem intensiv
aufflackernden Elan des immensen
Klangmagiers. Der Autor
gewichtiger Tondichtungen und der
Komponist archaisch-gewaltiger
Musikdramen, beschränkte sich
jetzt ganz bewusst auf
„unliterarische", schön und leicht
empfundene Musik. Der reduzierte
und durchsichtigere Klangapparat
wird nun allerdings von Strauss
mit besonderer Feinheit verwaltet.
Es war der Solo-Oboist des Philadelphia
Orchestra, John de Lancy,
der als in Garmisch stationierter
GI den berühmten Komponisten bat.
„a piece for oboe" zu
schreiben. Alle Oboisten werden es
dem GI und Strauss ewig
danken. dass es auf diesem
vernachlässigten Gebiet zu diesem
brillant-herzerfrischenden Konzert
kam. Wie verstand es Strauss doch.
die technischen und klanglichen
Möglichkeiten der Oboe in
virtuosen Skalen und witzigen
Sprüngen zu nützen, das Instrument
„singen" zu lassen und die
Themen der Solo-Oboe als einen
Gruß von Mozart zu servieren. Das
Rondo-Finale entwickelt eine
purzelnde Buffolaune. In diesem
Nachkriegsstück gewinnt der
Bojährige Strauss nochmals
seinen jugendlichen Elan zurück
und überwand die schwere Stimmung
seiner „Metamorphosen".
Ein Jahr zuvor, 1944, komponierte
Ralph Vaughan Williams sein
Oboenkonzert. Trotz aller
lyrischen Qualität und
spielerischen Delikatesse ein
nostalgisches Stück. Auch ein
durch und durch englisches Stück.
Vaughan Williams wurde in
Gloucestershire geboren, studierte
in Cambridge und erhielt durch Maurice
Ravel und Max Bruch
musikalische Anregungen. Ab 1904.
widmete er sich als Mitglied der
Folk Song Society besonders
intensiv der Sammlung und
Veröffentlichung englischer Lieder
und unterrichtete später am Royal
College of Music in London. Bis zu
seinem Tod 1958 galt er als Haupt
der englischen nationalen Schule.
Vaughan Williams, der auch
als Musikschriftsteller hewortrat,
merkte im Kriegsjahr 1942 zum
Thema „Nationalismus und
Unternationalismus" an. „Ist
es möglich Nationalist und
gleichzeitig Internationalist zu
sein? Ich glaube, dass
politischer Internationalismus
und persönlicher Individualismus
sich notwendigerweise ergänzen:
der eine kann ohne den anderen
nicht existieren. Ich glaube,
dass alles, was in unserem
geistigen und kulturellen Leben
wertvoll ist, in unserem
Heimatboden wurzelt, aber dieses
Leben kann sich nur in einer
Atmosphäre der Freundschaft mit
anderen Nationen entwickeln.
Unsere nationale Kunst darf kein
ruhendes Gewässer sein, sondern
sie muss ihren Teil beitragen zu
dem großen Strom, der durch die
Jahrhunderte geflossen ist. Wir
dürfen nicht zu einem
ununterscheidbaren Teil des
allgemeinen Flusses werden".
MODERNITÄT KENNT KEIN ALTER
Keine Musik ist uns so nah wie
Musik unserer Zeit. Moderne
Klassiker sind Klassiker des
20.Jahrhunderts. Die Musik ist
erst wenige Jahrzehnte alt und
Schock und Erstaunen, die sie
auslöste, gerade erst überwunden.
Für uns zählen sie bereits zu den
Klassikern: exemplarisch für
unsere und ihre Zeit und
revolutionierend für die Kunst.
Die Auswahl der Beispiele zeigt,
wie sich manche Instrumente erst
im 20. Jahrhundert aus dem
Orchesterplenum zu neuer
Wirksamkeit emanzipierten und in
Schlüsselwerken der Moderne
hervortraten. Modernität kennt
kein Alter.
Manche der hier vorgestellten
Komponisten wirken wie
Zeitgenossen von heute, andere
verlieren in der Gegenüberstellung
an Originalität. Alles findet sich
in dieser Musik, die Gebrochenheit
und Vielfältigkeit des 20.
Jahrhunderts: Auflehnung und
Provokation, innere Emigration,
Anpassung und schöner Schein.
Packend: Prokofieffs
2.Violinsonate trifft auf das fast
gleichzeitig entstandene
Violinkonzert seines Widersachers
Kabalewski. Noch Jahrzehnte
nach seiner öffentlichen
Brandmarkung spürt man in Schostakowitschs
Cellokonzert seine gebrochene
Seele. Die späten Konzerte von Richard
Strauss sind ein Abgesang
auf eine untergegangene Welt, eine
Welt, für die alle Komponisten
nach neuen Gesangstönen suchten,
sei es als ekstatischer
Liebestaumel, als Schrei um
Erbarmen vor dem Verdammtsein oder
als pure spätromantische
Schönheitstrunkenheit. Aber die
Modernen Klassiker besitzen auch
kauzigen Humor, Ironie und ein
charmantes Unterhaltungsbedürfnis.
Rolf
Fath
|
|
|
|