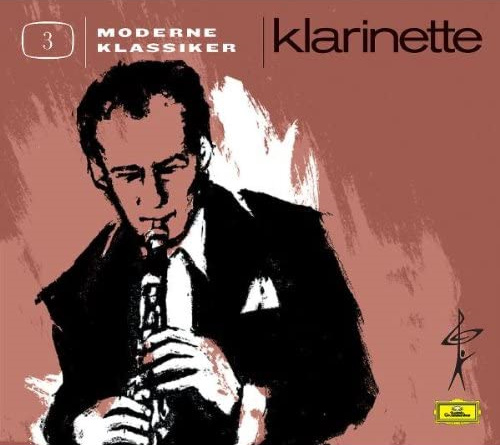 |
|
1 CD -
472 645-2 - (p) & (c) 2003
|
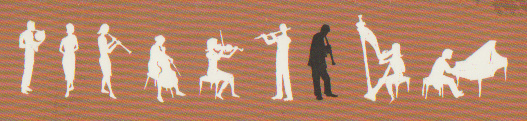 |
 |
|
3 - MODERNE
KLASSIKER | klarinette
|
|
|
|
|
|
|
|
| Francis POULENC
(1899-1963) |
Sonate
für Klarinette und Klavier
|
|
14' 36" |
|
|
-
Allegro tristamente: Allegretto ·
Très calme · Tempo allegretto
|
5' 56" |
|
1 |
|
-
Romanza: Très calme
|
5' 27" |
|
2 |
|
-
Allegro con fuoco: Très animé
|
3' 05" |
|
3 |
|
Karl
Leister, Klarinette | James
Levine, Klavier | Ensemble
Wien-Berlin
|
|
|
|
| Gerald FINZI
(1901-1956) |
Konzert
für Klarinette und
Streichorchester |
|
27' 48" |
|
|
-
Allegro vigoroso
|
8' 16" |
|
4 |
|
-
Adagio ma senza rigore |
11' 21" |
|
5 |
|
-
Rondo · Allegro giocoso |
8' 11" |
|
6 |
|
Andrew
Marriner, Klarinette |
Academy of St
Martin-in-the-Fields |
Sir Neville Marriner, Dirigent |
|
|
|
| Witold LUTOSLAWSKI
(1913-1944) |
Tanzpräludien
für Klarinette, Harfe, Klavier,
Schlagzeug und Streichorchester |
|
9'
51"
|
|
|
-
Allegro molto
|
1' 02" |
|
7 |
|
-
Andantino |
2' 45" |
|
8 |
|
-
Allegro giocoso
|
1' 24" |
|
9 |
|
-
Andante |
3' 10" |
|
10 |
|
-
Allegro molto · Presto
|
1' 30" |
|
11 |
|
Eduard
Brunner, Klarinette |
Symphonie-Orchester des
Bayerischen Rundfunks |
Witold Lutoslawski,
Digirent |
|
|
|
| Leonard BERNSTEIN
(1918-1990) |
Prelude,
Fugue and Riffs for solo clarinet
and jazz ensemble
|
|
11' 50" |
|
|
-
Prelude for the Brass: Fast and
exact |
1' 54" |
|
12 |
|
-
Fugue for the Saxes: Exactly the
same beat
|
1' 51" |
|
13 |
|
-
Riffs for Everyone
|
4' 30" |
|
14 |
|
Peter
Schmidl, Klarinette |
Wiener Philharmoniker |
Leonard Bernstein,
Dirigent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
-
Salzburg, Aula der Universität |
aprile 1989 | Poulenc (1-3)
- Watford, The Colesseum | giugno
1996 | Finzi (4-6)
- München, Herkulessaal | gennaio
1986 | Lutoslawski (7-11)
- Vienna, Musikverein, Großes Saal
| ottobre 1988 | Bernstein (12-14)
|
|
|
Original Editions |
|
-
Deutsche Grammophon | 427 639-2 |
1 CD | (p) 1989 | DDD | Poulenc
(1-3)
- Philips | 454 438-2 | 1 CD | (p)
1997 | DDD | Finzi (4-6)
- Philips | 416 817-2 | 1 CD | (p)
1986 | DDD | Lutoslakwsi (7-11)
- Deutsche Grammophon | 447 952-2
| 1 CD | (p) 1992 | DDD |
Bernstein (12-14)
|
|
|
Edizione "Moderne
Klassiker"
|
|
Universal
Classics | 472 643-2 | LC 0173 | 1
CD | (p) & (c) 2003 | ADD/DDD
| 0028947264323
|
|
|
Project |
|
Christian
Kellermann | Martin Hossbach |
Justus Beier | Per O. Hauber
|
|
|
Direction |
|
Justus
Beier
|
|
|
Illustrations |
|
Olaf
Becker | Franz Scholz
|
|
|
Design |
|
Olaf
Becker | Becker-Design.net |
|
|
|
|
|
ORIGINAL
EDITIONS
|
MODERNE KLASSIKER:
KLARINETTE
Aus der Mitte des 20.
Jahrhunderts, genauer aus den 40er
bis 60er Jahren, stammen die
ausgesuchten Stücke für
Klarinette, welche viele
Möglichkeiten des Instruments, das
dem Klang der menschlichen Stimme
so nahe kommt, ausschöpfen.
Zugleich ist diese Sammlung eine
europäische Momentaufnahme jener
Jahre aus England, Polen und
Frankreich. Die Klarinette, die
seit Mitte des 18. Jahrhunderts im
Orchester verwendet wird, gibt
einerseits romantische
Naturstimmungen wieder und wurde
ab 1930 zum Swing- und
Jazzinstrument par excellence bis
sie vom Saxophon abgelöst Wurde.
Die wunderbare Balance zwischen U-
und E- Musik hat Leonard Bernstein
wie kaum ein anderer in der
Schwebe gehalten. Wie auch kaum
ein anderer hat er dadurch etwas
für die Popularisierung der
klassischen Musik getan (etwa
durch seine Femsehvorträge).
Wie ein Wirbelwind fegte er über
die europäischen Opern- und
Konzertbühnen und zeigte, dass
jemand, der eines der
erfolgreichsten und besten
Musicals des 20. Jahrhunderts
verfasst hat auch ein begnadeter
Mahler- oder Strauss-Interpret
sein kann. Bei Bernstein
wurde der Broadway zum
Konzertsaal. Wenn Bernstein
guter Laune war, und das war er
fast immer, waren seine Auftritte
Sternstunden der Musik. Dann floss
er über vor Liebe und Hingabe an
die Klänge und an die Menschen.
Sein Ende der 40er Jahre
entstandenes Stück für Klarinette
und Jazz-Ensemble ist ein
perfektes Beispiel für seine
animierende und mitreißende
Musizierfreude.
Mit frechen und modernen
Applikationen hat auch Francis
Poulenc gerne seine Kompositionen
versehen, darunter seine Sonate
für Klarinette und Klavier (1962).
Die Beschreibung als „Mönch
und Lausbub" trifft
wunderbar auf Poulenc zu.
schließlich komponierte er eine
unter Nonnen spielende Oper (Gespräche
der Karmeliterinnen) und
andererseits trieb er als
Komponist durchaus seinen
Schabernack mit dem Publikum, das
er immer auf das reizvollste
unterhielt. Nichts schien Poulenc
mehr am Herzen zu liegen, als das
geistvolle Amüsement seiner
Zuhörer. Das fiel ihm leicht. Denn
leicht fiel ihm von Anfang an
alles in den Schoß: Gefördert von
seinen Eltern, ausgebildet von
einem der besten Pianisten, wurde
Poulenc bald mit den Größen
der Musikwelt bekannt und erlebte
1924., er war gerade erst 25 Jahre
alt, mit einer Ballettkomposition
für Diaghilews Ballets Russes
seinen Durchbruch. Poulenc,
zu dessen Göttern Mozart und
Schubert gehörten, war trotz
seiner scheinbaren Leichtigkeit
ein tiefsinniger und anmutiger
Komponist. Kaum bekannt ist
hierzulande Gerald Finzi,
der musikalische Erbe von Hols,
Elgar und Vaughan
Williams und wie diese ein
getreuer Porträtist der englischen
Landschaft. Ohne diese englische
Landschaft konnte Finzi
nicht sein, weshalb er sich immer
wieder in die dörflichländliche
Einsamkeit zurückzog. um dort
seinen Studien älterer englischer
Musik und Literatur nachzugehen.
Für den überzeugten Pazifisten Finzi,
dessen jüdische Vorfahren Mitte
des 18. Jahrhunderts nach England
eingewandert waren, boten die
entlegenen Regionen und das
einsiedlerische Landleben zugleich
Obdach vor den politischen Wirren
der Zeit. Weit ab von den
musikalischen Zentren machte er
sich Gedanken über die Aufgabe des
Künstlers in den Zeiten des
Krieges. Finzis
Klarinettenkonzert, entstanden in
den Jahren 1948/49, bietet eine
instruktive Alternative zu Bernstein.
Wenige Jahre später, in den frühen
50er Iahren, als der Pole Witold
Lutoslawski noch unter dem
kommunistischen Regime zu leiden
hatte, entstanden seine
Tanzpräludien für Klarinette,
Harfe, Klavier, Schlagzeug und
Streichorchester. Wie Schostakowitsch
in Russland hatte auch Lutoslaıwski
unter dem Vorwurf des Formalismus
zu leiden. Er weigerte sich
standhaft, sich dem Diktat des
Regimes zu unterwerfen und
Auftragskompositionen
anzufertigen, stattdessen schlug
er sich mit Musik für Hörspiele
und Schauspiele durch. Heute gilt
er weltweit als der bedeutendste
polnische Komponist seit Chopin.
MODERNITÄT KENNT KEIN ALTER
Keine Musik ist uns so nah wie
Musik unserer Zeit. Moderne
Klassiker sind Klassiker des
20.Jahrhunderts. Die Musik ist
erst wenige Jahrzehnte alt und
Schock und Erstaunen, die sie
auslöste, gerade erst überwunden.
Für uns zählen sie bereits zu den
Klassikern: exemplarisch für
unsere und ihre Zeit und
revolutionierend für die Kunst.
Die Auswahl der Beispiele zeigt,
wie sich manche Instrumente erst
im 20. Jahrhundert aus dem
Orchesterplenum zu neuer
Wirksamkeit emanzipierten und in
Schlüsselwerken der Moderne
hervortraten. Modernität kennt
kein Alter.
Manche der hier vorgestellten
Komponisten wirken wie
Zeitgenossen von heute, andere
verlieren in der Gegenüberstellung
an Originalität. Alles findet sich
in dieser Musik, die Gebrochenheit
und Vielfältigkeit des 20.
Jahrhunderts: Auflehnung und
Provokation, innere Emigration,
Anpassung und schöner Schein.
Packend: Prokofieffs
2.Violinsonate trifft auf das fast
gleichzeitig entstandene
Violinkonzert seines Widersachers
Kabalewski. Noch Jahrzehnte
nach seiner öffentlichen
Brandmarkung spürt man in Schostakowitschs
Cellokonzert seine gebrochene
Seele. Die späten Konzerte von Richard
Strauss sind ein Abgesang
auf eine untergegangene Welt, eine
Welt, für die alle Komponisten
nach neuen Gesangstönen suchten,
sei es als ekstatischer
Liebestaumel, als Schrei um
Erbarmen vor dem Verdammtsein oder
als pure spätromantische
Schönheitstrunkenheit. Aber die
Modernen Klassiker besitzen auch
kauzigen Humor, Ironie und ein
charmantes Unterhaltungsbedürfnis.
Rolf
Fath
|
|
|
|