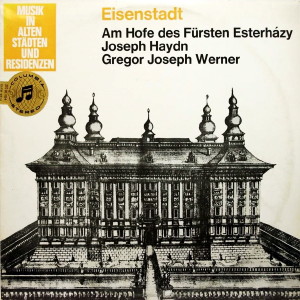 |
| 1 LP - C
91 104 - (p) 1961 |
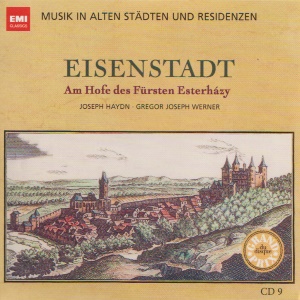 |
| 1 CD - 9
28340 2 - (p) & (c) 2013 |
|
| EISENSTADT - Am
Hofe des Fürsten Esterházy |
|
|
|
|
|
| Joseph Haydn
(1732-1809) |
Lo Speziale
(Der Apotheker) - Dramma giocoso
nach einem Libretto von carlo
Goldoni (1768)
|
|
A1
|
|
1.
Ouvertüre |
6' 51" |
|
|
2.
Arie des Mengone: "Per
quel che ha mal di stomaco" -
(1. Akt, Szene 4) |
4' 39" |
|
|
|
|
|
| Joseph Haydn |
Barutontrio
Nr. 96 h-moll Hob. XI:96 -
"Divertimento á tres 96 to per il
Pariton, Viola e Basso"
|
|
A2
|
|
3.
Largo |
6' 02" |
|
|
4.
Allegro |
4' 12" |
|
|
5.
Menuett |
2' 31" |
|
|
|
|
|
| Gregor Joseph Werner
(1695-1766) |
Pastorella
de Nativitate Domini
(Hirtenkantate zur Christnacht) -
für Sopran, Alt, Tenor, Baß, 2
Oboen, 2 Violinen und Basso comtinuo |
|
B1
|
|
6. Aria
pastoritia: "Auf, auf,
ihr Hurten allzugleich" |
5' 35" |
|
|
7.
Choral: "Der Tag, der ist
so freundenreich" |
1' 23" |
|
|
|
|
|
| Gregor Joseph Werner |
Pastorella in D
- für
konzertierende Orgel und
Streicher - Herausgegeben
von ernst Fritz Schmid
|
|
B2
|
|
8. Andante |
2' 57" |
|
|
9.
Larghetto |
3' 01" |
|
|
10.
Allegro |
1' 44" |
|
|
|
|
|
| Joseph Haydn |
11.
Te Deum C-dur Hob. XXIIIc:2 -
(Vermutlich 1800)
|
10' 07" |
B3
|
|
|
|
| Theo
Altmeyer, Tenor (2,6-7) |
Chor der St.
Hedwigs-Kathedrale Berlin (11) |
|
| Alfred Lessing,
Baryton (3-5) |
Berliner
Philharmoniker / Karl Forster, Leitung
(1-2,6-11) |
|
| Paul Schröer, Viola
(3-5) |
|
|
| Irene Güdel, Violoncello
(3-5) |
|
|
| Lisa Otto, Sopran
(6-7) |
|
|
| Sieglinde Wagner,
Alt (7) |
|
|
| Theo Adam, Bass
(6-7) |
|
|
| Wolfgang Meyer,
Orgel (6-11) |
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
-
Gemeindehaus, Berlin-Zehlendorf
(Germania) - febbraio 1961 (1-2)
- Electrola-Studio, Köln
(Germania) - febbraio 1961 (3-5)
- Grunewaldkirche, Berlin
(Germania) - febbraio 1961 (6-11) |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Fritz
Ganss (1,2,6-11) / Gerd Berg (3-5)
/ Christfried Bickenbach &
Horst Lindner (1,2,6-11) / Ernst
Rothe (3-5) |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- C 91 104 - (1 LP) - durata 49'
50" - (p) 1961 - Analogico |
|
|
Altre edizioni
LP
|
|
- |
|
|
Edizioni CD |
|
EMI
Music - 9 28340 2 - (1 CD) -
durata 49' 50" - (p) & (c)
2013 - ADD |
|
|
Cover |
|
Arx
Kismarton - Esterházisches Schloß
in Eisenstadt (um 1680) -
Burgenländisches Wolfmuseum,
Eisenstadt
|
|
|
|
|
Musik
am Hofe der Fürsten
Esterházy
Das ehemals kleine und
verträumte Eisenstadt,
südlich von Wien
zwischen dem
Leithagebirge und dem
Neusiedlersee liegend,
ist durch die nach dem
Ersten Weltkrieg
vorgenommene Teilung
Österreich/Ungarns
schließlich 1926
Landeshauptstadt und
damit Sitz der
Landesregierung des
Österreich zugefallenen
Burgenlandes geworden.
Die jetzt etwa 6000
Einwohner zählende Stadt
verdankt ihre
Berühmtheit aber weniger
dieser politischen
Entwicklung, als
vielmehr dem Umstand,
daß das Geschlecht der
Esterházy hier seinen
Stammsitz hat und neben
Wissenschaft und Kunst
der Musik eine besondere
Pflegestätte gab. Hier
wirkte eine stattliche
Reihe hervorragender
Kapellmeister und
ausgezeichneter Musiker,
allen voran von
1761-1790 Joseph Haydn,
der Großmeister der
Klassik.
Die Familie Esterházy
war 1622 durch
Pfandrecht in den Besitz
der Herrschaften
Eisenstadt und
Forchtenstein gekommen
und hatte bereits nach
einem runden
Vierteljahrhundert die
alte Burg Eisenstadt zu
erwerben vermocht. Der
Aufstieg zu einer
Großmacht erfolgte unter
dem langen und sehr
erfolgreichen Majorat
des Palatin Paul, der
1687 in den Fürstenstand
erhoben wurde. Er war es
auch, der die
Umgestaltung und den
Umbau der alten Burg in
das im großen und ganzen
noch heute in dieser
Form erhaltene
Barockschloß vorgenommen
und 1672 beendet hat.
Aber nicht nur seine
wirtschaftlichen und
politischen Fähigkeiten
brachten diesem ersten
Fürsten der Familie
Esterházy Anerkennungen
ein, er war auch ein
besonderer Kenner und
Förderer der Musik; er
besaß nicht nur eine
eigene Musikkapelle,
sondern hat sich auch in
seiner „Harmonia
caelestis seu Melodiae
musícae per decursum
totius anni adhibendae
ad usum musicorum" von
1711 als vorzüglicher
Musiker und Dichter
erwiesen. Durch ihn
entwickelte sich das
Eisenstädter Schloß (und
damit auch das seit 1648
zur Freistadt erklärte
Eisenstadt) immer
stärker zu einem
geistigen und
künstlerischen Zentrum
in Europa.
Unter Paul Anton (von
1721-1762 regierender
Fürst) diente der
vorzügliche und
fruchtbare Kapellmeister
und Komponist Gregor
Joseph Werner; auch
Joseph Haydn wurde in
der Regierungszeit des
Fürsten Paul Anton als
Vicekapellmeister der
Hofkapelle nach
Eisenstadt berufen.
Fürst Nicolaus I. fand
bei seinem
Regierungsantritt nach
dem Tode seines Bruders
Paul Anton alle
Bedingungen vor, die ihm
die Möglichkeiten gaben,
einen außerordentlich
prachtvollen Hof zu
führen und einen Prunk
zu entfalten, den Goethe
anläßlich der Krönung
Joseph II. zum Deutschen
Kaiser in Frankfurt am
Main 1765 als das
„esterházysche
Feenreich" preisen ließ
und der Nicolaus den
Beinamen „der
Prachtliebende" oder
„der Prächtige"
einbrachte. Trotz des
bereits in Eisenstadt
vorhandenen Stammsítzes
und des Schlosses in
Forchtenstein, der
beiden herrschaftlichen
Palais in Preßburg und
Wien ersetzte er das
Jagdschloß Süttör durch
das nach französischem
Geschmack und Prunk
eingerichtete und
berühmt gewordene
Prachtschloß Esterháza,
das nach mehrjähriger
Bauzeit 1769
fertiggestellt wurde.
Hier residierte Fürst
Nicolaus in den
Sommermonaten und
veranstaltete seine
mehrfach beschriebenen
Feste, die sich meist
über zwei bis drei Tage
erstrecktenl und
erlesene Opern- und
Schauspielaufführungen,
Konzerte, Festgelage,
Bälle,
Volksbelustigungen und
Volkstänze sowie
illuminationen von Park
und Schloß, Feuerwerke
und sogar gauklerische
Vorführungen umfaßten.
Musik und Oper waren
freilich besondere
Höhepunkte der
Esterházyschen
Feierlichkeiten. Für die
Schauspíele wurden
jeweils wandernde
Bühnentruppen
verpflichtet, so unter
anderem die
vortreffliche Wahrsche
Theatergesellschaft.
Darüberhinaus besaß die
Familie Esterházy eine
der berühmtesten
Gemäldesammlungen, die
später den Grundstock zu
der kostbaren Budapester
Nationalgalerie legte.
Als Musiker von
beträchtlichen
Fähigkeiten war Fürst
Nicolaus um den Ausbau
der Hofkapelle besonders
bemüht. Nach seinem
Wunsch hat Haydn von
1776 bis zu des Fürsten
Tod 1790 einen
Opernbetrieb aufgebaut,
der in seiner
Vielseitigkeit und
Qualität sich
gleichberechtigt neben
den in Wien stellen
konnte. Haydns
Haupttätigkeit in
Eisenstadt am
esterházyschen Hof deckt
sich im großen und
ganzen mit der
Regierungszeit des
Fürsten Nicolaus, und
Haydn hat es diesem
Fürsten zu verdanken,
daß er jene Bedingungen
vorfand, die sein Genie
zur Entfaltung
benötigte. Ihm stand
zwar ein nur kleines,
aber mit vorzüglichen
Musikern besetztes
Orchester zur Verfügung;
stellvertretend seien
hier der Konzertmeister
Luigi Tomasini, die
Violoncellisten Joseph
Weigl, Vater des später
bekannt gewordenen
Opernkomponisten Joseph
Weigl (dem Schöpfer der
„Schweizer Familie"),
und Anton Kraft genannt.
Haydn war sich dieser
glücklichen
Arbeitsbedingungen
dankbar bewußt, wie eine
Mitteilung an seinen
Freund und ersten
Biographen Griesinger
belegt:
„Mein
Fürst war mit allen
meinen Arbeiten
zufrieden, ich erhielt
Beyfall, ich konnte
als Chef eines
Orchesters Versuche
machen, beobachten,
was den Eindruck
hervorbringt, und was
ihn schwächt, also
verbessern, zusetzen,
wegschneiden, wagen;
ich war von der Welt
abgesondert, Niemand
in meiner Nähe konnte
mich an mir selbst
irre machen und
quälen, und so mußte
ich original werden."
In seiner
autobiographischen
Skizze von 1776 schreibt
er zusätzlich, daß er
beim Fürsten Esterházy
„zu leben und zu sterben
wünsche". Erst später
hat er die Einsamkeit
und die
Abgeschlossenheit von
der großen Welt mit
ihren musikalischen
Anregungen beklagt.
Jedoch hat er die
Bindungen an den Fürsten
Esterházy nie
aufgegeben. Als Nicolaus
II., der vierte Fürst,
dem Haydn zu dienen
hatte, nach dem
vierjährigen Interregnum
ohne Orchester und
Theater das Musikleben
an seinem Hofe wieder
begründete und zu neuem
Ruf und Ansehen führte,
nahm Haydn den Dienst
für die Hofkapelle nach
seiner zweiten Londoner
Reise 1795 von Wien aus
wieder auf. Er
komponierte zwischen
1796 und 1802 noch seine
sechs großen Messen für
seinen Fürsten bzw. zum
Namenstag seiner Fürstin
Maria Hermenegild,
geborene Prinzessin von
Liechtenstein, die ihrem
Kapellmeister sehr
gewogen war. Daß es nach
den zwei Londoner
Reisen, die Haydn als
selbständiger und freier
Komponist und Musiker
unternommen und die ihm
sogar den akademischen
Grad eines Doktors der
Tonkunst an der Oxforder
Universität eingebracht
hatten, nicht wie bei
Wolfgang Amadeus Mozart
zu einem Bruch, sondern
zu einer
vollbefriedigenden
Zusammenarbeit mit
seinem Fürsten kam, lag
neben Haydns eigenem
Charakter an der
Bereitschaft des Fürsten
Nicolaus II., seinem
Kapellmeister und
Komponisten die
gebührende Freiheit zu
gewähren und jene
ehrerbietige Achtung
entgegen zu bringen, die
in der fürstlichen
Anrede „Herr von Haydn"
ihren Ausdruck fand. So
blieb Haydn bis ins hohe
Alter mit Eisenstadt
verbunden, mit jener
Stadt, in der er fast 30
Jahre gelebt hat und in
der ein sehr großer Teil
seiner Werke
uraufgeführt worden ist.
In der ehemaligen
Kloster-, jetzigen
Haydn-Gasse 21 hat er
ein eigenes Haus
besessen, das zweimal
durch Feuersbrunst, und
zwar 1768 und 1776, fast
Vollständig zerstört und
mit Hilfe der Stadt und
seines Fürsten wieder
aufgebaut worden war.
Höchstwahrscheinlich
sind durch diese beiden
Katastrophen auch
etliche seiner Werke
vernichtet worden,
darunter vermutlich ein
Kontrabaßkonzert. Ebenso
wie sein Vorgänger
Gregor Joseph Werner hat
Haydn neben den
beruflichen
Verpflichtungen nach den
Eintragungen in den
Eisenstädter
Kirchenbüchern auch als
Trauzeuge und Taufpate
an dem persönlichen
Schicksal, seiner
Musiker teilgenommen.
Diese burgenländische
Stadt hat also nicht
zuletzt durch Haydns
Leben und Wirken ihre
besondere Auszeichnung
erhalten.
Johann Nepomuk Hummel,
den Haydn sehr geschätzt
hat, wurde 1804 für die
Leitung der Hofkapelle
gewonnen, während
Verhandlungen mit dem in
Paris lebenden Cherubini
zu keinem Ergebnis
führten. In Hummels
Kapellmeistertätigkeit
fällt auch die
Uraufführung von
Beethovens C-dur Messe
am 13. September 1807 in
Eisenstadt, die im
Auftrage des Fürsten
Nicolaus II. entstanden
ist und große
Bewunderung und Aufsehen
erregte. Obwohl es unter
Hummel zu einem
abwechslungsreichen und
vielseitigen Musik- und
Theaterbetrieb vor allem
mit deutschen Opern
gekommen ist, hat seine
Wirksamkeit am Hofe der
Esterházy unter seinen
eigenen menschlichen
Schwächen gelitten. Nur
durch Haydns Vermittlung
dürfte die erste
Entlassung nicht wirksam
geworden sein,
schließlich kam es 1811
doch zur Beendigung des
Dienstverhältnisses. Die
recht stark vertretene
Kapelle erhielt nach
einer kurzen
Zwischenzeit mit Antonio
Polzelli (1812/13) den
bereits seit längerem
als Vicekapellmeister
wirkenden Johann Nepomuk
Fuchs zum Leiter. Franz
Liszt, der Sohn eines
esterházyschen
Gutsverwalters, empfing
durch diese Kapelle
erste Anregungen und
fand in seinem Fürsten
einen wohlwollenden
Förderer. Das
Hoforchester wurde
jedoch bereits 1813,
dann noch einmal 1827
verkleinert und
schließlich 1848
gänzlich aufgelöst.
Damit hörte ein
Musikzentrum auf zu
bestehen, das etwa 50
Jahre hindurch zu den
ersten Kulturstätten
Europas gezählt hatte.
Auszug aus der
autobiographischen
Skizze, die Haydn dem
Herausgeber eines
biographischen
Lexikon: großer
Zeitgenossen 1776 in
Form eines fiktiven
Briefes zur Verfügung
stellte.
„Ich
wurde geboren Anno
1732 den letzten Mertz
in dem Marktfleck
Rohrau in
Unterösterreich bei
Prugg an der leythä.
Mein Sel. Vatter ware
seiner Profession ein
Wagner und Unterthan
des Grafen Harrachs,
ein von Natur aus
großer Liebhaber der
Musik. Er spielte ohne
eine Note zu kennen
die Harpfe, und ich
als ein Knabe von 5
Jahren sang ihm alle
seine simple kurze
Stücke ordentlich
nach, dieses verleitet
meinen Vatter mich
nach Hainburg zu dem
Schul Rector meinen
Anverwandten zu geben,
um allda die
musikalischen Anfangs
Gründe sammt anderen
jugentlichen
Notwendigkeiten zu
erlehrnen. Gott der
Allmächtige (welchem
Ich alleínig so
unermessene Gnade zu
danken) gab mir
besonders in der Musik
so viele Leichtigkeit
indem ich schon in
meinem 6. Jahr ganz
dreist einige Messen
auf dem Chor
herabsang, auch etwas
auf dem Clavier und
Violin spielte.
In dem
7. Jahr meines alters
hörte der Sel. Herr
Kapell Meister von
Reutter in einer
Durchreise durch
Hainburg von ungefähr
meine schwache doch
angenehme Stimme. Er
nahme mich alsogleich
zu sich in das Capell
Hauss, allwo ich neben
dem Studiren die
singkunst, das Clavier
und die Violin von
sehr guten Meistern
erlehrnte, ich sang
allda sowohl bei St.
Stephan als bei Hof
mit großem Beifall bis
in das 18. Jahr meines
Alters den Sopran. Da
ich endlich meine
Stimme verlohr, mußte
ich mich in
Unterrichtung der
Jugend ganzer acht
Jahr kummerhaft
durchsdwleppen (durch
dieses Elende Brod
gehen viele Genie zu
Grunde, da ihnen die
Zeit zum Studiren
mangelt), die
Erfahrung traffe mich
leider selbst, ich
würde das wenige nie
erworben haben, wann
ich meinen
Compositions Eyfer
nicht in der Nacht
fortgesetzt hätte, ich
schriebe fleißig, doch
nicht ganz gegründet,
bis ich endlich die
Gnade hatte von dem
berühmten Herrn
Porpora (so dazumal in
Wien war) die ächten
Fundamente der
setzkunst zu
erlehrnen: endlich
wurde ich durch
Recomendation des
seligen Herrn von
Fürnberg (von welchem
idw besondere Gnade
genosse) bei Herrn
Grafen von Morzin als
Direkteur, von da aus
als Capellmeister bei
Sr. Durchl. dem
Fürsten Esterházy an
und aufgenommen, allwo
ich zu leben und zu
sterben mir wünsche."
Haydn:
Anstellungsvertrag in
Esterházy. „Convention
und Verhaltungs-Norma
des
Vice-Capel-Meisters"
benannt, enthält in
vierzehn Artikeln
unter anderem folgende
Vorschriften:
„Heute
Endesangesetzten Tag
und Jahr ist der in
Österreich zu Rohrau
gebürtige Joseph
Heyden bey Ihro
Durchlaucht Herrn Paul
Anton des Heyl. Röm.
Reichs Fürsten zu
Esterházy und Galantha
etc. als ein
Vice-Capel-Meister in
die Dienste an- und
aufgenommen worden,
dergestalten das
weilen
1 mo. zu
Eysenstadt ein
Capel-Meister nahmens
Gregorius Werner schon
lange Jahre hindurch
dem hochfürstl. Hause
Treu, emsige Dienste
geleistet, nunmehro
aber, seines hohen
Alters und daraus
öfters entstehender
unpäßlichkeit halber,
seiner
Dienst-schuldigkeit
nachzukommen nicht
allerdings imstande
ist, so wird er
Gregorius Werner,
dannoch in Ansehung
seiner langjährigen
Dienste ferners, als
Ober-Capel-Meister
verbleiben, er Joseph
Heyden hingegen als
Vice-Capel-Meister zu
Eysenstadt in der
Chor-Musique Ihme,
Gregorio Werner, qua
Ober-Capel-Meistern
subordiniert seyn, und
von ihme dependieren.
In allandern
Begebenheiten aber, wo
eine Musique immer
gemacht werden solle,
wird alles, was zur
Musique gehörig ist,
in Genere und Specie
an ihn
Vice-Capel-Meister
angewiesen. sofort
2 do.
wird er Joseph Heyden
als ein Haus-Officier
angesehen, und
gehalten werden. Darum
hegen Sr. Hochfürstl.
Durchlaucht zu ihme
das gnädige vertrauen,
dass er sich also, wie
es einem Ehrliebenden
Haus-Officier bei
einem fürstlichen
Holfstadt wohl
anstehet, nüchtern,
und mit denen
nachgesetzten Musicis
nicht Brutal, sondern
mit glimpf und arth
bescheiden, ruhig,
ehrlich, aufzuführen
wissen wird,
haubt-sächlich, wann
vor der Hohen
Herrschaft eine
Musique gemacht wird,
solle er
Vice-Capel-Meister
samt den subordinirten
allezeit in Uniform
und nicht nur er
Joseph Heyden selbst
sauber erscheinen,
sondern auch alle
andere von ihm
dependirende dahin
anhalten, dass sie der
ihnen ausgegebenen
Instruction zufolge in
weissen Strümpfen,
weisser Wäsche,
eingepudert, und
entweder in. Zopf oder
Har-Beutel, Jedoch
durchaus gleich sich
sehen lassen.
7 mo.
Solle er
Vice-Capel-Meister auf
alle Musicalien, und
Musicalische
Instrumenten
all-möglichen Fleiss
und genaue Absicht
tragen, damit diese
aus unachtsamkeit,
oder nachlässigkeit
nicht vertorben, und
unbrauchbar werden,
auch für solche
repondiren.
8 vo.
Wird er Joseph Heyden
gehalten seyn, die
Sängerinnen zu
instruiren, damit sie
das Jenige, was sie in
Wlenn mit vieller mühe
und speesen von
vornehmen Meistern
erlernet haben, auf
dem Land nicht abermal
vergessen, und weillen
er Vice-Capel-Meister
in unterschiedlichen
Instrumenten erfahren
ist, so wird er auch
in all-jenen, denen er
kundig ist, sich
brauchen lassen.
14 to.
Verspricht die
Herrschaft ihne Joseph
Heyden nicht nur so
lange in Diensten zu
behalten, sondern wenn
er eine vollkommene
Satisfaction leisten
wird, soll er auch dıe
expectanz auf die
Ober-Capel-Meisters-stelle
haben, widrigenfalls
aber ist Hochderselben
allezeit frey, ihne
auch unter dieser Zeit
des Dienstes zu
entlassen
Urkund
dessen sind zwey
gleichlautende
exemplaria gefertigt,
und ausgewechselt
worden.
Gegeben
Wienn, den 1. May
1761.
Ad
Mandatum Celsissimi
Principis
Johann
Stifftel
Secretair
Eisenstädter
Schloßkonzert
Trotz der Bemühungen des
1960 verstorbenen Ernst
Fritz Schmid, dem
Editionsleiter der Neuen
Mozart-Gesamtausgabe,
steht das Schaffen des
esterházyschen
Kapellmeisters und
fürstlichen Komponisten
Gregor Joseph Werner
immer noch vollkommen im
Schatten seines großen
Nachfolgers Joseph
Haydn. Uber den
Lebensweg Werners ist
bisher nicht viel
bekannt geworden. Nach
der Inschrift seines
Grabdenkmals ist er
1695, vielleicht in
Augsburg, geboren. Es
wird vermutet, daß er in
Wien bei dem berühmten
Hofkapellmeister Johann
Joseph Fux und bei
Antonio Caldara seine
Musikstudien betrieben
habe. Am 10. Mai 1728
wurde er jedenfalls als
„Capellmeister" an die
fürstlich-esterházysche
Hofmusik berufen.
Pflichtgetreu und
fleißig hat er die
Aufgaben, die diese
Stellung mit sich
brachte, bis zu seiner
Pensionierung im Jahre
1761 erfüllt. Der junge
und tatkräftige Joseph
Haydn übernahm zu diesem
Zeitpunkt die Leitung
der Hofkapelle. Werner
wurde zwar zum
Oberkapellmeister
ernannt und blieb für
die Kirchenmusik, seine
eigentliche Domäne,
weiterhin zuständig;
diese Regelung erwies
sich aber als ungünstig
und führte zu
Spannungen. Werner
verstand den
Kompositionsstil seines
jungen Kollegen nicht
und soll Haydn einen
„Modehansl" und
„Gsanglmacher" genannt
haben. Haydn hat Werner
diese Kritik nicht
nachgetragen, sondern im
Gegenteil 1804 in
Verehrung seines
Vorgängers noch sechs
Fugen Werners für
Streichquartett
herausgegeben und ihm
damit ein Denkmal
gesetzt. Am 3. März 1766
starb Werner nach einem
arbeitsreichen Leben.
Sein vielseitiges
Schaffen umfaßt eine
große Zahl von Messen,
Motetten und Oratorien
sowie Weihnachtsmusiken.
Aber auch
Instrumentalwerke, von
denen vor allem sein
1748 gedruckter
Instrumentalkalender
bekannt geworden ist,
sowie einige weltliche
Kantaten belegen seinen
Einfallsreichtum und
seine meisterliche
Kompositionskunst.
Die beiden Werke von
Gregor Joseph Werner,
die Hirtenkantate „Auf,
auf, ihr Hirten
allzugleich" (Pastorella
de Nativitate Domini)
und das kleine,
orchesterbegleitete
Orgelkonzert
(Pastorella) können
bisher nicht datiert
werden. In ihrer
Tonsprache gehören sie
bereits in die
Rokokozeit oder die
Vorklassik. Die
Vermutung liegt deswegen
nahe, daß beide Werke
erst in den 50er
odersogar 60er Jahren
entstanden sind.Vor
allem die Hirtenkantate
ist mit ihren
melodischen Einfällen
und ihrer Schlichtheit
ein Werk, das auch dem
frühen Haydn alle Ehre
gemacht hätte. Bei der
Orgelpastorella spürt
man unmittelbar die
zeitliche, und beinahe
auch lokale Nähe (Wien
und Eisenstadt liegen ja
nicht allzu weit
auseinander, außerdem
hatte der Fürst
Esterházy in Wien ein
Palais) zu Haydns
eigenem Orgelkonzert aus
dem Jahre 1756. Diese
beiden hier
aufgenommenen
feingeschliffenen
Kostbarkeiten machen es
dem heutigen Hörer
schwer, einen
tiefgreifenden
Unterschied zwischen
Werners später und
Haydns früher Kunst zu
bemerken und die
Beurteilung Haydns durch
Werner als einen
„Modehansl" und
„Gsanglmacher" zu
begreifen. Aber Werner
kommt im Grunde von der
alten, streng
kontrapunktischen Schule
Fuxscher Prägung her,
wie seine fast
unbekannten
Fugenarbeiten beweisen.
Der Text der
Hirtenkantate ist im
Burgenländischen
Dialekt, vielleicht
sogar von Werner selbst,
abgefaßt. Ernst Fritz
Schmid hat ihn behutsam
unter Beibehaltung
mundartlicher Anklänge
ins Hochdeutsche
übertragen. Die „Aria
pastoritia" ist ein
Strophenlied, an dem
sich alle drei Solisten,
der erste Engel und die
beiden Hirten
abwechselnd beteiligen.
Zu dem abschließenden
wuchtigen Choral „Der
Tag, der ist so
freudenreich" tritt eine
Altstimme, ein zweiter
Engel, dazu.
Im Orgelkonzert werden
die meist kurzatmigen,
verspielten Motivketten
in den beiden Ecksätzen
durch gliedernde
Unisonoeinwürfe
unterbrochen. Der
getragene
Larghetto-Mittelsatz
schafft den notwendigen
ausgewogenen Kontrast in
dieser schlichten
instrumentalen
Weihnachtsmusik für
Solo-orgel und
Streicher.
Zu den Werkgruppen
Haydns, die mehr oder
minder vergessen waren
und erst in letzter Zeit
wiederbelebt wurden,
zählen unter anderem
auch seine zahlreichen
Opern (zwischen 1766 und
1792 entstanden); es mag
heute noch vielen
unbekannt sein, daß
Haydn sehr gern Opern
geschrieben hat. Erst
neuesten Forschungen ist
es gelungen, Umfang,
Bedeutung und Größe des
esterházyschen
Opernbetriebs vor allem
seit 1776 bis 1790
nachzuweisen. Welchen
Ruf Haydns Opern selbst
und die esterházyschen
Opernaufführungen gehabt
haben, geht nicht nur
aus den häufigen
Berichten in den
Zeitungen und
Theateralmanachen der
damaligen Zeit hervor,
sondern auch aus einem
Wort der Kaiserin Maria
Theresia anläßlich ihres
Besuches in Eisenstadt:
„Wenn ich eine gute Oper
hören will, gehe ich
nach Esterhaz."
Die Opera buffa „Lo
Speziale" (Der
Apotheker), Haydns
zweite italienische Oper
und von ihm als „Dramma
giocoso" bezeichnet, ist
zur Eröffnung des
neuerbauten
Theatergebäudes in
Esterháza am 5. August,
dem Namenstag der
Fürstin Maria Esterházy
aufgeführt und des
öfteren wiederholt
worden. Auch zwei
Aufführungen in Wien im
Jahre 1770, darunter
eine konzertante, sind
belegt. Sehr
wahrscheinlich hat Haydn
Ausschnitte aus dieser
Oper auch in den
pflichtgemäßen
musikalischen
Veranstaltungen im
Schloß zu Eisenstadt
erklingen lassen. Der
Text ist dem
gleichnamigen Werke des
italienischen
Lustspieldichters Carlo
Goldoni (1707-1793)
entnommen und von einem
bisher unbekannten
Librettisten bearbeitet
worden. Es könnte sein,
daß der als „Tenorist"
am Hofe des Fürsten
Esterházy angestellte
Karl Friebert die
Umgestaltung des
Goldoni-Textes
vorgenommen hat. Als
Vorwurf für diese
komische Oper dient die
immer wieder verwendete
Darstellung eines
Pflegevaters, des
Apothekers, der sein
Mündel zu heiraten
beabsichtigt, während
zwei junge Liebhaber in
Verkleidungsszenen
versuchen, dies zu
verhindern und die
hübsche Angebetete
selbst als Braut
heimzuführen. Mengone,
der sich als Gehilfe vom
alten Apotheker hat
dingen lassen, empfiehlt
in seiner Tenor-Arie
„Per quel che ha mal di
stomaco" Rhabarber gegen
Bauchschmerzen und Manna
gegen Darmverstopfung.
Haydn, der gern den
verschiedensten
Situationen die komische
und heitere Seite
abgewann, greift zu
einem Wortwitz. Zur
Unterstreichung, daß die
von Mengone
angepriesenen Mittel den
Stuhlgang wieder regeln
würden, läßt Haydn bei
dem Wort „anderó" den
Sänger und die
begleitenden Streicher
deutlich demonstrieren,
daß der Patient nunmehr
keine Not mehr mit dem
„- a a a a" habe. Durch
ein „NB“ (Notabene),
also durch den Hinweis
„Paß aufl", im Autograph
macht Haydn noch
besonders darauf
aufmerksam.
Für die Entstehung der
Barytontrios ist ein
besonderes Ereignis
bedeutungsvoll gewesen.
Der alternde Gregor
Joseph Werner
beobachtete mit Neid und
Mißgunst den wachsenden
Einfluß und Erfolg
seines jungen
Vicekapellmeisters
Haydn. Im Herbst 1765
machte er seinem Ärger
in einer Eingabe an den
Fürsten Nicolaus Luft.
Er beschwerte sich über
Haydns angeblich
mangelhafte
Aufsichtspflicht, seinen
ungenügenden Fleiß und
über unordentliche
Betreuung des
Notenmaterials. Fürst
Nicolaus gab darauf in
einer Instruktion an
Haydn unter Punkt 6
folgende Anweisung:
„Endlichen
wird ihme Capelmeister
Haydn bestermassen
anbefohlen Sich
selbsten embsiger als
bishero auf die
Compositionen zu
legen, und besonders
solche stücke, die man
auf der Gamba spiellen
mag, und wovon wir
noch sehr wenig
gesehen haben, zu
Componiren um seinen
Fleiß sehen zu
können.“
Mit den
Stücken für die Gambe
dürften der damaligen
Ausdrucksweise nach die
Barytontrios gemeint
sein. Haydn nahm sich
diese Ermahnungen zu
Herzen. In der kurzen
Zeitspanne von 5 Jahren
entstanden circa 90
Barytontrios, denen dann
bis 1775 noch ungefähr
weitere 30 folgten.
Insgesamt hat Haydn 126
zweifellos echte
Barytontrios im Auftrage
seines Fürsten
geschrieben. Während
etwa die ersten vierzig
Barytontrios trotz der
bereits erreichten
konzentrierten und
knappen Ausdrucksweise
noch von dem
Divertimentogeist, also
von der musikalischen
Unterhaltung getragen
werden, macht sich durch
die Auseinandersetzung
mit dem strengen Stil
des Kontrapunkts in
Haydns Barytontrios vor
1770 eine wachsende
Vertiefung des
musikalischen Ausdrucks
und eine Verfeinerung
der Satzkunst bemerkbar.
Unter den „Divertimenti
per il Baryton, Viola e
Basso" bis Nummer 100
ist das spätestens im
Dezember 1771
komponierte Trio Nr. 96
in h-moll eines der
schönsten Werke. Der 1.
Satz, ein Adagio, bringt
ein kontrapunktisch
gebundenes,
ausdrucksstarkes
Hauptthema, das später
durch ein gesangliches
und aufgelockertes
Gegenthema abgelöst
wird. Der Anfang des 2.
Satzes, des Allegro, hat
fast fugenmäßigen
Zuschnitt. Das melodiöse
„Menuett" mit seinem
durch die H-dur Tonart
aufgehellten Trio
beschließt dieses
musikalisch besonders
wertvolle Stück.
Haydns Te Deum in C-dur,
im 20. Jahrhundert zur
Unterscheidung von dem
in gleicher Tonart
stehenden Frühwerk auch
großes Te Deum oder Te
Deum für die Kaiserin
genannt, lag laut einer
von Haydn
unterzeichneten Quittung
am 28. Oktober 1800
fertig vor. Eine Notiz
von Botstiber (im 3.
Band der
Haydn-Biographie von
Pohl) aus einem Brief
des ersten
Haydn-Biographen
Griesinger an
Breitkopf &
Härtel, den Botstiber in
das Jahr 1800 legt,
könnte dazu verleiten
anzunehmen, daß dieser
mächtige und großartige
Lobgesang bereits zwei
oder drei Jahre eher
entstanden sei. Sehr
wahrscheinlich hat aber
Botstiber diesen leider
im letzten Weltkrieg
vernichteten
Griesinger-Brief nicht
richtig datiert; statt
in das Jahr 1800 fällt
er vermutlich in das
Jahr 1802, in dem der
Leipziger Verlag
Breitkopf & Härtel
durch seinen Mittelsmann
Griesinger mit Haydn
wegen der Herausgabe des
Te Deum verhandelte. Es
darf deshalb mit Recht
angenommen werden, daß
Haydn dieses wichtige
Kirchenmusikwerk
zwischen der 4. und 5.
großen Messe, der
Theresien- und der
Schöpfungsmesse im Jahre
1800 komponiert hat und
daß es zum Namenstag der
Fürstin Maria
'Hermenegild am 8.
September 1800 in der
Eisenstädter Bergkirche
uraufgeführt worden ist.
Der Uberlieferung nach
soll Haydn dieses Te
Deum jedoch für die
Kaiserin Marie Therese,
die Gattin Kaiser Franz
II., komponiert haben.
Dieses glanzvolle, in
strahlendem C-dur
erklingende Werk zum
Ruhme und zur Ehre
Gottes spannt den Bogen
von wuchtigen Anklängen
an den gregorianischen
Choral bis zur
kunstvollen,
jubílierenden Schlußfuge
„in te Domine speravi"
(auf Dich, o Herr, hab
ich gehofft), in der
Mitte unterbrochen von
einem innigen
ausdrucksgeladenen
Adagio „Te ergo
quaesumus" (Dich also
flehen wir an). Als ein
besonderer Höhepunkt am
Schluß des Te Deum ist
das niederdrückende und
quälende „confundar"
hervorzuheben. Sehr
wahrscheinlich hat
gerade dieses
„confundar" den als
Sängerknaben und später
als Organisten in St.
Florian wirkenden Anton
Bruckner so tief
beeindruckt, daß dieser
große spätromantische
Meister in seinem
ebenfalls in C-dur
stehenden Te Deum zu
einer ähnlichen
Wiedergabe gegriffen
hat.
Das Baryton
Das wenig bekannte und
auch zu Haydns Zeiten im
allgemeinen selten
gespielte Baryton gehört
zur Familie der
Gambeninstrumente. Als
sein Vorläufer darf
vermutlich die von
Michael Praetorius in
seinem „Syntagma
musicum" von 1619
erläuterte, mit
Resonanzsaiten
ausgestattete Viola
bastarda angesehen
werden. Wann das
Barytoninstrument in
seiner uns jetzt
bekannten Gestalt fertig
vorgelegen hat, läßt
sich nicht mehr genau
feststellen; jedenfalls
ist das Baryton 1687 bei
Daniel Speer in dieser
Weise beschrieben und
dann im 18. Jahrhundert
noch verschiedene Male
in den einschlägigen
Lehrbüchern und
Nachschlagewerken
erwähnt. In den äußeren
Maßen stimmt das Baryton
etwa mit denen der
Tenorgambe überein; es
besitzt wie die Viola
d'amore Resonanzsaiten,
die beim Baryton aber
unter dem Griffbrett
freiliegend
entlanglaufen, so daß
sie der Spieler auch mit
dem Daumen der linken
Hand anzupfen kann. Die
Zahl der mitklingenden
Resonanzsaiten stand für
dieses Instrument nicht
ganz fest. Joseph Haydn
hat seine Kompositionen
stets für ein
Barytoninstrument mit
nur 9 (gegenüber 15 bis
20 möglichen) metallenen
resonierenden Saiten
geschrieben, die für
gewöhnlich auf D-dur (A,
d, e, fis, g, a, h,
cis', d') abzustimmen
sind. Diese
mitschwingenden Saiten
geben dem instrument
einen weichen und
näselnden Ton und lassen
das Baryton in
Generalpausen - wie in
dem hier aufgenommenen
Barytontrio 96 -
nachklingen. Durch die
aufgehellte Klangfarbe
des Barytons werden die
angestrichenen 6 (bzw.
gelegentlich 7) wie bei
der Tenorgambe
festgelegten Spielsaiten
im Vergleich zu ihrer
wirklichen Einstimmung
eine Oktave höher
gehört. Haydn notiert
deswegen die
Barytonstimme im
Violinschiüssel, also
eigentlich eine Oktave
zu hoch. Seine
Kompositionen für das
Baryton belegen aber,
daß diese Notierung
Haydns eigenem
Klanghören und obendrein
der üblichen Spielpraxis
entspricht.
Zeitgenössische
Berichte, rühmen den
schwebenden und
lieblichen Klang dieses
Instrumentes, und der
namhafte Arzt, Musiker
und Komponist Friedrich
August Weber gesteht,
daß ihm der ehemalige
esterházysdıe Barytonist
Carl Franz in einem
Konzert „durch sein
Adagio sostenuto Thränen
auszupressen wußte,
dergleichen vor und nach
ihm kein Virtuose"
vermocht habe.
Sehr wahrscheinlich wäre
es seit dem Anfang des
20. Jahrhunderts trotz
der Rückgewinnung alter,
historischer
Musikinstrumente nicht
zu einer Wiederbelebung
des Barytonspiels und
der Barytonmusik
gekommen, wenn nicht ein
Joseph Haydn viele, fast
durchweg handschriftlich
überlieferte
«Kompositionen gerade
für dieses instrument
hinterlassen hätte. Nach
den Angaben im eigenen
Werkverzeichnis, das
sein Famulus Johann
Elßler, der Vater der
nachher berühmt
gewordenen Tänzerin
Fanny Elßler,
geschrieben hat, waren
es „insgesamt 163
Compositionen für das
Pariton". In
Wirklichkeit sind es
noch einige Werke mehr,
die Haydn für seinen
seit 1762 regierenden
Fürsten Nicolaus
komponiert hat, der ein
Liebhaber und Kenner des
Barytons war. Daß Haydn
auf die Spielfähigkeiten
und Wünsche des Fürsten
Rücksicht zu nehmen
hatte, ist neben
Andeutungen in Pohls
Haydn-Biographie aus
einer kürzlich
erschienenen
Veröffentlichung der
Esterházy-Dokumente
eindeutig zu erfahren.
Neben den als
Barytonisten
angestellten Hofmusikern
Joseph Welgl d. Ält.,
Andreas Lidl und Carl
Franz hat der Fürst
Nicolaus auch selbst
sehr oft den
Barytonpart, sogar vor
fürstlichen
Gesellschaften,
gespielt. Als dann Haydn
ab 1776 für den
esterházyschen Hof einen
vielseitigen
Opernbetrieb aufbaute
und leitete, haben an
seiner Stelle die
esterházyschen Musiker
Luigi Tomasini, Joseph
Purcksteiner
(Burgksteiner), Andreas
Lidl und Carl Franz
sowie Anton Kraft und P.
Primitivus Niemecz Werke
für das Baryton
komponiert. Vielleicht
sind auch die
Barytonkompositionen von
Neumann, Eybler, Pichl,
Hauschka für den Hof des
Fürsten Nicolaus
Esterházy geschrieben
worden.
(Columbia
C 91 104)
|
|