 |
| 1 LP - C
91 106 - (p) 1961 |
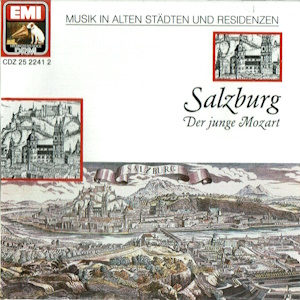 |
| 1 CD -
CDZ 25 2241 2 - (c) 1990 |
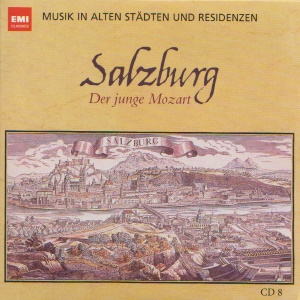 |
| 1 CD - 9
28339 2 - (p) & (c) 2013 |
|
| SALZBURG - Der
junge Mozart |
|
|
|
|
|
| Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791) |
Divertimento Nr.
1 Es-dur KV 113 - für
Streicher, 2 Oboen, 2 Englishhörner,
2 Klarinetten, 2 Fagotte & 2
Hörner |
|
|
|
1.
Allegro |
3' 06" |
A1
|
|
2.
Andante |
2' 51" |
A2
|
|
3.
Menuetto |
1' 51" |
A3
|
|
4.
Allegro |
2' 33" |
A4
|
|
Serenade
Nr. 1 D-dur KV 100 - für Streicher, 2
Oboen, 2 Hörner & 2 Trompeten |
|
|
|
5. Allegro |
2' 57" |
A5
|
|
6.
Andante |
3' 26" |
A6
|
|
7.
Menuetto |
2' 35" |
A7
|
|
8. Allegro |
2' 42" |
A8
|
|
9.
Menuetto |
2' 35" |
A9
|
|
10.
Andante |
1' 47" |
A10
|
|
11.
Menuetto |
2' 16" |
B1
|
|
12.
Allegro |
2' 45" |
B2
|
|
Cassation
Nr. 1 G-dur KV 63 - für Streicher, 2
Oboen & 2 Hörner |
|
|
|
13.
Marcia |
1' 54" |
B3
|
|
14.
Allegro |
3' 05" |
B4
|
|
15.
Andante |
2' 20" |
B5
|
|
16.
Menuetto |
3' 14" |
B6
|
|
17.
Adagio |
5' 19" |
B7
|
|
18.
Menuetto |
3' 27" |
B8
|
|
19.
Adagio. Allegro assai |
2' 25" |
B9
|
|
|
|
| Tivadar
Bantay, Oboe (5-12) |
Camerata
Academica des Mozarteums, Salzburg |
|
| Michael
Höltzel, Horn
(5-12) |
Bernhard
Paumgartner, Leitung |
|
| Christa
Richter-Steiner, Violine (13-19) |
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Schloss
Klessheim beu Salzburg (Austria) -
aprile 1960 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Fritz
Ganss / Christfried Bickenbach /
Horst Lindner |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- C 91 106 - (1 LP) - durata 53'
34" - (p) 1961 - Analogico |
|
|
Altre edizioni
LP
|
|
- |
|
|
Edizioni CD |
|
EMI Electrola -
CDZ 25 2241 2 - (1 CD) - durata
53' 34" - (c) 1990 - ADD
EMI Music - 9 28339 2 - (1
CD) - durata 53' 34" - (p) &
(c) 2013 - ADD |
|
|
Cover |
|
Salzburg,
Ende des 18. Jahrhunderts -
Nach einer Radierung von A.
Amon nach F. v. Neumann -
Salzburger Museum Carolino
Augusteum
|
|
|
|
|
Mozarts
Unterhaltungsmusik
Gut ein
Drittel des
626 Nummern
umfassenden
Köchel-Verzeichnisses,
des Katalogs
der Werke
Wolfgang Amadeus
Mozarts,
nennt
Kompositionen
unterhaltsamer
Art: Divertimenti,
Serenaden,
Kanons auf
heitere und
derbe Texte,
Menuette,
Contretänze,
Märsche,
Nachtmusiken,
Deutsche Tänze,
Ländler und
Gefälligkeitskompositionen
vokalen wie
instrumentalen
Charakters.
Dieser
Tribut an
das
Divertissement-Bedürfnis
des Rokokos
wurde von
Mozart in
allen
Abschnitten
seines
fünfunddreißigjährigen
Lebens entrichtet,
vor allem
in. der
frühen
Salzburger
Zeit, als
ihn Hofamt
und Bürgerlaune
zu solchem
Entgegenkommen
verpflichteten.
Die vielen
kompositorischen
Brot- und
Gelegenheitsarbeiten
spiegeln
Mozarts
musiksoziologische
Situation:
Er war
Auftragskomponist,
Musikbediensteter,
ein Kind
jenes
zerbrökkelnden
Ançien
Régime, das
dem Künstler
eine
höfischgesellschaftliche
Funktion der
Abhängigkeit
zuwies.
Überdies
kannte man
die
Spaltung.
von
„Unterhaltungsmusik”
und „ernster
Musik“ noch
nicht;
jegliche Art
von Musik
hatte zu
gefallen.
Und
schließlich
war Mozart
alles andere
als ein
sozialkritischer
Rebell, eine
auf stolze
Unabhängigkeit
pochende
Beethoven-Natur
oder ein
versponnener
Einzelgänger.
Er stellt
unter den
großen
Musikern den
Typ des
umgänglich-geselligen
Menschen
dar, den
agilen
Großstädter, den
zu Späßen
und
Unterhaltsamkeit
aufgelegten
Bohèmien, den
„kontaktreichen“
Betriebsamen,
der immer
Freunde,
Trinkkumpane,
Briefpartner
und Gönner
um, sich
haben mußte.
Sein Sinnen
und Trachten
kreiste
stets um
den
Menschen;
zur Natur
hatte er
überhaupt
kein
Verhältnis.
Er war der
städtische,
zivilisatorische
Gesellschaftsmensch
par excellence.
Die
psychologische
Wurzel von
Mozarts
Unterhaltungsmusik
ist
mindestens
ebenso
wichtig wie
die
soziologische: Es
bereitete
ihm Freude,
mit seiner
Musik zu
jener Geselligkeit
beizutragen,
die er
selbst so
sehr
schätzte.
Diese
Herzensbeziehung
zu jeder
Art von
gesellschaftlich
bezogener
Musik ließ
ihn die
unterhaltende
Kunst
wichtig
nehmen, wenn
sie ihm
auch
mitunter.
zur Last
fiel.
Mozarts
divertierende
Kompositionen
sind darum
durchwegs
ernsthaft
ausgearbeitet,
sind
vollwertige
Bestandteile
des
Gesamtwerks und
teilweise
sogar die
einzigen
Träger der
künstlerischen
Entwicklung;
anders als
bei
Meistern,
denen
Auftrags-
und
Unterhaltungsmusik
ein
mißliches
Ansinnen
bedeutete, finden
sich hier
keine
schludrigen
Arbeiten,
keine
unpersönlichen
Adaptionen
des
Zeitstils, keine
lustlos
erledigten Parerga
zum großen
Oeuvre.
Zeitweilig gaben
die
Serenaden,
Cassationen und
Divertimenti
sogar die
einzige
kompositorische
Möglickkeit, die
Entwicklung des jungen
Genier voranzutreiben.
Wo anders hätte Mozart
die stilbildenden
Enflüsse Michael Haydns,
der Bach-Söhne un der
Italiener fruchtbar für
seine Entwicklung als
singoniker verarbeiten
können als in
der dazumal
- das
heißt
während der
bis 1781
dauernden
Salzburger
Musikbeamtenzeit
- gefragten
und bestellten
Auftragskomposition
für
gesellschaftliche
Zwecke? Ein
Konzertleben
wie in
Wien kannte
man in
dem
fürsterzbischöflichen
Zwergstaat
genausowenig
wie ein
Operntheater.
Das ganze
Cherubino-Stadium
des jungen,
übersensiblen
und stets
verliebten
Compositeurs
mußte in
die schier
rituell
festgelegte
Satzfolge
der Nachtmusiken
gefaßt werden,
unter
Rücksicht
auf die
instrumentalen
Möglichkeiten des
kleinen Orchesters
und in
Hinblick auf
das recht
begrenzte
Auffassungsvermögen
der
Brotgeber
und
Landsleute.
Dieser
äußere Zwang
bewirkte eine
ausdrucksmäßige
Bereicherung
und Sublimierung
der
Unterhaltungsmusik,
wie sie in der gesamten
Musikgeschichte ohne
Beispiel ist. Mozart,
der in Fragen der Form
niemals ein
Revolutionär war,
vertiefte
das Schema
durch sein
Espressivo,
veredelte eine
spielerische
Kunstgattung
und
ästhetisierte
die tönende
Gebrauchsware.
In der
Wiener Zeit
nahm Mozarts
Unterhaltungsmusik
vornehmlich
auf die
Erfordernisse
eines
weltstädtischen
Hofes Rücksicht. Es
entstanden die
Contretänze und Märsche,
derentwegen
er weit mehr
geschätzt wurde denn als
Komponist
von Opern,
Sinfonien
und
Klavierkonzerten,
denen nur
die Kenner
Geschmack abzugewinnen
vermochten.
Daneben schrieb er
spaßige Kanans, heitere
Lieder und musikalische
Scherze zum Ergötzen des
Freundeskreises. Die
unterhaltende
Musik galt
ihm nicht
nur als
Tarnmittel für
manche
Kühnheit des
Ausdrucks,
sondern
nicht minder
auch als
eine
Möglichkeit,
dem feinen
wie dem
handfesten
Humor in
mancher
lustigen
instrumentalen
Wendung, in
schier
programmhaften
Schilderungen, in
artigen
Mystifikationen
und
ähnlichen
kompositorischen
Finessen
Luft zu
machen.
Bezeichnenderweise
wurde
Mozarts
unterhaltsame
Musik am
spätesten
„entdeckt“.
Ins
Mozartbild
des 19.
Jahrhunderts
paßte sie
nicht. Erst
ein Wandel
der
Mozart-Auffassung,
die
Entdeckerfreude
der
Dirigenten
(Hofrat Bernhard
Paumgartner
wäre vorab
zu nennen),
die Gesamtausgaben
und der
Lokalpatriotismus
der
Festspielstadt
Salzburg
lehrten den
„heiteren“
Mozart
schätzen.
Heute
herrscht kein
Zweifel
mehr: Die
Unterhaltungsmusik
ist ein
psychologisch wie
soziologisch
bedingter,
integraler
und
vollwertiger
Bestandteil
von Mozarts
Werk.
KARL
SCHUMANN
Der junge Mozart
Daß
Salzburg eines der
schönsten Fleckchen Erde
ist, darin würden uns
mit Überzeugung im 18.
Jahrhundert nur die
Fürsterzbischöfe des
Barocks und Rokokos
beipflichten. Die
Salzburger Bürger -
vollblütige,
derbknochige
Kleinstädter mit
bäuerlichem Einschlag -
kämen uns mit beredten
Klagen über den
wirtschaftlichen
Rückgang ihres
eingekeilten
Zwergstaates. Die
Familie Mozart erhöbe
Protest. Der Vater
Leopold, weil er als
ständig zurückgesetzter
Vizekapellmeister hier
zum Hypochonder werden
mußte. Der Sohn Wolfgang
Amadeus, weil ihm das
aufgezwungene Amt eines
Musikbediensteten die
Schwingen lähmte, weil
er kein Theater für
seine Opernplläne
vorfand, weil er seitab
von den weltstädtischen
Musikmetropolen leben
mußte und weil ihn
alles, was nicht Musik
war, wenig berührte.
Wenn er sich über
Salzburg äußerte, kam
ihm die Galle. „Nun von
unserer Salzburger
History! sie wissen,
bester freund, wie mir
Salzburg verhaßt ist! -
nicht allein wegen den
ungerechtigkeiten die
mein lieber vatter und
ich aldort ausgestanden,
welches schon genug
wäre, um so einen ort
ganz zu vergessen, und
ganz aus den gedancken
zu vertilgen!” Der Brief
an den Abbé Bullinger
(7. August 1778)
enthüllt Mozarts
Abneigung gegen
Salzburg. Es war die
Verbitterung eines
jungen Mannes, der seine
Karriere durch enge,
feudalistische
Verhältnisse beschnitten
sah und aus
verständlichem Groll
manches wohl gar zu
negativ beurteilte. Die
Bindung an Salzburg
griff über in die
Bindung an den Vater.
Immerhin war Mozart,
bereits der Meister des
„Idomeneo”,
fünfundzwanzig Jahre
alt, als er sich von
beiden Verknüpfungen
befreite, um in Wien und
auf Reisen ein
ungesichertes Dasein als
Compositeur, Pianist,
Dirigent und Musiklehrer
zu fristen. Salzburg sah
ihn nur ein einziges Mal
wieder und auch da nur
zu einem flüchtigen
Höflichkeitsbesuch.
Umgekehrt mögen die
Mozarts den biederen
Salzburgern als
Fremdkörper erschienen
sein. Den Kleinstädtern
sind Musikanten immer
suspekt. Leopold,
Mozart, der
Handwerkerssohn und
entlaufene
Theologiestudent aus
Augsburg, galt gewiß
nicht viel. Daß er zwei
musizierende
Wunderkinder, das
Nannerl und den fünf
Jahre jüngeren Wolfgang
Amadé - Mozart
unterzeichnete
zeitlebens als „Wolfgang
Amadé“; die lateinische
Form „Amadeus“ ist eine
romantisierende
Erfindung späterer
Biographen! - sein
eigen. nannte, großes
Aufhebens von den
Kleinen macht und mit
ihnen reiste (bis übers
Meer, nach London,.man
bedenke!), mußte jeder
Kleinbürger für eitel
Großspurigkeit und
Musikantendünkel halten.
Daß der Herr Papa, der
für Wolfgang Amadé
gleich nach dem lieben
Gott kam, die Kinder
auch noch selbst
unterrichtete - Mozart
hat weder eine Schule
besucht, noch
methodischen
Privatunterricht
genossen, außer in der
Musik - konnte nur als
ein Zeichen von Hochmut
ausgelegt werden. Im
übrigen lebten die
Mozarts wie kleine
Hofbeamte. Geschmack
konnten sie sich nicht
leisten. Mozart blieb
zeitlebens ein
nachlässiger Bohèmien,
der es nie zu
etwas brachte. Aber das
fiel ihm nie auf.
Wie mag sich Wolfgang
Amadé, der Knabe und
erwachende Jüngling,
zwischen seinen
Landsleuten ausgenommen
haben? Der winzige,
blasse, dauernd
kränkelnde und von
Pockennarben gezeichnete
Bub, der Stubenmensch,
diekünstlich entwickelte
Treibhauspflanze einer
einseitigen Erziehung
zwischen rustikalen,
pausbäckigen Leuten? Das
von frühesten Jahren an
beständig überforderte,
überreizte, übermüdete
Kind zwischen gesunden,
derben Gespielen? Den
Dialekt der Salzburger
hat er gewiß gesprochen,
stammte doch die Mutter
aus dem nahen St. Gilgen
am Wolfgangsee. Der
heimischen
Kraftausdrücke war er
mächtig; sie ergötzten
ihn und gaben ihm
Gelegenheit, die
angeborene
Übersensibilität ein
wenig zu kompensieren
oder zu verbergen.
Gleichaltrigen scheint
er sich nur
oberflächlich
angeschlossen zu haben.
Als er älter wurde,
schäkerte er gern mit
den drallen, ein wenig
einfältigen Mädchen, war
auch mitunter verliebt,
wohl auf die unbewußt
suchende Cherubino-Art,
wie sich das in den
langsamen Sätzen seiner
frühen Serenaden und
Symphonien spiegelt.
Eine junge Salzburgerin
lief ihm sogar aus dem
Kloster nach, um ihn vor
der Heirat mit der
„Weberischen“
zurückzuhalten: eine
Donna Elvira, die ihren
Don Giovanni anfleht.
Mozart tat sich später
etwas zugute auf seine
frühen, harmlosen
Erfolge. Zur Natur des
Salzburger Landes hatte
er - einer der wenigen
großen Künstler ohne
jegliches Naturgefühl -
überhaupt keine
Beziehung. Das lag an
der Erziehung à la mode.
Der Vater machte den
Sohn zu Hause wie beim
Reisen nur auf
Kuriositäten aufmerksam.
Die Schönheit des
Berglandes war dazumal
überhaupt noch
unentdeckt; der
Alpinismus war noch
lange nicht im Schwange.
Die Berge sah man für
nichts Besseres als ein
vierschrötiges
Verkehrshindernis an.
Die Jahre von 1769 bis
1771 waren eine harte
Krisenzeit für die
Familie Mozart. Der
Knabe Wolfgang Amadé kam
in die Pubertät, und ein
pubertierender Klavier-
und Orgelvirtuose war
eine weit geringere
Attraktion für die
Weltstädte als der
kleine, schmächtige Bub
in Staatsrock, Perücke
und Galanteriedegen.
Beim Nannerl, das
immerhin schon achtzehn
Jahre zählte,
offenbarten sich die
Grenzen ihrer
musikalischen Begabung;
sie zeigte sich als
guter Durchschnitt. Die
Wiener Reise von 1768
hatte Vater Leopold an
den Rand des
finanziellen Ruins
gebracht; die Kinder
waren krank geworden,
Wien zeigte die kühle
Schulter, man hatte
Schulden machen müssen,
und wäre nicht.der Dr.
med. Franz Anton Mesmer,
der Entdecker des
„animalischen
Magnetismus“ gewesen -
in „Così fan tutte“
verulkte Mozart später
den Mesmerianismus - so
wäre nicht einmal die
Premiere von „Bastien
und Bastienne” zustande
gekommen. Die
Schaustellung, des
Wunderkindes hatte sich
überholt; Vater Mozart
mußte danach trachten,
den heranwachsenden Sohn
als Kapellmeister oder
Komponist an einem Hofe
unterzubringen.
Zu diesem Behufe brach
man kurz vor Weihnachten
1769 - nachdem der alte
Fürsterzbischof von
Schrattenbach Wolfgang
Amadé zum salzburgischen
Konzertmeister ernannt
hatte - schweren Herzens
gen Italien auf. Ein
bitterkalter Winter
machte das Reisen zur
Qual. „Das Wolfgangerl
sieht aus, als wenn er
einen Feldzug getan
hätte”, berichtet der
Vater; der Knabe hatte
sich schwere
Erfrierungen geholt, was
für seine ohnehin labile
Gesundheit, für den
unausgesetzt von
Grippeanfällen und
Zahngeschwulsten
geplagten Knaben eine
große Belastung war.
Vater Leopold, der sich
obendrein auch noch für
einen geschickten
Amateur-Mediziner hielt,
verordnete dem kleinen
Patienten, der dauernd
über Müdigkeit klagte,
allerlei
„Brust-Latwerge”,
„Fieberpulver” und
Brechmittel.
(Gründlichen Aufschluß
über „Mozarts
Krankheitsgeschichte
gibt Aloys Greithers
Buch „Wolfgang Amadé
Mozart. Seine
Leidensgeschichte“,
Heidelberg, 1958). Die
erste Italienreise
dauerte ganze sechzehn
Monate. Eine beständige
Folge von Strapazen. Vom
August bis Dezember 1771
schloß sich, nach ein
paar Monaten Salzburger
Aufenthalts, sogleich
die zweite Fahrt ins
Land der Musik an.
Auf den italienischen
Reisen, bei denen Mutter
und Schwester zu Hause
bleiben mußten, beginnen
Mozarts eigenständige
Äußerungen über Welt und
Menschen. Er zeigt sich
sogleich als scharfer
Beobachter, wobei er die
Menschen - und nur
Menschen fesseln ihn -
mit dem Blick des
geborenen Dramatikers
mustert. Die
Schilderung, die der
Vierzehnjährige von
einem Bologneser Mönch
gibt, könnte bei
Rabelais stehen; jedes
Wort verrät den Schöpfer
des Osmin, des
Monostatos oder des
Leporello. Doch das
Problem der Oper ist ihm
noch nicht aufgegangen.
Seine Opernerstlinge
bewegen sich im
Zeitgeschmack. Vorab
kommt es darauf an, eine
„Scrittura” zu
empfangen, einen
Kompositionsauftrag,
ohne den sich damals
kaum ein
Theaterkomponist an die
Arbeit machte. Als
Vertragsoper für
‘Mailand entsteht der
„Mitridate, Rè di
Ponto“, der am zweiten
Weihnachtsfeiertag 1770
unter Wolfgang Amadés
Leitung uraufgeführt
wird. Die zweite
Auftragskomposition für
Mailand, anläßlich der
Hochzeit des
österreichischen
Erzherzogs Ferdinand mit
der Erbprinzessin Maria
Ricciarda von Modena,
ist die theatralische
Serenata „Ascanio in
Alba” vom Oktober 1771.
Die Hoffnung auf eine
Anstellung in Mailand
wird durch ein
abfälliges Schreiben der
Kaiserin Maria Theresia
zunichte gemacht. Sie
rechnete „le jeune
Salzburger” zu den
unnützen Leuten.
Mit Mozarts erster
italienischer Reise ist
viel Anekdotisches
verknüpft: die
Nachschrift des
berühmten Miserere von
Allegri aus dem
Gedächtnis, die
Ernennung zum Ritter vom
Goldenen Sporn durch den
Papst, die Ernennung zum
Maestro di Capella durch
die Philharmonischen
Gesellschaften von
Bologna und Verona, die
Begegnung mit Padre
Martini, dem Verfechter
des altmodischen
„Contrappunto
osservato”. Das große
Italien-Erlebnis besteht
für Mozart nicht aus den
Ehrungen, die ihm
überall zuteil werden,
sondern aus der
Begegnung mit dem
virtuos-brillanten,
unbedenklich
sensualistischen
Belkanto-Stil der
Italiener. In Salzburg
herrschte die
instrumentale Schulung,
in Italien regierte der
Gesang, in der Opern-
wie in der Kirchenmusik.
Sind die frühen
Salzburger Messen,
darunter die festliche
Dominicus-Messe von
1769, noch vorwiegend
sinfonisch konzipiert,
so suchen die
Kirchenkompositionen des
Italienreisenden, das
für Padua geschriebene
Oratorium „La Betulia
liberata“ und ähnliche
Auftragsarbeiten die
Verbindung von kantablem
und sinfonischem Stil.
Ein Leitmotiv von
Mozarts ganzem Schaffen
klingt auf: die
Verknüpfung von
italienischem Cantabile
und deutscher Sinfonik.
Als Frucht der drei
Italienreisen - die
dritte fiel in den
Winter 1772/73 und
brachte gleichfalls
keine dauerhafte Bindung
ein - entwickelte sich
der Salzburger
Serenadenstil des
Jünglings, die
Verbindung von
südländischem
Sensualismus,
deutschsinfonischem
Ernst und gefälligem
Divertissement-Charakter.
In der Geburtsstadt
hatte sich mittlerweile
das Bild gewandelt. Der
gutmütige, greise
Fürsterzbischof von
Schrattenbach hatte das
Zeitliche gesegnet. Sein
Nachfolger wurde Graf
Colloredo, der
nüchtern-kühle,
rationalistisch und
aufklärerisch gesinnte
Sohn des Wiener
Reichsvizekanzlers, den
Salzburgern gründlich
verhaßt wegen seiner
Neigung zu
josephinischen Reformen,
knappem Kalkulieren und
wenig leutseligem:
Regieren. Colloredo, auf
Sparsamkeit bedacht,
schränkte die Urlaube
seiner Musikbeamten
fühlbar ein; der
Vizekapellmeister
Leopold Mozart und
dessen Sohn, der
Konzertmeister Wolfgang
Amadé,. hatten als
Musikbedienstete
vornehmlich dem
Salzburger Hofe zur
Verfügung zu stehen. Mit
den Mozarts ließ sich
Eindruck auf adelige
Gäste machen; im übrigen
beachtete man sie kaum,
denn der Fürsterzbischof
war stockunmusikalisch.
Die Urlaubsforderungen
Mozarts führten später
den Bruch mit Colloredo
herauf, keineswegs aber
jene Despotenwillkür,
die dem einsamen, freud-
und freundlosen
Kirchenfürsten zu
unrecht nachgesagt wird.
Mit dem Sommer 1773
begann Mozarts
eigentliche Salzburger
Zeit: das
Cherubino-Stadium seiner
Musik vor der Kulisse
eines im wesentlichen
provinziellen,
feudalistisch
geordneten, stark
ländlich beeinflußten,
geistlich regierten
Kleinstaats.
KARL
SCHUMANN
Divertimento ·
Serenade · Cassation
„Gestern machten
wir eine starke Musik bei Herrn
von Mayer” berichtet Leopold
Mozart am 24. November 1771 aus
Mailand nach Salzburg. Aller
Wahrscheinlichkeit nach hat bei
dieser Soirée das
Es-dur-Divertimento KV 113 seine
Uraufführung erlebt. Wenige Tage
nachher traten die Mozarts ihre
Rückreise nach Salzburg an. Das
Autograph trägt die Überschrift
„Concerto ò sia Divertimento à 8
(stromenti) del Sgr. Cavaliere
Amadeo Wolfgango Mozart in
Milano nel Mese Novemb. 1771”.
Das kleine Werk beschäftigte
ursprünglich zu den Streichern
nur 2 Klarinetten und 2 Hörner.
Später, hat Mozart noch je ein
Paar Oboen, Englischhörner und
Fagotte hinzugefügt, so daß die
Möglichkeit bestand, das
Divertimento auch in Salzburg
aufzuführen, wo es keine
Klarinetten in der Hofmusik gab.
Damals in Mailand aber bot sich
dem jungen Mozart die erste
Gelegenheit, Klarinetten in
einer eigenen Komposition
anzuwenden. Die neuartige
Kombination der Instrumente, die
der junge Künstler geschickt
verwendet, gibt eine nur diesem
Stück eigene aparte
Klangwirkung. Das Wort
„Concerto“ in der Überschrift
weist auf solistische Verwendung
einzelner Instrumente hin.
Tatsächlich treten diese hier,
fast nach älterem Herkommen,
deutlich gesondert aus dem Pleno
hervor; nicht allein die Bläser,
sondern stellenweise auch die
Geigen, die Bratsche und der
Baß. Form und Geist des Werks
sind freilich durchaus
zeitgerecht. Seinem Charakter,
seiner Klangfreudigkeit nach
dürfen wir es als eine echte
Freiluftmusik ansehen,
vielleicht uns den hübschen Hof
oder Garten dazu vorstellen, wo
es zuerst erklungen sein mag.
Auch in Salzburg wird Mozart
öfters damit Staat gemacht
haben. Durch seine Besetzung
(Bläser- und Streichergruppe)
bleibt es "durch ein gewisses
Vorwiegen der Bläser den
späteren Blä‚serdivertimenten
und Bläserserenaden Mozarts
nahe, während es der
aufgelockerte Streicherklang
doch wieder den motorisch
lebhafteren
Streicherdivertimenten annähert.
Auch in dieser Beziehung wahrt
das eigenartige Stück
Sonderstellung in der
Mozart-Literatur. Im Gegensatz
zum üblichen
Divertimentenbrauch fehlt
unserem „Concerto” das zweite
Menuett; es weist, wie die
Sinfonien vom „Wiener Typus”,
nur vier Sätze auf. Die
thematische Entwicklung aller
Sätze geschieht mit äußerster
Knappheit, aber völlig
ordnungsgemäß. Die Exposition
des ersten Satzes (Allegro, 4/4)
bringt in diesem Sinne
Hauptthema, Modulationspartie,
Seitenthema und Schlußgruppe
höchst anschaulich durch kluge
Abwechslung der motivisch
führenden Streichergruppe mit
der vorwiegend überleitenden
Bläsergruppe aufgegliedert. Die
kurze Durchführung (14 Takte!)
hat nur überleitenden Charakter.
Bei regelmäßiger Reprise bleibt
der ganze Satz ein
Musterbeispiel ökonomischer
Beherrschung der zu letzter
Verdichtung gebrachten Form
durch den jugendlichen Meister,
ohne den „unterhaltsamen“
Charakter eines Divertimentos
auch nur einen Augenblick aus
dem Auge zu verlieren. Im
„Andante“ (B-dur, 3/4)
dominieren die Klarinetten in
anmutig gefühlvollem
Wechselspiel mit den Streichern.
Jedem von beiden ist ein
Hauptgedanke zugeteilt. Der
zweite Teil des Satzes bringt
einen neuen melodiösen Einfall
an Stelle des ersten Themas.
Auch im zweiteiligen Menuett
(Es-dur, 3/4) dialogisieren
Streicher und Bläser: derb, ein
wenig aufstrampfend, während das
Trio (g-moll!) in zartem,
gefühlvollem Gegensatz zu jenem
anhebt. Das Finale (Allegro,
2/4) in Sonatenform, brillant
und beschwingt, der „modernste“
unter den vier Sätzen, mit
seiner winzigen Moll-Episode in
der Durchführung ein wenig an
das „französische Rondeau”
erinnernd, wie es Johann
Christian Bach damals gerne in
seinen Rondo-Sätzen angewendet
hat. Mozart kannte solche Sätze
von seiner Pariser Reise her.
Die D-dur-Serenade KV 100 gehört
zu einer in Salzburg viel
gepflegten Gattung, die man
„Finalmusik“ nannte. Man
verstand darunter eine
festliche, oft konzertante
Orchester-Musik in
Serenadenform, wenn sie zur
Schlußfeier der propädeutischen
Lehrgänge der Logiker und
Physiker an der Salzburger
Benediktinischen Universität
nach Abschluß der obligaten
Diputationen, Anfang oder Mitte
August, dortselbst dargeboten
wurde. Beide, Vater und Sohn
Mozart, haben mehrere Male einen
Auftrag zur Komposition einer
solchen Festmusik erhalten. Den
Aufführungstag unserer Serenade,
6. August 1769, wissen wir durch
eine freundliche lateinische
Eintragung im
Universitätsprotokoll: „Ad
noctem musica ab adulescentulo
lectissimo Wolfg. Mozart
composita“. Das Werk besteht aus
acht, vorwiegend knapp
gehaltenen Sätzen. An Stelle des
sonst bei solchen Serenaden
eingeschalteten dreisätzigen
„Concertinos“ für eine
Solovioline, folgt hier - nach
dem festlichen Einleitungssatz
(Allegro, 4/4) mit seinem
typischen aufstrebenden
Fanfarenthema, den üblichen
Passagen, dynamischen
Kontrasten, den unvermuteten
Fermaten und mit hübschen
Iyrischen Gegensätzen im sicher
hingestrichenen Pleine-air-Stil
einer italienischen
Theatersinfonia - ein kleines,
ebenfalls dreisätziges
Concertino für zwei Bläser, Oboe
und Horn: zuerst ein
stimmungsvolles Andante (2. Satz
D-dur, 3/4), das eine holde
Reihe ähnlicher, sanft bewegter
Mittelsätze im schwebenden
dreiteiligen Rhythmus bis zum
„Andante grazioso” der berühmten
„Posthorn-Serenade” (KV 320)
lächelnd eröffnet. Das
duettierende Spiel der beiden
Instrumente findet im Trio des
ersten Menuetts (3. Satz, G-dur)
eine schlichte Fortsetzung, um
zuletzt, brillanter, doch ein
wenig altväterlich, - nach Art
der damals fast schon
vergessenen „Concerti 'grossi‘
mit ihrem typischen Wechselspiel
des Pleno und der Sologruppe -
im 4. Satz (Allegro, 2/4) einen
freundlichen Ausklang zu finden.
Folgt als 5. Satz das zweite
Menuett (D-dur) mit Trio
(Streicher allein) in der
Unterdominante (G-dur). In dem
zarten, nokturnenhaften Andante
(6. Satz, A-dur, 2/4) tritt ein
Flötenpaar an Stelle der beiden
Oboen, nur von den sordinierten
Streichern begleitet, mit zarter
Bescheidenheit in den
Vordergrund. Ein drittes, recht
kräftiges Menuett (7. ‚Satz,
D-dur) wirkt durch ein seltsam
dunkles Moll-Trio apart und doch
sehr persönlich. Aber das Finale
(Allegro, 3/8) in klarer
Rondo-Form mit hübschen
Zwischenepisoden (zwei davon in
Moll) löst die Spannung zu
beschwingtem Abschluß.
Besetzung: Streicher, 2 Oboen,
nur im 6. Satz von 2 Flöten
abgelöst, 2 Hörner, 2 Trompeten.
Auch die G-dur-Cassation KV 63
hat der Knabe Mozart als
„Final-Musik“ bei einer
Universitätsfeier,
wahrscheinlich in unmittelbarer
Nähe der D-dur-Serenade KV 100,
nur zwei Tage nach dieser, am 8.
August 1769, zur ersten
Aufführung gebracht. Nach
studentischer Tradition verstand
man zu Salzburg unter
„Cassation” - abgeleitet von dem
Begriffe „gassatim (die Gassen
lang)-gehen” - eine Festmusik,
zu der die Studenten und Musiker
abends unter Fackelbegleitung,
mit Fahnen, Transparenten und
Blumen an den Ort zogen, wo der
oder die Gefeierten weilten.
Hier wurde nun Aufstellung
genommen und die Festmusik
begann. (Wir wissen aus der
Lebensgeschichte Johann
Sebastian Bachs von ähnlichen
Festmusiken zu Leipzig). Ein
formeller Unterschied zwischen
Cassation und Divertimento
besteht nicht. Die Besetzung
beider Gattungen ist etwas
kleiner als die der Serenaden.
In unserem Falle: Streicher, 2
Oboen und 2 Hörner. Ein etwas
bäuerlicher Marsch (2/4) leitet
das Werk ein, eben der Marsch,
bei dessen Klängen die Feiernden
in Hof oder Garten des
Gefeierten ein- und zum Schlusse
wieder fortzogen. Der erste
Allegro-Satz (4/4), auf einem
abstürzenden akkordischen,
sofort von den Bässen imitierten
Thema der Geigen aufgebaut,
entwickelt dieses Thema
geschickt in der markanten
Durchführung, ohne bei der
fröhlichen Motorik seines
Ablaufs zarteren Reflexionen
irgendwelchen Raum zu lassen.
Dafür findet der junge Meister
sofort in dem serenadenhaften
Andante (C-dur, 2/4), einem „da
capo-Stück“ erster Ordnung,
reichlich Gelegenheit: Geteilte
Violen und die Bässe begleiten,
durchwegs „pizzikato“ nach Art
eines Guitarrenensembles, die
immer leise spielenden,
sordinierten Geigen zu schönem,
langatmigen Melodisieren. Daß im
zweiten Teil des Satzes auch ein
typisch Glückscher Einfall
miteinbezogen wird, läßt auf
Wiener Erinnerungen schließen.
Das Menuett (G-dur) führt die
hohen und tiefen Streicher
geschickt in kanonischer Führung
gegeneinander: ein früher
Vorläufer des Menuetts in der
großen g-moll-Sinfonie (KV 550).
Das Trio (g-moll) bringt zu
jenem einen zarten, verträumten
Gegensatz. Ein Adagio (D-dur,
4/4) stellt eine konzertierende
Solo-Violine mit reichlich
figurierender Kantilene über den
gedämpft begleitenden
Streicherchor. Nehmen wir an,
daß der Knabe Mozart, damals
schon ein sehr geschickter
Geiger, dieses Stück bei der
Uraufführung selbst gespielt
hat. Auch im zweiten Menuett
kontrastiert das zarte Trio in
der Unterdominante (C-dur)
wirksam mit dem
holzschnittderben
Unisonogedanken des Hauptsatzes.
Das Finale (Allegro assai, 6/8)
in Rondo-form ist ein echtes
Jagdstück, eine „Caccia“, wie
sie schon der Vater, Leopold
Mozart, in seinen drastischen
Suiten gerne aufspielen ließ,
wie sie später der Sohn,
wesentlich gelöster, an den
Schluß seiner Hornkonzerte
gestellt hat.
BERNHARD PAUMGARTNER
(Columbia C 91 106)
|
|