 |
| 1 LP - C
91 103 - (p) 1961 |
 |
| 1 LP - 1
C 037-45 571 - (p) 1961 |
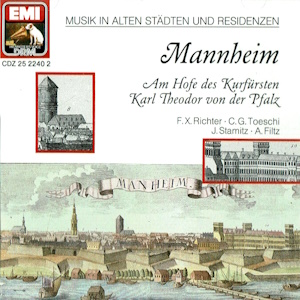 |
| 1 CD -
CDZ 25 2240 2 - (c) 1990 |
 |
| 1 CD - 9
28338 2 - (p) & (c) 2013 |
|
| MANNHEIM - Am
Hofe des Kurfürsten Karl Theodor von der
Pfalz |
|
|
|
|
|
| Johann Stamitz
(1717-1757) |
Orchester-Trio
C-dur op. 1 Nr. 1 - "Denkmäler
der Tonkunst in Bayern" 3,1;
herausgegeben von Hugo Riemann
|
|
A1
|
|
-
Allegro |
4' 14" |
|
|
-
Andante ma non Adagio |
3' 04" |
|
|
-
Menuet |
3' 14" |
|
|
-
Prestissimo |
2' 57" |
|
|
|
|
|
| Franz Xaver Richter
(1709-1789) |
Quartett
op. 5 Nr. IV Es-dur für 2
Violinen, Viola und Violoncello
- "Denkmäler
der Tonkunst in Bayern" 315;
herausgegeben von Hugo
Riemann |
|
A2
|
|
- Larghetto
|
7' 31" |
|
|
-
Allegro spirituoso
|
4' 51" |
|
|
-
Tempo di Minuetto |
2' 53" |
|
|
|
|
|
| Carlo Giuseppe Toëschi
(1724-1788) |
Konzert für
Violine und Orchester D-dur -
Nach Manuskript herausgegeben von
Robert Münster
|
|
B1
|
|
- Allegro moderato |
8' 16" |
|
|
-
Allegro moderato |
3' 18" |
|
|
|
|
|
| Anton Filtz
(1730-1760) |
Sinfonia
a 8 "Sinfonie périodique" Nr. 2
- "Denkmäler
der Tonkunst in
Bayern" 315;
herausgegeben von
Hugo Riemann |
|
B2
|
|
-
Allegro |
4' 46" |
|
|
-
Andante |
3' 38" |
|
|
-
Menuett |
2' 49" |
|
|
-
Presto |
3' 08" |
|
|
|
|
| Drolc-Quartett
(Richter) |
Kammerorchester des
Saarlandischen Rundfunks
|
|
- Eduard Drolc, Violine
I
|
Karl Ristenpart,
Leitung (Stamitz, Toëschi, Filtz)
|
|
| - Heinz Böttger, Violine
II |
|
|
| - Siegbert Ueberschaer,
Viola |
|
|
| - Heinrich Majowski, Violoncello |
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Städtischer
Saalbau, Saarlouis (Germania) -
gennaio & febbraio 1961 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Fritz
Ganss / Christfried Bickenbach /
Horst Lindner |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- C 91 103 - (1 LP) - durata 55'
19" - (p) 1961 - Analogico |
|
|
Altre edizioni
LP
|
|
EMI
Reflexe - 1 C 037-45 571 - (1 LP)
- durata 55' 19" - (p) 1961 -
Analogico |
|
|
Edizioni CD |
|
EMI Electrola -
CDZ 25 2240 2 - (1 CD) - durata
55' 19" - (c) 1990 - ADD
EMI Music - 9 28338 2 - (1 CD) -
durata 55' 19" - (p) & (c)
2013 - ADD |
|
|
Cover |
|
Stich
von J. F. Probst nach einer
Zeichnung von J. B. Werner
(Detail)
|
|
|
|
|
Das
Mannheimer Orchester
Die Entwicklung der
Orchestertechnik im 18.
Jahrhundert vor der
Wiener Klassik ist eng
mit Johann Stamitz und
der Mannheimer Schule
verbunden. Das
vorklassische Orchester
Mannheims kennt im
Grunde kaum Instrumente,
die nicht schon nach
1700 im Orchester
verwendet worden waren.
Aber im
Besetzungsverhältnis hat
sich das im Spätbarock
übliche starke
Übergewicht der Bläser
zugunsten der Streicher
verschoben, welche nun
die Grundlage des
Klangkörpers sind. Zu
ihnen treten - fast
stets paarweise - in der
Regel zwei Oboen oder
Flöten, bzw. die von
Stamitz geschätzten
Klarinetten. Im
Gegensatz zur früheren
Verdopplungspraxis, bei
der die Holzbläser
häufig den Part der
Streicher mitzuspielen
hatten, erhalten sie nun
ihren selbständigen
Part. Dazu gesellt sich
ein Hörnerpaar, dessen
Aufgabe im wesentlichen
die Verstärkung der
Klangfülle ist. Die
Hörner bestimmen das
neue Klangbild
entscheidend und bilden
mit ihren langgehaltenen
Tönen gleichsam das
Pedal des Orchesters.
Ihre Aufnahme ins
Orchester ist zuerst in
Paris und Böhmen
nachweisbar (wie in
vielen Orchestern waren
auch in der Mannheimer
Hofkapelle die Hornisten
böhmische Emigranten).
Während im
Holzbläsereinsatz
anfangs vielfach die
Wahl zwischen Flöten,
Oboen oder Klarinetten
freigestellt war, ist
vor allem seit den
sechziger Jahren mehr
und mehr eine
Berücksichtigung der
speziellen Natur und
Eigenart jedes
Blasinstrumentes
feststellbar. Mit der
fortschreitenden
Differenzierung treten
schließlich die Bläser
stärker in den
Vordergrund. Neben einem
zweiten hohen
Holzbläserpaar finden
nun auch Fagotte und
Trompeten mit Pauken
Verwendung. Die
achtstimmige Besetzung
(2 Ob. [Fl., Klar.], 2
Hr., Str.) bleibt jedoch
bis zum Ende der
Mannheimer Musikblüte
(1778) die Regel.
Das klangliche Moment
des neuen
Orchesterstiles ist von
primärer Bedeutung. Nach
den kunstvollen Werken
des Spätbarocks (Bach)
findet Rousseaus Ruf
„Zurück zur Naturl“ in
der Musik eine
Parallele. Den in großer
Zahl entstehenden
Sinfonien, Konzerten und
Kammermusikwerken liegen
meist einfachste
harmonische Verhältnisse
zugrunde, und nicht
zuletzt daraus
resultiert die
natürliche Frische ihrer
Wirkung. An die Stelle
der komplizierten
Kontrapunktik des
barocken Stimmengewebes
tritt eine schlichte,
homophone und kantable
Schreibart. Alle Stimmen
werden einer
melodieführenden
Oberstimme
untergeordnet. Die
mangelnde Ausgestaltung
der Mittelstimmen macht
in den frühen Mannheimer
Werken noch die
Mitwirkung des
Generalbaßinstrumentes
notwendig. Erst mit
deren Verselbständigung
und mit der Erweiterung
der Bläserbesetzung wird
das Begleit-cembalo
überflüssig.
Johann Stamitz formte
aus den durch Kurfürst
Karl Theodor von weither
verpflichteten Virtuosen
und den verbliebenen
Musikern des alten
Hoforchesters einen
Klangkörper, dessen
Spieldisziplin kaum
seinesgleichen hatte.
Als hervorragender
Geiger unterzog er vor
allem die Streicher
einer gründlichen
Schulung. Der
einheitliche
Bogenstrich, der präzise
und ausdrucksvolle
Vortrag wurden zu einer
Selbstverständlichkeit.
Stamitz' Nachfolger, der
in Mannheim geborene
Geiger und Komponist
Christian Cannabich, war
ebenfalls ein
vorzüglicher
Orchestererzieher. Der
englische
Musikschriftsteller
Charles Burney urteilte
im Sommer 1772: „Ich
fand wirklich alles
daran, was mich der
allgemeine Ruf hatte
erwarten lassen.
Natürlicher Weise hat
ein stark besetztes
Orchester große Kraft.
Die bey jeder
Gelegenheit richtige
Anwendung dieser Kraft
aber muß die Folge einer
guten Disciplin seyn. Es
sind wirklich mehr
Solospieler und gute
Komponisten in diesem,
als vielleicht in irgend
einem Orchester in
Europa. Es ist eine
Armee von Generälen,
gleich geschickt einen
Plan zu einer Schlacht
zu entwerfen, als darin
zu fechten.“
Mannheim wurde zur Wiege
der klassischen
Orchestertechnik. „Hier
ist der Geburtsort des
Crescendo und
Diminuendo, und hier war
es, wo man bemerkte, daß
das Piano sowohl als das
Forte musikalische
Farben sind, die so gut
ihre Schattierungen
haben, als Roth und Blau
in der Mahlerey.“ Wenn
auch die Crescendomanier
schon etwas früher in
Italien bekannt gewesen
zu sein scheint, so
führte doch Stamitz sie
endgültig ein, und sie
wurde bald zu einem
Charakteristikum der
Mannheimer Sinfonien. In
der Musik des
Spätbarocks war die
Übergangsdynamik noch
nicht verwendet worden,
dort herrschte die
Terrassendynamik mit
ihrer strengen Scheidung
der verschiedenen
Tonstärkegrade. Das
Orescendo war also eine
unerhörte Neuerung, und
das Anschwellen der
Klangfülle vom
Pianissimo zum
Fortissimo muß auf die
damaligen Hörer eine
heute kaum vorstellbare
Faszination ausgeübt
haben.
Die Direktion des
Manheimer Orchesters
erfolgte nicht, wie
damals weitgehend
üblich, vom
Cembalo aus; hier war
bei
Instrumentalkonzerten
der Orchesterleiter
gleichzeitig erster
Konzertmeister und
dirigierte mit seiner
Geige aus der ersten
Violinstimme. Von
Cannabich wird
berichtet: „Er hat eine
ganz neue Bogenlenkung
erfunden und besitzt die
Gabe, mit dem bloßen
Nicken des Kopfes und
Zucken des Ellenbogens
das größte Orchester in
Ordnung zu halten“
(Schubart). Auch Joseph
Haydn pflegte in
Esterhàz so zu
dirigieren. Partituren
wurden für Aufführungen
von Instrumentalwerken
damals nicht verwendet.
Die Besetzung des
Mannheimer Orchesters
war verhältnismäßig
groß. 1756, im
Geburtsjahr Mozarts,
standen 20 Geiger, 4
Bratschisten, 4
Violoncellisten, 2
Kontrabassisten, 2
Flötisten, 2 Oboisten, 2
Fagottisten und 4
Hornisten zur Verfügung.
Außerdem standen noch 12
Hoftrompeter und 2
Pauker bereit. Das
Hoforchester des
Kurfürsten Karl Theodor
gehörte damit neben den
Orchestern in Paris,
Mailand und Neapel zu
den größten Europas.
Sein Ruhm reichte über
die Auflösung hinweg bis
in das 19. Jahrhundert
hinein.
Robert
Münster
Das Paradies der
Tonkünstler im 18.
Jahrhundert
JOHANN WENZEL ANTON
STAMlTZ wurde am 19.
Juni 1717 als Sohn eines
Kantors in dem
böhmischen Städtchen
Deutschbrod geboren.
Über seine Jugend- und
Lehrjahre fehlt jede
Nachricht. Am 29. Juni
1742 treffen wir ihn in
Frankfurt am Main, wo er
als „berühmter Virtuose“
auf verschiedenen
Instrumenten ein Konzert
veranstaltete. Sehr
wahrscheinlich war
Stamitz schon im.
Jahrzuvor in Mannheimer
Dienste getreten, wo ihm
der Kurfürst Karl
Theodor bald nach seinem
Regierungsantritt die
Leitung der gesamten
Hofmusik übertrug, die
im Winter in Mannheim
und im Sommer im
Parkschloß zu
Schwetzingen erklang.
1750 erhielt er den
Titel eines
Instrumentaldirektors
und 1754/55 wurde ihm
für einen Aufenthalt in
Paris ein einjähriger
Urlaub gewährt. Am 27.
März 1757 starb Stamitz
in Mannheim.
War Stamitz als
Komponist hauptsächlich
mit Instrumentalwerken
hervorgetreten, so hatte
FRANZ XAVER RICHTER, der
Senior unter den
Komponisten der
Mannheimer Schule, neben
Ignaz Holzbauer auch
noch die Musik für die
Kirche zu schreiben.
Erwurde am 1. Dezember
1709 in Holleschau in
Mähren geboren,
studierte wahrscheinlich
in Wien bei dem
Kontrapunktmeister
Johann Josef Fux und
trat nach kürzerem
Aufenthalt in Italien
1740 als
Vicekapellmeister in den
Dienst des Fürstabtes
Anselm von
Reichlin-Meldegg zu
Kempten. Nach dessen Tod
ging Richter 1747 an den
Hof zu Mannheim, wo er
bis 1768 als Baßsängcr,
Geiger. Musiklehrer und
Kammerkomponist wirkte.
Von 1769 bis zu seinem
Tod am 12. September
1789 leitete er als
Kapellmeister die Musik
am Straßburger Münster.
CARLO GIUSEPPE TOESCHI,
einer der wenigen
Musiker italienischer
Herkuntt im pfalzischen
Hoforchester, entstammte
einer angesehenen
italienischen
Adelsfamilie. Sein Vater
war schon vor dem
Regierungsantritt Karl
Theodors in Mannheim als
Konzertmeister
angestellt. Toësohis
Geburtsort und
Geburtstag sind nicht
überliefert; er soll
1724 in Italien geboren
sein, doch manches
spricht dafür, daß er
erst 1732,
möglicherweise in
Ludwigsburg, zur Welt
kam. 1752 trat er als
Geiger in das Mannheimer
Hoforchester ein und
stieg bis zum
stellvertretenden
Orchesterleiter auf.
Seit 1774 war er als
Kabinetts-musikdirektor
zugleich auch für die
Kammermusik beim
Kurfürsten
verantwortlich. Toëschi
starb am 12. April 1788
in München.
Über die Herkunft von
ANTON FILTZ besteht bis
heute noch keine
Gewißheit.
Wahrscheinlich war er
wie Stamitz aus Böhmen
gekommen, als er am 15.
Mai 1754 als
Violoncellist in das
kurfürstliche Orchester
aufgenommen wurde. Filtz
heiratete in Mannheim
und konnte sich 1759 ein
eigenes Wohnhaus kaufen.
Aber schon im Mai des
folgenden Jahres
verstarb er im Alter von
erst 30 Jahren.
R. M.
Johann Stamitz
Orchester-Trio C-dur
op.1 Nr.1
Johann Stamitz gilt als
der Begründer der
sogenannten Mannheimer
Schule. (Diese
Bezeichnung wird heute
hauptsachlich für die
von ihm maßgeblich
beeinflußte Mannheimer
Komponistengruppe
angewendet,
kennzeichnete aber
ursprünglich die
Mannheimer Violinschule,
aus der eine Reihe
angesehener Geiger
hervorgegangen sind.)
Was Stamitz als
Komponist an neuen
Errungenschaften
gebracht hat, zeigt sich
in konzentrierter Form
in seinen 6
Orchester-Trios für 2
Violinen, Violoncello
und Basso continuo, die
um 1755 in Paris als Six
Sonates à trois
parties concertantes
im Druck erschienen sind
und dann mehrere
Neuauflagen und
Nachdrucke erlebten.
Hier finden wir die
Abkehr vom gebundenen
Stil und das neue
Naturgefühl in der
harmonisch-homophonen
Schreibart, ferner die
der barocken Musik
fremde motivische und
dynamische
Kontrastierung auf
engstem Raum, die
strenge Periodenbildung
in der Thematik, die
Ausbildung des kantablen
zweiten Themas und die
Einbeziehung des
Menuetts an dritter
Stelle in die
viersätzige Großform.
Stamitz stellte für
seine Trios nach
Belieben die solistische
oder die orchestrale
Interpretation frei. Die
Orchesterwiedergabe der
zwischen Triosonate und
Sinfonie stehenden
Kompositionen ist
zweifellos die
effektvollere. Die
Orchester-Trios von
1755, nach Hugo Riemanns
Vermutung möglicherweise
angeregt durch die 1746
erschienenen Triosonaten
von Christoph Willibald
Gluck, übten ihrerseits
starken Einfluß auf das
zeitgenössische Schaffen
aus. Christian Cannabich
schrieb unter ihrem
Eindruck seine 6
Orchestertrios op. 3.
Gleich der erste
Satz (Allegro)
des ersten Trios (op. 1
Nr. 1), eingeleitet
durch ein energisches
Unisono, zeigt in der
motivischen
Durcharbeitung eine
Sorgfalt, die bei den
späteren Mannheimern
nicht mehr zu finden
ist. Das zweitaktige
Kopfmotiv kehrt im
Verlauf des Satzes
mehrfach im Baß wieder
und erscheint- ebenso
wie das anmutige,
einschmeichelnde
Seitenthema - auch im
durchführungsartigen
Mittelteil. Auffallend
in diesem wie auch im
zweiten Satz sind die
überraschenden
dynamischen Kontraste
innerhalb kurzer
Melodieabschnitte, die
als „Stamitz'sche
Umschlagtechnik“ zu den
Charakteristika der
Mannheimer Schule
gehören. - Die feine
Abtönung des Ausdrucks
im Andante ma non
Adagio und dessen
Noblesse hat schon
Riemann hervorgehoben.
Der Satz hat in seiner
orginellen Rhythmik und
Faktur das Vorbild für
langsame Sinfoniesatze
von C. G. Toëschi (Sinfonie
D-dur, um 1770),
Niccolo Jommelli
(Sinfonia zu „Ifigenia",
1770) und Mozart (Sinfonie
KV 112, 1771)
abgegeben. - Der dritte
Satz ist ein Menuett
in der für Stamitz so
bezeichnenden
herzhaft-bodenständigen
Art. Das liio in c-moll
steht mit seiner mehr
gesanglichen
Melodietührung dazu in
wirkungsvollem
Gegensatz. - Das
abschließende
mitreißende Prestissimo
ist der am meisten
orchestermäßig
gestaltete Satz des
Werkes. Hier erscheint
das in der Mannheimer
Sinfonie so beliebte
rauschende
Streichertremolo, dessen
sich auch Anton Filtz
gerne bediente.
Ungewöhnlich ist der
Mollabschnitt im
Seitenthema, der auf
italienische Vorbilder
verweist. Durch
verschiedene
imitatorische Einsätze
sucht Stamitz den
Streichersatz zu beleben
und aufzulockern. Der
Mittelteil trägt wieder
deutlich
durchführungsartige Züge
und weist damit schon
auf die Wiener Klassik
voraus, in der die Kunst
der thematischen
Verarbeitung einen
Höhepunkt erreichen
sollte.
Franz Xaver Richter
Quartett oD.5 Nr. lV
Es-dur
Franz Xaver Richters Streichquartette
op. 5 erschienen
im Januar 1774 in Paris.
Eine Londoner Ausgabe
ist wahrscheinlich schon
früher - zwischen 1767
und 1771 -
veröffentlicht worden.
Richter schreibt hier
echten Kammermusikstil,
in dem keine der vier
Stimmen benachteiligt
wird. Eine chorische
Interpretation wäre
nicht denkbar. Jedes
Instrument tritt
solistisch hervor, das
Violoncello macht dabei
keine Ausnahme; seine
Solopassagen zeigen, daß
an eine Mitwirkung des
Cembalos nicht mehr
gedacht ist. Richter
verstand es, in der
Vereinigung barocker
Stilelemente mit den von
Johann Stamitz
übernommenen formalen,
motivischen und
dynamischen Neuerungen
zu einer durchaus
persönlich gefärbten
Musiksprache zu
gelangen. In der soliden
Schreibart äußert sich
die für seine Werke
charakteristische
Satzkunst. Das Streichquartett
op. 5 Nr. IV kann
als ein gutes Beispiel
für Richters reifen
Mannheimer Stil gelten.
In seiner vom üblichen
Schema abweichenden
Satzfolge ist noch eine
formale Reminiszenz an
die barocke
Kirchensonate
festzustellen.
Das einleitende Larghetto
zeigt reiche Abwechslung
in der Behandlung der
vier Instrumente und
Farbigkeit in der
melodischen und
harmonischen Gestaltung.
Die über weite Strecken
beibehaltene
Triolenbewegung setzt
bereits zwei Takte vor
dem Anfangsthema ein.
Beim zweiten Thema tritt
das Violoncello
solistisch hervor.
Richter berniiht sich
durch ständigen Wechsel
in der Melodietührung um
eine abwechslungsreiche
Gestaltung des Satzes. -
Das Hauptthema des
folgenden Allegro
spirituoso besitzt
die Richters späten
Instrumentalwerken
eigene weiche,
gesangvolle Melodik. -
Wie häufig, so schließt
der Komponist auch
dieses Werk nach
Mailänder Vorbild mit
einem Tempo di
Minuetto ab. Im
Vergleich zu Stamitz und
Filtz fällt die
Kantabilität der
Stimmführung auf. Das
ausdrucksvolle Trio in
der Paralleltonart
c-moll wird durch ein
chromatisches
Seufzermotiv beherrscht
und erhält dadurch
eigenes Gepräge.
C. G. Toeschi Konzert
für Violine und
Orchester D-dur
Carlo Giuseppe Toëschi,
der bei Johann Stamitz
Geigenspiel und
Komposition studiert
hatte, war, einer
zeitgenössischen
Nachricht zufolge, „bis
in sein 22tes Jahr ein
sehr geschickter
Concert-Geiger und
spielte sonderlich die
Adagio und das Cantabile
sehr gut“.
Seine Violinkonzerte
scheinen ihrer
technischen
Schwierigkeiten wegen
von den Geigern
gefürchtet gewesen zu
sein. Galten schon die
Konzerte von Johann
Stamitz als ein „nec
plus ultra der
Schwierigkeiten“, so
bemerkte J. A. Hiller,
daß nicht jeder Musikus
die Geschicklichkeit
besitze, „seine
delikaten Aufsätze gut
zu spielen“. Von den
mindestens elf
Violinkonzerten, die
Toëschi in Mannheim
geschrieben hat, konnte
bisher nur eines
gefunden werden. In
diesem Werk, das wohl um
1760 entstanden ist,
wird die Solovioline
durch zwei Hörner und
Streichorchester
begleitet. Auffallend
ist die durch das Fehlen
eines langsamen
Mittelsatzes bedingte
Zweisätzigkeit, die
jedoch in Mannheimer
Konzerten und
Kammermusikwerken nicht
allzu selten ist. Auch
in französischen Werken
der Zeit ist diese Form
üblich.
Infolge der engen
kulturellen Beziehungen
zwischen Mannheim und
Paris nimmt es nicht
wunder, daß auch in
musikalischer Hinsicht
deutliche
Wechselbeziehungen
bestanden. So deutet
auch das rnarschartige'
Hauptthema des ersten
Satzes auf französischen
Einschlag. Der Satz
bietet dem Solisten
dankbare Aufgaben; seine
Solokadenz ist in
originaler Form
überliefert, ein
seltener Fall unter den
Mannheimer Konzerten. -
Der zweite Satz, mit der
gleichen
Tempobezeichnung
versehen, besitzt schon
durch den 3/8-Takt
leichteren und
beschwingteren
Charakter. Wie im ersten
Satz sind die
Solopassagen großenteils
nur von den Violinen
begleitet. Die Hörner,
deren Behandlung das
übliche Maß der
spieltechnischen
Anforderung auffallend
übersteigt, treten vor
allem im Tutti in
Erscheinung. Im ganzen
zeigt Toëschis Konzert
wenige typisch
Mannheimerische
Stilmerkmale. Deutlich
ist noch das Vorbild
Vivaldis spürbar, das
vor allem in den Werken
des Vaters, Alessandro
Toëschis, klar
durchschien.
Anton Filtz Sinfonie
périodique Nr. 2
Dem früh verstorbenen
Anton Filtz war es nicht
vergönnt, die enorme
Beliebtheit seiner
Sinfonien seit dem
Anfang der sechziger
Jahre des 18.
Jahrhunderts noch zu
erleben. Die meisten
seiner Werke erlangten
erst nach seinem Tode
weitere Verbreitung.
Auch die Sinfonie
A-dur für 2 Flöten, 2
Hörner und Streicher
erschien erst zwei
Monate nach seinem Tode
bei einem Pariser
verleger. In welchem
Ansehen Filtz noch um
1785 stand, zeigen die
überschwenglichen Worte,
die ihm der schwäbische
Dichter und Musiker
Christian Friedrich
Daniel Schubart widmete:
„Ich halte ihn für den
besten
Sinfonienschreiber, der
jemals gelebt, Pracht,
Volltönigkeit,
mächtiges,
allerschütterndes
Rauschen und Toben der
Harmonietluth; Neuheit
in den Einfällen und
Wendungen; sein
unnachahmliches Pomposo,
seine überraschenden
Andantes, seine
einschmeichelnden
Menuette und Trios, und
endlich seine
geflügelten laut
aufjauchzenden Prestos -
haben ihm bis diese
Stunde die allgemeine
Bewunderung nicht rauben
können.“
Das erste Allegro
seiner A-dur-Sinfonie
beginnt sofort mit einem
echt Mannheimerischen
Crescendo, das nach
einem plötzlich
eintretenden Piano
wiederholt wird. Die
hierbei auftretende
„Bebungsfigur“ ist in
den Mannheimer
Sinfonien, ebenso wie
das Motiv des
Doppelschlages, bis ca.
1770 recht häufig zu
finden. Im weiteren
Verlauf des Satzes fällt
der auf Stamitz
zurückgehende mehrfache
abrupte Wechsel von
Forte und Piano auf. Das
Kontrastthema ist den
Flöten übertragen, die
auch den Mittelteil mit
der.Crescendo-periode
einleiten. -Im
schlichten Andante,
dessen Melodik wieder
durch dynamische
Kontraste belebt wird,
schweigen die Hörner. -
Das Menuett
atmet Frische und
Ursprünglichkeit.
Außergewöhnlich ist, daß
in diesem Satz nur eine
Flöte verwendet wird,
die im Trio die Melodie
führt. Der zweite Teil
des Trios enthält ein
Beispiel der für Filtz
bezeichnenden
unregelmäßigen
Periodenbildungen (6 + 5
Takte), die auf seine
böhmische Herkunft
deuten. - Im
abschließenden Presto
wird die Thematik
großenteils aus
Dreiklangstufen
gebildet. Wie im ersten
Satz, so spielt auch
hier in den
Forte-Abschnitten der
Doppelschlag eine
wesentliche Rolle. Die
leichtgewichtigen
Trommelbässe
unterstreichen die
Lebendigkeit des Satzes,
dessen in Vergleich zu
Johann Stamitz und
Richter geringe
satztechnische
Durchbildung durch
feuriges, echt
böhmisches Musikantentum
aufgewogen wird.
Robert
Münster
„Kein Orchester in der
Welt hat es je dem
Mannheimer zuvorgetan.
Sein Forte ist ein
Donner, sein Crescendo
ein Katarakt, sein
Diminuendo ein in die
Ferne hinplätschernder
Krystallfluß, sein Piano
ein Frühlingshauch. Die
blasenden Instrumente
sind alle so angebracht,
wie sie angebracht sein
sollen: sie heben und
tragen oder füllen und
beseelen den Sturm der
Geigen.“ (Christian
Friedrich Daniel
Schubart)
„Bey unserer Ankunft in
Mannheim waren schon
viele Familien zu dem
Hoflager des Churfürsten
nach München abgegangen.
Mannheim war anfangs
noch sehr lebhaft; und
da die Fremden noch in
der vieljährigen
Gewohnheit waren, diese
glänzende Residenz zu
besuchen, die
benachbarten Fürsten
theils noch Wohnungen
dort hatten, oder doch
oft hinkamen, so gab es
Tage, besonders bey
Anwesenheit des
Churfürsten, wo die
Stadt ein sehr
fröhliches und sogar
noch ein prächtiges
Ansehen hatte. Allein da
nach und nach immer
mehrere Familien nach
München ziehen mußten,
so verlor sich alles
dieses merklich. Gegen
Anfang des Jahres 1781
war es auffallend leer
geworden. Eine sichtbare
Freudenlosigkeit war
über die Stadt
verbreitet; viele
Gewerbe des Luxus
standen still, mehrere
gingen ein. Es
verbreitete sich ein
Geist des Kleinmuths,
der Kleinlichkeit,
welcher gegen alle
Lebensfreude strebte. “
(August Wilhelm
Iffland)
„...
die
churfürstliche Hofmusik
ist immer mit
trefflichen Köpfen
besetzt gewesen. Der
vorige Churfürst war so
enthusiasmiert für die
Musik, daß er sich jeden
Morgen durch einen
sogenannten
musikalischen
Morgensegen wecken ließ;
ein Abendgesang, mit
unaussprechlicher
Rührung angestimmt,
wiegte ihn in Schlummer.
Nicht leicht hat ein
Großer die Musik so in
sein Leben verwebt, wie
dieser. Musik weckt ihn,
Musik begleitet ihn zur
Tafel, Musik erscholl
auf seinen Jagden; Musik
beflügelte seine Andacht
in der Kirche; Musik
wiegte ihn in
balsamischen Schlummer,
und - Musik hat diesen
wahrhaft guten Fürsten
gewiß im Himmel
bewillkommt.“ (Christian
Friedrich Daniel
Schubart in "In
ideen zu einer Ästhetik
der Tonkunst“)
„Nun Muß ich von der
hiesigen Musick reden.
Ich war sammstag am
allerheiligen Tag in der
Kapelle in Hochammt. Das
orchestre ist sehr gut
und starck. auf jeder
Seite 10 bis 11 violin,
4 bratschn, 2 oboe, 2
flauti und 2 Clarinettí,
2 Corni, 4 violoncelle,
4 fagotti und 4
Contrabaßi und
trompetten und Paucken.
es läßt sich eine schöne
Musick machen..." (Wolfgang
Amadeus Mozart -
4. November 1777)
„Karl Theodors Hof war
damals wohl der
glänzendste in
Deutschland. Feste
folgten auf Feste, und
der dabei entwickelte
gute Geschmack verlieh
ihnen immer neue Reize.
Jagden, die Oper, das
französische Schauspiel,
Musikaufführungen durch
die besten Virtuosen
Europas, alles dies
machte die kurfürstliche
Residenz zum
angenehmsten Aufenthalt
für jeden Fremden von
Ruf und Ansehen, der
hier auf die herzlichste
und schmeichelhafteste
Aufnahme rechnen
konnte.“ (Cosmas
Collini)
„Ich fühle nun auch
dabey den großen
Verlust, welchen ich
durch meine Entfernung
von Mannheim, an
Vergnügen des Geistes
erlitten habe. Denken
Sie sich, meine Liebe!
was für schöne Künste -
für Naturgeschichte -
schöne Gegenden - und
Wissenschaften, welche
in Mannheim vereint sich
zeigen, die Gegend
dieser Stadt hat alles,
was man von einer mit
zwey Flüssen
durchströmten Fläche
wünschen kann - das nahe
Heidelberg, jeden Reiz
schöner fruchtbarer
Gebirge - da zeigt das
Residenzschloß alte
Fürstenpracht, auf
Felsen gegründet, und
Bauart alter großer Zeit
- in Mannheim den Stolz
und Reichtum der neuen
in der Ebene, am Ufer
des prächtigen Flusses
unsers Vaterlands - in
den Vestungswerken,
Meisterstücke der
Vertheidigungskunst - in
den Ruinen von
Heidelberg sieht man das
Bild der ungerechten
Wuth des Krieges - in
Mannheim allen Reichthum
und Schönheit der Künste
des Friedens, zwischen
beyden Städten und zu
Schwezingen jeden
Beweis, was Gartenkunst
und fleißiger Feldbau
vermag - in der Residenz
- der Capelle - dem
Opernhaus - der
Bibliothek, dem
Naturalienkabínett, und
der Gemäldesammlung,
alles was Baukunst und
Verzierungsgeist - was
die Gelehrsamkeit so
vieler Jahrhunderte -
was die göttliche
Schöpfung der Erde an
Wunderwerken gab, und
was die nachahmende
Malerkunst hervorbringen
konnte, wie der
Antiquensaal, die hohe
Vollkommenheit der
Meisterstücke alter
Zeiten in sich faßt -
und die Sternwarte zu
der Kenntniß der größten
Geschöpfe leitet - die
Musik - der Ab- und
Zufluß von Fremden,
gewähren, durch die
vortrefflichen
Tonkünstler das feinste
Vergnügen, und dem Hot
die Kenntniß der
Begebenheiten in Reichen
und Staaten, die
Academie der
Wissenschaften, die
viele Gelehrte und
blühende Buchhandlungen,
geben immer einen
Überblick des Gebiets
der schönen
Wissenschaften - das
Theater, der Charakter,
und das Betragen der
Einwohner von allen
Klassen - die
verfeinerte Sitten -
schöne Wahl, in
Verzierung der Häuser
und Kleidung, vergnügen
und bereichern den
Geschmack - Setzen Sie
die Nähe von Strasburg
hinzu, woher alles
artige Neue der
Phantasie jeder Mode
zufließt - so werden Sie
finden, daß ich viel
verlohr.“ (Sophie von
La Roche, 1790)
„Auf dem Observatorium
hat man die Aussicht bis
nach Straßburg und bis
hinunter nach Coblenz
zu. Die Kette der Berge
begrenzt reizend den
Horizont. Leichen und
vermoderter Aasgestank
aus den Kanälen um die
Stadt. Sie sind tiefer
als der Neckar und der
Rhein; seit 80 Jahren
gehen die Abtritte und
Kloaken hinein ohne
Abfluß. Im August oder
sonstiger heißer Zeit
sind Soldaten, die daran
auf dem Posten standen,
ohnmächtig davon worden,
und man hat sie müssen
ins Spital bringen. Wenn
man sie reinigen will,
müssen sie mit vielen
Kosten ausgepumpt
werden.
Karl Theodor hat während
seiner Regierung 31
Millionen Gulden auf die
bildenden Künste und
Architektur verwendet.
Die Gallerie bedeutet
wenig; es ist nicht ein
einziges großes
Hauptstück da. Hübsche
kleine Kabinetssachen.
Die Bibliothek hat eine
gute Form. Sie ist ganz
unter der jetzigen
Regierung angelegt.
Erste Mainzer Biebel.
Und die von 1462 auf
Pergament. Menge
Wirthshäuser in den
Gärten urn die Stadt.
Das Volk ist zur Lust
geschaffen.“ (Wilhelm
Heinse, 1789)
„Hier schwimmt man in
den Wollüsten der
Musikl“ (Friedrich
Gottlieb Klopstock)
(EMI
Electrola 1 C 037-45
571)
|
|