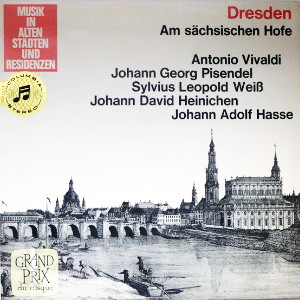 |
| 1 LP - C
91 105 - (p) 1962 |
 |
| 1 LP - 1
C 037-45 572 - (p) 1962 |
 |
| 1 CD - 9
28337 2 - (p) & (c) 2013 |
|
| DRESDEN - Am
sächsischen Hofe |
|
|
|
|
|
| Antonio Vivaldi
(1678-1741) |
Concerto g-moll
F. XII, 3 "Per l'orchestra di
Dresda" per Violino,
2 Flauti, 2 Oboi, 2 Fagotti,
archi e Cembalo |
|
A1
|
|
-
Allegro |
4' 27" |
|
|
-
Largo non molto |
1' 49" |
|
|
-
Allegro |
4' 04" |
|
|
Hans Gieseler |
Berlin Philharmoniker | Hans von
Benda, Dirigent
|
|
|
| Johann Georg Pisendel
(1687-1755) |
Largo
aus der Sonata à Violino solo senza
Basso - Herausgegeben: Günther
Haußwald - Hortus Musicus 91
|
3' 04" |
A2
|
|
Helga Thoene,
Violine
|
|
|
| Leopold Sylvius Weiss
(1686-1750) |
Fantasie
-Tabulatur 1719, Prag,
eingerichtet von Eugen
Müller-Dombois |
2' 11" |
A3
|
|
Eugen
Müller-Dombois, Barocklaute |
|
|
| Johann David Heinichen
(1683-1729) |
Pastorale per la
Notte della Nativitate Christi
(Weihnachtspastorale) -
Herausgegeben: J. Bachmair
(Breitkopf & Härtel)
|
5' 51" |
A4
|
|
Eugen
Müller-Dombois, Laute |
Heinz-Friedrich Hartig, Cembalo
|
|
|
|
Berliner
Philharmoniker | Wilhelm
Brückner-Rüggeberg, Dirigent |
|
|
| Johann Adolf Hasse
(1699-1783) |
Arminio
- aus der Oper - Herausgegeben:
Rudolf Gerber
|
|
B1
|
|
-
Ouvertüre (Sinfonia) - Allegro
con spirito · Alla Polacca
· Allegro assai |
5' 34" |
|
|
-
Rezitativ: "Son par sola
una volta" (Tusnelda) |
2' 09" |
|
|
-
Arie: "Se col pianto e
coll'affanno" (Tusnelda) |
7' 49" |
|
|
Marlies
Siemeling, Sopran |
Heinz-Friedrich Hartig, Cembalo
| Eberhard Finke, Violoncello
|
|
|
|
Berliner
Philharmoniker | Wilhelm
Brückner-Rüggeberg, Dirigent |
|
|
|
Konzert
G-dur für Flöte, Streicher und
Basso continuo -
Herausgegeben; Richard Engländer
(Nagels Verlag Kassel) |
|
B2
|
|
-
Allegro |
2' 54" |
|
|
-
Grave |
3' 59" |
|
|
-
Allegro assai |
2' 49" |
|
|
Heinz Zöller,
Flöte | Wolfgang Meyer, Cembalo
|
|
|
|
Die Berliner
Philharmoniker | Wilhelm
Brückner-Rüggeberg, Dirigent |
|
|
|
|
|
| Interpreters
(see above). |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Berlin-Grunewald
& Berlin-Zehlenforf (Germania)
- febbraio, marzo & novembre
1961 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Fritz
Ganss / Christfried Bickenbach /
Horst Lindner |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- C 91 105 - (1 LP) - durata 47'
15" - (p) 1962 - Analogico |
|
|
Altre edizioni
LP
|
|
EMI
Electrola - 1 C 037-45 572 - (1
LP) - durata 47' 15" - (p) 1962 -
Analogico |
|
|
Edizioni CD |
|
EMI
Music - 9 28337 2 - (1 CD) -
durata 47' 15" - (p) & (c)
2013 - ADD |
|
|
Cover |
|
Blick
auf Dresden im 18. Jahrhundert,
Stich von B. Probst nach Canaletto
- Privatsammlung Leverkusen
|
|
|
|
|
Die
Dresdner Hofkapelle
Unter dem verstaubten
Aktenmaterial des
Dresdener
Oberhofmarschallamtes
haben sich aus der Zeit
August des Starken
kleine Stoffproben
erhalten. Man streicht
über brüchig gewordene
Seide und erkennt in
ihren ein wenig
verblaßten Farben einige
Nuancen, wie sie der
Hofchronist eines
Damen-Ringelstechens am
6. Juni 1709 so exakt
beschrieben hat:
„Couleur de Cerise,
Couieur de Rose,
Incarnat, Violet, Bleu
foncé, Bleu mourant,
Bleu céleste...", die
Schattierungen von Gelb,
Braun, Grün, Weiß - für
jedes Gewand der 24
Damen des sächsischen
Adels eine andere
Farbtönung, wichtig
genommene
Unterscheidungen, und
doch nur winziges Detail
eines Festprogramms, das
über einen Monat lang
den Besuch des
Dänenkönigs Friedrich
IV. in Dresden feierte.
Die Schlacht bei Pultawa
war siegreich
geschlagen, die Krone
Polens neu errungen, der
Krieg vorbei. Dresden,
in den ersten Jahren der
polnischen Ära Augusts
des Starken durch das
fremdartige Warschau als
Festschauplatz abgelöst,
bewährt sich erneut als
Mittelpunkt großer
Feste. Der Staatsbesuch
des dänischen
Verbündeten ist der
politische Anlaß zu
Feiern, die zur
triumphalen
Demonstration von Macht
und Reichtum werden.
Tag für Tag wechseln die
Veranstaltungen: Jagden
und Preisschießen, ein
Fußturnier auf dem
Altmarkt, abends
Komödien und Redouten,
italienische und
französische Oper,
Maskeraden von Göttern
und Bauern. Bei dem
Karussellrennen der
„Vier Weltteile“ führt
der dänische Gast die
europäische Esquadrille
an, August der Starke
die afrikanische; der
Adel repräsentiert sich
im ritterlichen
Wettkampf, Höhepunkt des
vorangegangenen
Aufzuges, bei dem allein
60 Trompeter, 10
Paukisten, 84 andere
Musikanten und auf zwei
Festwagen über 30
Mitglieder der
Hofkapelle mitwirkten.
Das anmutige Fest der 24
aristokratischen Damen
spielt sich in dem neu
erbauten hölzernen
Amphitheater ab. Dann
wechselt die Szenerie.
Auf der Elbe ist alles
für eine kriegerische
Vorführung bereit. Der
Meeresgott Neptun taucht
auf und singt eine
kämpferische Arie. Ein
Chor von Najaden grüßt
das erlauchte Publikum.
Unterdessen ist es
vollends Nacht geworden.
Böllerschüsse kündigeb
eine neue Überraschung
an. Langsam gleiten, von
unzähligen Wachslichtern
und Flambeus
illuminiert, schiffe
heran, bis in die Nähe
der königlichen Loge.
Und dann erklingt vom
Wasser her „eine
unvergleichliche,
prächtige Music“:
Allegorische Gestalten,
La Pace e Marte,
von der Hofkapelle
begleitet, führen eine
dramatische Serenade des
kaiserlichen
Kammerkomponisten Carlo
Badia auf. Zum Abschluß,
als nicht mehr zu
steigernder Effekt: das
Feuerwerk. Im sprühenden
Licht, unter dem Zischen
der Raketen und dem
Donnern der Kartaunen
wird in drei
militärischen Attacken
ein Kastell erobert. Auf
dem oberen Felsen des
Festungswalls leuchten
in grünen Lichtern die
Initialen des Dänen auf,
eine letzte Reverenz vor
dem königlichen Gast. So
endet der Abend, endet
ein Tag von vielen
Festtagen, jeder
originell, jeder als
kostbare Einmaligkeit
gepriesen und erlebt.
Es ist nicht nur Aufwand
an äußerem Pomp, der in
bunter Vielfalt und mit
allem Raffinement vor
einem beifällig
staunenden Publikum (und
das heißt: vor der
Aristokratie Europas,
die davon erfahren soll)
ausgebreitet wird. Die
künstlerisch sichere
Formung jedes Details,
seine sinnvolle
Beziehung zum Ganzen,
die Durchsetzung aller
Veranstaltungen mit
geistigen Elementen -
alles das erhebt diesen
Festzyklus von 1709 über
eine Schaustellung des
bloß Materiellen.
In prächtigen Folianten
haben Chronisten und
Poeten die Feste des
Dresdener Hofes minuziös
beschrieben und
pathetisch verherrlicht,
Maler und Kupferstecher
die Repräsentationen
bildlich dargestellt.
Der Aufzug
heidnischer Götter und
Göttinnen von 1709
war schon einmal, bei
dem Karnevalsfest 1695,
durch die Straßen der
Stadt gezogen. In
Gouachen und
Kupferstichen sind uns
die elf antikisierenden
Gruppen überliefert. Zum
ersten Male wirkten bei
einem Festzuge Damen des
Hofes mit. Eine sicher
in Hofkreisen heimlich
belächelte
Rollenbesetzung: die
schöne Aurora von
Königsmark, derzeitige
Favoritin Augusts des
Starken, lenkte als
Göttin Aurora den
Sonnenwagen Apolls. Auf
einem als Parnaß
verkleideten Festwagen
waren als die Neun Musen
(seit der Renaissance
bevorzugtes Motiv
Dresdener Hoffeste)
vornehme Damen placiert,
jede ein anderes
Instrument in der Hand.
Und sie sangen „lieblich
als die Engel“.
Eines von vielen
Beispielen für die enge
Verbindung von Fest und
Musik. zugleich auch für
die Mitwirkung des
Adels, der allerdings in
den Inventionsauzügen um
1600 und in den Sing-
und Opern- balletten des
17. Jahrhunderts eine
weitaus größere Rolle
gespielt hatte. Mit der
wachsenden Verpflichtung
von Berufskräften
wechselt der Adel nach
und nach in die Rolle
des Publikums über. Das
Divertissement Les
quatre Saisons
„mit untermischten
Balletten, wovon die
Acteurs als auch die
Täntzerin und Täntzer
aus adelichen Standes
Personen bestunden“, im
Naturtheater des Großen
Garten bei dem
berühmtesten aller
Dresdener Hoffeste, den
Vermählungsfeierlichkeiten
von 1719, aufgeführt,
ist fast schon eine
Ausnahme.
Die Vorbereitungen zu
dieser Hochzeit des
sächsischen Kurprinzen
und der Kaisertochter
aus Wien, ein
politisches Ereignis par
excellence, hatten viele
Kräfte beansprucht. Von
den gewaltigen Neu- und
Umbauten angefangen bis
in die kleinste
Regieanweisung war alles
sorgsam bestimmt und
vieles, Skizzen und
Notizen zufolge,vom
Landesherrn selbst
dirigiert. Für die
Zwecke der Musik, Teil
der Gesamtmanifestation
aller Künste, war das
damals größte deutsche
Opernhaus errichtet
worden, das seine
Erbauer in den nach der
Sophienkirche hin
gelegenen Winkel des
Zwingers eingefügt
hatten. Die feierliche
Eröffnung des Hauses mit
Antonio Lottis Giove
in Argo am 3.
September 1719, einen
Tag nach dem
zeremoniellen Einzug der
Braut, leitete eine
musikdramatisch
bedeutende Epoche
Dresdens ein, die in der
Ära Hasses einen ersten
Höhepunkt erleben
sollte. In zehn Jahren,
seit 1709, war die
Hofkapelle planmäßig
ausgebaut worden. Ihren
Ruhm begründeten
hervorragende Virtuosen:
die Violinisten Pisendel
und Veracini, der
Kontrabassist Zelenka,
der Flötist Buffardin,
der Theorbist Weiß.
Glänzende Gesangssterne
Europas, darunter die
Altistin Tesi und der
Kastrat Senesino,
vereinigten sich zu
einem Ensemble, das
seinesgleichen suchte.
(Händel kam eigens aus
London herbei, um
Vertragsabschlüsse für
sein Opernunternehmen zu
tätigen.) Französisches
und italienisches
Schauspiel, eine
polnische Kapelle, nicht
zuletzt das Hofballett
mit dem berühmten Louis
de Poitier und der
Primaballerina Duparc,
der geniale
Bühnenbildner Alessandro
Mauro - sie alle waren
eingespannt in einen
Festplan, dessen straffe
Gliederung auch die
Feste späterer
offizieller Anlässe,
etwa zum Besuch des
Preußenkönigs 1728 und
zu dem Manöver in
Zeithain 1730, in den
Schatten stellen sollte.
Wie bei der berühmten
„Durchlauchtigsten
Zusammenkunft“ 1678
vollzieht sich das
Hochzeitsfest von 1719
unter dem Patronat der
VII Planeten. Zu Beginn
- betonter Akzent, im
Garten des späteren
japanischen Palais
nachmittags aufgeführt -
eine Serenade derer
Sieben Planeten.
In einem duftigen Kranz
von Wolken (einer
Maschinerie im Freien)
erscheinen der Reihe
nach die Götter, von
denen „ein jeder die
hohe Herrschaft zu einem
besonderen Festin“
einlädt. Augen-, aber
auch Ohrenschmaus, denn
der Komponist Johann
David Heinichen bringt
in seinem Werk nicht nur
die Kehlvirtuosität der
italienischen Sänger und
Primadonnen, sondern
auch das meisterhafte
Können der
instrumentalisten, z. B.
in anspruchsvollen
Theorbenpartien für
Sylvius Leopold Weiß zur
Geltung. - Bei der
feierlichen Einweihung
des Zwingers, dieser von
Matthias Daniel
Pöppelmann, dem
„reichsten Genie des
ganzen Barock“,
geschaffenen steinernen
Festdekoration,
dominiert am 15.
September Jupiter. Vor
dem Karussell der Vier
Elemente erscheint
der Gott selbst auf dem
Chaos, bei dem „ein
dreytacher Globus...
einer in den anderen
sich beweget“. Zu diesen
raffinierten
Maschinenkünsten singt
Jupiter - es ist der
Altist Boschi - eine
italienische Arie
Lottis. Und dann wird
das Chaos (1000
Taler wert) vor der
königlichen Loge
zerstört. - Zu Ehren der
Göttin Diana wird eine
Wasserjagd auf der Elbe
veranstaltet. Nachdem
der Hof am Ufer unter
einem Jagdzelt Platz
genommen hat, nähert
sich auf einer reich
verzierten Gondel Diana,
die mit ihren Nymphen
vor einem Muscheldekor
thront. Vor ihr, im Fond
des Schiffes, musiziert
in „grünen Daffnen
Kleidern“ das Orchester.
Serenata fatta
sull'Elba heißt
die Komposition
Heinichens, die mit
häufig verwendeten Corni
da caccia das Kolorit
dieses Jagdfestes
unterstreicht. So reiht
sich eine
Planeten-Lustbarkeit an
die andere, umrankt von
zahlreichen anderen
Veranstaltunden. der
Großen Oper,
Marionettentheater oder
einem Türkischen Fest,
das uns das originelle
Bild einer Tafelmusik
beschert hat. Mit
unerhörter
Erfindertreudigkeit
haben sich Künstler von
europäischem Rang zur
Ausschmükkung vereint
und das Typische mit
allem Beiwerk sinnfällig
gemacht. Wenn am Schluß,
bei dem Saturnfest im
Plauenschen Grunde am
26. September, aus dem
illuminierten felsigen
Gelände die Inschrift
„CONSTELLATlO FELIX“,
von den sieben
Planetenzeichen umrahmt,
aufleuchtet, so ist dies
ein sichtbares Symbol
für die bis ins letzte
durchdachte
Gesamtdisposition eines
Festes, das sich in
allem und jedem an die
höchste politische
Adresse wendet -
Verherrlichung
absolutistischen
Fürstentums.
Irmgard
Becker-Glauch
Antonio Vivaldi
Antonio Vivaldi war
einer der bedeutendsten
italienischen Geiger und
Komponisten des 18.
Jahrhunderts. Um 1675,
spätestens 1678 in
Venedig geboren, wuchs
er als Schüler seines
Vaters auf, der Geiger
im Orchester von San
Marco war.
Möglicherweise hat er
auch bei Giovanni
Legrenzi studiert. 1703
erhielt er die
Priesterweihen; wegen
seiner roten Haare wurde
er als „prete rosso“
bezeichnet. Er wirkte
zunächst als
Violinlehrer, später als
Konzertmeister und
Komponist an dem
venezianischen
Mädchenkonservatorium
della Pietà; unter
seiner Leitung erlangten
die Konzerte
internationalen Ruf.
Vermutlich war er von
1720 bis 1723 in Mantua
als Hofkapellmeister des
Markgrafen Philipp von
Hessen-Darmstadt tätig,
der dort als Statthalter
amtierte. Zahlreiche
Konzertreisen und
Aufführungen seiner
Opern führten ihn nach
Wien, Amsterdam und in
viele italienische
Städte. Er starb völlig
verarmt in Wien, wo er
am 28. Juli 1741
begraben wurde.
Johann Georg Pisendel
Johann Georg Pisendel,
am 26. Dezember 1687 im
fränkischen Kadolzburg
geboren, stieg rasch zu
den führenden deutschen
Geigern der damaligen
Zeit empor. Nach Jahren
als Kapellknabe in
Ansbach studierte er
seit 1709 an der
Universität Leipzig,
dirigierte dort die
Oper, wurde aber bereits
1712 als geschätzter
Violinist an die
Dresdener Hofkapelle
verpflichtet. 1714
reiste er mit dem
dortigen Konzertmeister
Volumier nach Paris,
1716 studierte or bei
Vivaldi in Vebedig, im
nächsten Jahre bei
Montanaru in Rom. 1728
übertrug man ihm die
Stelle eines
Hotkonzertmeisters in
Dresden. Pisendel,
zweifellos einer der
kühnsten Virtuosen des
deutschen Musikbarocks,
der traditionellen Geist
mit weltoffener Haltung
zu verschmelzen suchte,
starb am 25. November
1755 in der Stadt seiner
Wahlheimat.
Sylvius Leopold Weiss
Sylvius Leopold Weiß ist
gebürtiger Schlesier. Am
12. Oktober 1686 in
Breslau geboren, von
seinem Vater als
Lautenist ausgebildet,
reiste er von 1708 bis
1714 mit dem polnischen
Prinzen Sobieski nach
italien, wirkte danach
als Lautenist in Kassel
und in Düsseldorf, seit
1717 in der Hofkapelle
zu Dresden, wo er im
nächsten Jahr als
hervorragender Könner
seines instruments zum
Kammervirtuosen ernannt
wurde. Von Reisen nach
Wien und Berlin
abgesehen, blieb er
Dresden treu bis zu
seinem Tode am 15.
Oktober 1750.
Johann David
Heinichen
Johann David Heinichen
kommt aus dem Dorfe
Krössuln in der Nähe von
Weißenfels, wo er als
Pfarrerssohn am 17.
April 1683 geboren
wurde. Nach Absolvierung
der Leipziger
Thomasschule unter
Schelle und Kuhnau
studierte er an der
dortigen Universität
Rechtswissenschaft,
wurde Advokat in
Weißenfels, trat aber
gleichzeitig in Leipzig
als Komponist mit
frühdeutschen Opern
hervor. Nach einer
kurzen Tätigkeit als
Hofkomponist in Zeitz
reiste er als Stipendiat
nach Italien und
erzielte besonders in
Venedig nachhaltige
Erfolge. Prinz Friedrich
August von Sachsen
berief Heinichen 1717
von dort aus nach
Dresden als
Hofkapellmeister, wo ihm
ein hervorragendes
Orchester mit Volumier,
Pisendel, Weiß und
weiteren Solisten von
Rang für Oper, Kammer
und Kirche zur Verfügung
stand. Er starb in
Dresden am 16. Juli
1729.
Johann Adolf Hasse
Johann Adolf Hasse war
als Meister der Oper
hochberühmt. Am 25. März
1699 in Bergedorf bei
Hamburg getauft, wirkte
er zunächst als Tenor in
Hamburg und
Braunschweig, ging 1722
nach Neapel, wo er als
Schüler Porporas und
Alessandro Scarlattis
Erfolge als Komponist
eryielte. 1727 amtierte
er als Kapellmeister am
Conservatorio degli
Incurabili in Venedig,
heiratete die gefeierte
Primadonna Faustina
Bordoni und entfaltete
nach 1730 als
Kapellmeister in Dresden
einen höfisch-barocken
Prunkstil, der
europäischen Ruf genoß.
Zahlreiche Kunstreisen
führten das Ehepaar in
alle Musikzentren von
Rang. Hasse, der in
Italien nur als „il
divino sassone“, als
„der göttliche Sachse“,
bezeichnet wurde, starb
am 16. Dezember 1783 in
Venedig.
G. H.
Antonio Vivaldi:
Concerto g-moll
Der Bedeutung Vivaldis
ist in erster Linie
darin zu sehen, daß er
dem italienischen
Solokonzert des 18.
Jahrhunderts ein fest
gefügtes Gepräge
verlieh. Es entstand
eine für die europäische
Barockmusik ungemein
wichtige und
charakteristische Form,
die namentlich auf
deutschem Boden durch
Johann Sebastian Bach
aufgegriffen wurde. Der
Aufbau der Werke wird
meist durch eine klare
Dreisätzigkeit
gekennzeichnet. Kecke
Ecksätze mit plastischen
Orchesterritornellen und
virtuos ausgezierten
konzertanten Episoden
umrahmen vielfach einen
sehr intim gehaltenen
Innensatz. Auch das
vorliegende
g-moll-Concerto weist
diese Gesetzmäßigkeit
auf. Wie der Zusatz „Per
l'orchestra di Dresda“
erkennen läßt, ist das
Werk für die damalige
Dresdener Hofkapelle
bestimmt gewesen. Aus
gutem Grund, denn
besetzungsmäßig werden
zahlreiche Holzbläser
gefordert (2 Flauti, 2
Oboi, 2 Fagotti).
Dresden aber durfte sich
rühmen, hierfür
besonders geeignete
Kräfte zu besitzen.
Hochbarockes
Lebensgefühl spricht aus
diesem Werk. Man achte
auf die scharf
geschnittenen
thematischen Konturen,
auf die Kantabilität der
melodischen Linie, aber
auch auf die herbe
Strenge im Ausdruck, bei
dem musikalische Logik
mit Tiefe der Empfindung
sich aufs glücklichste
paart.
Johann Georg
Pisendel: Largo
Das kurze Stück bildet
den Eröffnungssatz einer
Sonate für Violine
allein ohne Baß.
Rhapsodisch frei
ausschwingend gehalten,
wechselt einstimmig
melodische Linie mit
kühner Akkordballung.
Doppel-, Tripel- und
Quadrupelgriffe lassen
ahnen, daß es sich hier
um virtuose Musik von
höchster Konzentration
handelt. Derartige
Zusammenklänge
widerstreben an sich dem
Wesen der Violine, die
in ihrer Spieltechnik
auf rein lineare
Entfaltung gerichtet
ist. Wie aber in diesem
Satz akkordisches
Klanggefüge von
improvisierender
Kantilene abgelöst wird,
das offenbart
schlagartig die ganze
Weite und Tiefe barocken
Denkens, das niemals auf
Polyphonie allein
gerichtet ist, sondern
gleichermaßen von der
Freude am Ornament, von
der Vision des
Irrationalen wie vom
Willen nach reich
gegliederter Architektur
bestimmt ist. Von hier
aus lassen sich ohne
Zwang Brücken zu Bachs
hochberühmtem Zyklus von
Sonaten und Partiten für
Violine allein schlagen,
von denen man wohl mit
Recht annimmt, daß der
Thomaskantor sie für
Pisendel komponiert hat.
Sylvius Leopold Weiß:
Fantasie
Die Laute hat im Barock
stets eine besondere
Wertschätzung erfahren.
Als Generalbaßinstrument
unentbehrlich, erfüllte
sie darüber hinaus
wichtige solistische
Aufgaben. Man schätzte
die aus reicher
Tradition erwachsene
zärtliche Musik
besonders, vor allem,
wenn sie das
spielerisch-improvisatorische
Element betonte, wie es
auch in dem vorliegenden
Stück der Fall ist. Die
Fantasie ist als
Tabulatur, d. h. in
einer besonderen
Griffschrift für das
Instrument überliefert
worden. Die Aufzeichnung
erfolgte im Jahre 1719.
Die Übertragung und
deren klangliche
Realisation läßt
deutlich werden, welch
intimer Reiz in solcher
Musik verborgen sein
kann.
Johann David
Heinichen:
Weihnachts-Pastorale
Das „Pastorale per la
Notte della Nativitate
Christi“ muß als ein
Meisterwerk
altklassischer
Weihnachtsmusik
bezeichnet werden.
Selten ist der Zauber
echter Hirtenstimmung so
eindrucksstark
eingefangen worden, wie
es hier der Fall ist.
Die leichtwiegenden
punktierten Rhythmen der
Musik, die kaum eine
gedanklich-thematische
Entwicklung bringen,
sondern vielmehr ganz
das Atmosphärische der
Weihnacht aufgreifen,
schaffen einen gar
behutsamen, überaus
zärtlichen
Siciliano-Stil, der bei
einem deutschen
Komponisten völlig
überrascht. Aber gerade
das hatte der spätere
Dresdener
Hofkapellmeister in
Venedig gelernt. Der
sonst so gelehrte
Kontrapunktiker liebte
die pastellfarbenen
Töne, die weichen und
oft verschwommenen
Farben. Oft vermochte er
seinen Akkordfolgen ganz
duftigen Glanz zu geben.
Die Sonne des Südens hat
auch seine Musiksprache
verzaubert, und die
frohe Botschaft von der
Geburt Christi zwingt
ihn zu einem pastoralen
Stimmungsbild ganz
individueller Art.
Johann Adolf Hasse:
Ausschnitte aus der
Oper „Arminio“
Der Wert der Opern
Hasses ist bis zur
Stunde noch keineswegs
genügend erhellt. Etwa
80 Opern stammen aus
seiner Feder, und nur
allzuleicht war man
geneigt, sie vielfach
als Routinearbeiten zu
betrachten. In
Wirklichkeit handelt es
sich bei Hasse um einen
Meister des
Dramatischen, der im
Sinne Metastasios mit
der Typik der
Situationen eine
Musikoper aufbaute, die
zwar ganz im Banne
rationalistischer
Denkweise stand und
dennoch ein hohes Maß
von individuellem
Eigenleben erkennen
laßt. Zweifellos ist es
Hasse gelungen, im
Bereich der Opera seria
über äußerliche Schemata
zu einer echten
Menschenzeichnung
vorzustoßen. Das zeigt
nicht nur so manches
Rezitativ, sondern
spiegelt sich vor allem
auch im weit gespannten
Atem seiner Arienkunst,
die er zwar logischer
Ordnung und innerer
Gesetzmäßigkeit im
formalen Charakter
unterwirft, die aber
doch stets das
Hintergründige des
Persönlichen spüren
läßt. In erster Linie
freilich kommt es ihm
auf die Darstellung des
jeweiligen Affekts der
handelnden Personen an.
Hier überhöht er oft die
literarische Vorlage
Metastasios und gibt ihr
musikalische Kontur und
gesteigertes Profil.
Bereits 1730 hatte Hasse
den Arminio-Stoff
vertont. Die dreiaktige
Oper nach Salvi kam in
Mailand zur
Uraufführung. Für eine
zweite Arminio-Oper
schrieb Pasquini den
Text. Sie steht auf
völlig anderer Grundlage
als das erstgenannte
Werk. Am 7. Oktober 1745
wurde sie am Dresdener
Hoftheater erstmals auf
Wunsch König Friedrichs
II. von Preußen
aufgeführt, der damals
in Dresden weilte. Die
beiden Ausschnitte aus
dieser Oper zeigen
einmal den glänzenden
Sinfoniker, der in einer
typisch dreisätzigen
Ouvertüre Brillanz,
Kraft und Glanz im
orchestralen Sinne zu
entfalten vermag. Das
Rezitativ und die Arie
der Tusnelda dürfen
gleichfalls als
charakteristische Proben
Hassescher Operndramatik
angesprochen werden.
Sorgsame
Sprachbehandlung,
intensiv gesteigertes
italienisches Melos sind
ihre Vorzüge.
Johann Adolf Hasse:
Konzert G-dur
Ein reizvolles
dreisätziges Konzert,
das den einfallsreichen
Melodiker deutlich
erkennen läßt. Zwar ist
auch hier jener typische
Musikstil nach Form und
Gehalt spürbar, wie ihn
der Geist der Zeit so
stark ausgeprägt hat,
doch bleibt genug des
interessanten, des
Aparten, das diesem
Konzert geistige
Spannweite sichert. Die
drei Sätze spiegeln
einen hochbarocken,
italienisch geprägten
Musizierstil, wie er am
Dresdener Hof damals
besonders gepflegt
wurde. In den raschen
Sätzen fesselt die Kraft
des thematischen
Einfalls wie der
konzertante Schmuck. Der
Innensatz wird ganz von
edlem, pastosem Ausdruck
getragen. Höfische
Gesellschaftskunst in
kammermusikalischer
Prägung hat sich hier zu
selten schöner
Eindringlichkeit
verdichtet.
Günter
Hausswald
(EMI
Electrola 1 C
037--45 572)
|
|