 |
| 1 LP -
SMC 91 118 - (p) 1966 |
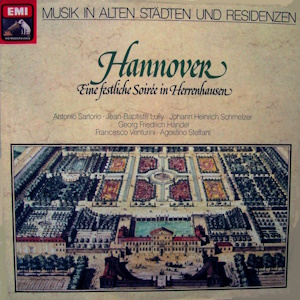 |
| 1 LP - 1
C 037-45 578 - (p) 1966 |
 |
| 1 CD - 9
28335 2 - (p) & (c) 2013 |
|
| HANNOVER - Eine
festliche Soirée in Herrenhausen |
|
|
|
|
|
| Johann Heinrich
Schmelzer (um 1623-1680) |
Sonata con arie
zu der kaiserlichen - Serenada
(1672) - für 3
Trompeten, Streicher &
B.c. |
|
|
|
1.
Sonatina |
1' 30" |
A1
|
|
2.
Intrada |
0' 46" |
A2
|
|
3.
Aria |
0' 36" |
A3
|
|
4.
Canario |
0' 25" |
A4
|
|
5.
Aria |
0' 46" |
A5
|
|
6.
Sonatina |
1' 30" |
A6
|
|
|
|
|
| Antonio Sartorio
(um 1620-1687) |
7. Sinfonia aus
L'Adelaide - für 2
Trompeten, Streicher &
B.c. |
1' 22" |
A7
|
|
|
|
|
| Jean-Baptiste Lully
(1632-1687) |
Suite aus der
Comédie Les amants magnifiques
- für 2
Floten, 2 Oboen, Fagott,
Streicher & B.c. (2
Lauten & Cembalo) |
|
|
|
8.
Ouverture |
2' 04" |
A8
|
|
9. Danse des
Pécheurs |
1' 00" |
A9
|
|
10.
Danse de Neptune |
1' 13" |
A10
|
|
11.
Les suivants de Neptune |
1' 04" |
A11
|
|
12.
Symphonie des Plaisirs |
0' 56" |
A12
|
|
13.
Menuet pour les Faunes et les
Dryades |
1' 02" |
A13
|
|
14.
Ritournelle pour les Flûtes |
1' 15" |
A14
|
|
15.
Les Pantomimes |
2' 05" |
A15
|
|
16.
Air des Pantomimes |
0' 51" |
A16
|
|
17.
Les porteurs de Haches |
0' 50" |
A17
|
|
18.
Les Hommes et Femmes armés
|
1' 11" |
A18
|
|
|
|
|
| Agostino
Steffani (1654-1728) |
19. "Il Turno",
Oper - Arie: Il dolce respiro
(Lavinia) |
2' 52" |
A19
|
|
20. "La lotta
d'Ercole con Acheloo", Oper
- La lotta für Streicher
& B.c. |
2' 10" |
A20
|
|
|
|
|
| Georg Friedrich Händel
(1685-1759) |
"Amadigi",
Oper |
|
|
|
21.
Sinfonia |
1' 29" |
B1
|
|
22.
Rezitativ: D'un sventurato
amante - |
0' 41" |
B2
|
|
23.
Arie: Pena tiranna, io sento
al core (Dardano) |
5' 03" |
B3
|
|
24.
Arie: Ah! spietato (Melissa) |
5' 37" |
B4
|
|
25.
Rezitativ: Mi deride l'amante
- |
0' 29" |
B5
|
|
26.
Arie: Desterò dall'empia Dite
(Melissa) |
4' 13" |
B6
|
|
27. Rezitativ:
Addio, crudo Amadigi! - |
1' 23" |
B7
|
|
28.
Arie: Io già sento l'alma in
sen (Melissa) |
1' 42" |
B8
|
|
|
|
|
| Francesco Venturini
(um 1675-1745) |
29. Ouverture
a-moll (um 1700) - aus:
Concerti da camera op. 1 - für 2
Flöten, 2 Oboen, Fagott,
2 Soloviolin, Streicher
& B.c. |
7' 15" |
B9
|
|
|
|
| Teresa
Zylis-Gara, Sopran
(24,25,26,27,28) |
Consortium Musicus
/ Fritz Lehan, Leitung |
|
| Ursula Terhoeven,
Mezzosopran (19,22,23) |
- Edward H. Tarr,
Walter Holy, Robert Bodenröder, Trompete |
|
|
- Hans Paar, Willi
Büchel, Flöte |
|
|
- Helmut Hucke,
Hans-Ludwig Hauck, Oboe |
|
|
- Hans Rudolf Seith, Fagott |
|
|
- Eugen M. Dombois,
Michael Schäffer, Laute |
|
|
- Wenzel Pricha, Pauke |
|
|
- Werner Neuhaus,
Wolfgang Lindenau, Violine |
|
|
- Hugo Ruf, Cembalo |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Martin-Luther-Haus,
Köln (Germania) - marzo 1966 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Gerd
Berg / Christfried Bickenbach /
Ernst Rothe |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- C 91 118 - (1 CD) - durata 53'
55" - (p) 1966 - Analogico |
|
|
Altre edizioni
LP
|
|
EMI
Electrola - 1 C 037-45 578 - (1
CD) - durata 53' 55" - (p) 1966 -
Analogico |
|
|
Edizioni CD |
|
EMI
Music - 9 28335 2 - (1 CD) -
durata 53' 55" - (p) & (c)
2013 - ADD |
|
|
Cover |
|
Der
Garten von Herrenhausen -
Kupferstich von J. von Sasse
|
|
|
|
|
Musikleben
am Hofe zu Hannover
Die Musik spielt in
Hannover, wie es
scheint, erst seit der
lutherischen Reformation
eine bemerkenswerte
Rolle. Aus dem
Mittelalter ist, außer
einigen liturgischen
Fragmenten, musikalisch
nichts überliefert, was
den Anspruch auf
Außergewöhnliches
erheben könnte. Kirche
und Schule sind um 1500
die Träger einer mehr
oder weniger bedeutsamen
Musikpflege, die in
ihren Auswirkungen
jedoch gering bleibt.
Der kompositorische
Nachlaß des ersten
protestantischen Kantors
ANDREAS CRAPPIUS
(1542-1623) bestätigt
mit 3 Meßvertonungen, 20
Motetten und 23
dreistimmigen deutschen
Liedern, einigen
Hochzeitscarmina,
besonders aber mit dem
auch außerhalb Hannovers
viel beachteten Lehrbuch
Musica artis
Elementa... Sampt
einer Deutschen Musica
(Helmstedt 1599) das
musikalisch rege Leben
am Ratsgymnasium und in
der Marktkirche. Die
Musik auf Festen und bei
Belustigungen besorgten
die Spielleute; seßhaft
und in geordneten
Verhältnissen lebend
auch Stadtpfeifer
genannt. Der Rat der
Stadt gewährte ihnen
Privilegien und den
notwendigen
Gewerbeschutz. Insgesamt
lag die Musikpflege in
den Händen der
Bürgerschaft.
Eine überregionale
Musikkultur, die von
sich reden machte,
konnte jedoch erst
gedeihen, als sie in
kraftvoll fördernde
Hände kam. Das war nicht
vor Februar 1636, als
Herzog Georg von
Calenberg Hannover zu
seiner Residenz erhob.
Zur Huldigungsfeier im
Rathaus spielte damals
der hoch geachtete
Organist der
Marktkirche, MELCHIOR
SCHILDT (1593-1667),
Schüler des berühmten
Jan Pieters Sweelinck,
mit dem Stadtpfeifer
Conrad Schlothawer und
etlichen Gesellen
mehrere
Instrumentalstücke. Kurz
danach wird die
Hofkapelle gegründet. In
den Kammerrechnungen des
Jahres 1636/37 sind
bereits fest angestellte
Musiker aufgeführt. Um
1640 hat der Dresdner
Hofkapellmeister
HEINRICH SCHÜTZ
vorübergehend in
Hannover gewirkt;
zweifellos gab er der
hannoverschen Hofmusik
bedeutende Impulse.
Spuren seiner
künstlerischen Tätigkeit
sind leider nicht mehr
zu finden.
Als Herzog Johann
Friedrich 1665 die
calenbergischen Lande
übernahm, entwickelte
sich die Musik am
hannoverschen Hofe zu
neuer, eindrucksvoller
Blüte. Es war die Zeit
nach dem 30jährigen
Krieg, in der sich die
Einflüsse Frankreichs
und ltaliens vor allem
formbildend bemerkbar
machten. Der Fürst legte
besonderen Wert auf die
musikalisch sorgfältige
Ausgetaltung der
Gottesdienste Er war zum
katholischen Glauben
übergetreten und
nachdrücklich daran
interessiert, die
Kirchenmusik auf den
möglichen Höchststand zu
bringen. Den
Organistendienst nahm in
der nunmehr katholischen
Schloßkirche der
Italiener ANTONIO
ZAMBELLI, der bereits
1667 von seinem
Landsmann MATTHIO TRENTO
abgelöst wurde. Über
Herkunft, Ausbildung und
das weitere Schicksal
dieser beiden Organisten
ist nichts bekannt. Für
den Figuralgesang
während der
Gottesdienste sorgten
italienische
Berufssänger. Vor
einigen Jahren kamen
Reste von Stimmbüchern
des Musikalienbestandes
der Schloßkirche wieder
zum Vorschein. Es
handelt sich um
wertvolle Drucke aus der
Mitte des 17.
Jahrhunderts. Sie
stammen aus Paris, Rom
und Venedig. Die in
diesen Büchern
enthaltenen
Meßkompositionen,
Motetten, Litaneien und
Magnificat-Vertonungen
sind instrumental reich
ausgestattet und zumeist
für Solostimmen besetzt.
Auch weltliche Arien und
Instrumentalstücke
wurden gefunden. Die
Komponisten sind D.
BONIFATIO GRATIANI
(1605-1664), HORATIO
TARDITI († um 1650) und
der französische
Hofkompositeur HENRI DU
MONT (1610-1684). Als
Herzog Johann Friedrich
im Dezember 1679
verstarb, verschwand
diese Musik, da in der
Schloßkirche wieder
lutherische
Gottesdienste abgehalten
wurden. Die evangelische
Kirchenmusik hatte bei
Hofe während der
Regierungszeit des
katholischen Landesherrn
ein nur bescheidenes
Dasein gefristet. Für
die Entwicklung der
Hofkapelle und damit für
die Pflege der
weltlichen Musik ist das
Jahr 1666 entscheidend
gewesen. Mit den aus
Celle verpflichteten
Musikern, dem Gambiisten
CLAMOR HEINRICH ABEL,
dem Violinisten NIKOLAUS
ADAM STRUNGK und dem
Baßviolisten ULRICH
STIEFEL waren drei
Künstler von Rang
gewonnen. Sie bildeten
den Stamm des
Instrumentalensembles
und beeinflußten dank
ihres hervorragenden
Könnens den Stil der
höfischen Kammermusik,
die sich damals von der
frühbarocken zur
hochbarocken
Musizierpraxis wandelte.
Strungk war der
bedeutendste deutsche
Geiger seiner Zeit.
Arcangelo Corelli soll
sein Spiel aufs höchste
bewundert haben. Durch
Strungk, dessen
Kompositionen fast alle
verloren gegangen sind,
wurden sehr
wahrscheinlich die
italienischen Formtypen
der Triosonate und des
Concerto grosso in
Hannover bekannt.
Interessante Mischformen
vokaler und
instrumentaler Prägung
kamen zudem in
zahlreichen Drucken aus
Frankreich. Sie machten
sich nicht nur in der
Kirchenmusik bemerkbar,
sondern gaben ebenso
eindringlich der
Gesellschaftsmusik in
Suiten, Solostücken und
Kantaten reizvolle
Abwechslung. Wir sind
heute über die
vielfältige Musik jener
Jahre, die durch den
Musikerkreis am Hofe von
Versailles stark
beeinflußt wurde,
ziemlich genau
orientiert. Fast alles,
was in Paris gedruckt
erschien, kam in fein
gebundenen Exemplaren
auch nach Hannover und
fand in den
Vortragsfolgen der
Hofkapelle den ihnen
gebührenden Platz. Mit
besonderer Liebe pflegte
man die Werke von JEAN
BAPTISTE LULLY. Alle
seine gedruckten Werke
waren in Hannover
vorhanden. Neben
virtuoser Lautenmusik
boten vor allem die
reizenden
Cembalokompositionen aus
der Einflußsphäre von
Couperin, Chambonnière,
Le Bègue und d'Anglebert
eine Fülle
unterhaltsamer Kunst.
Jüngst aufgefundene
Notenmanuskripte geben
darüber genauere
Auskunft.
Kapellmeister wurde im
Herbst 1666 der
Venetianer ANTONIO
SARTORI (um 1620-1681).
Ihm ging bereits ein
guter Ruf als
Opernkomponist voraus.
Es gelang seiner
Initiative in kurzer
Zeit durch Verpflichtung
italienischer Musiker
die Hofkapelle nach den
Wünschen des Herzogs zu
modernisieren. Die
künstlerische Tätigkeit
Sartorios war überaus
erfolgreich. Leider
verließ er Hannover
bereits 1675, um an
der Markuskirche
in Venedig die Stelle
eines Vizekapellmeisters
anzunehmen. Von seinen
Werken hat sich in
Hannover die Partitur
der Musik zu Pietro
Dolfinis Poesia L'Adelaide
erhalten. Die für 2
Trompeten, Streicher und
Basso continuo gesetzte
Sinfonia
vermittelt einen
festlich gestimmten
Eindruck und betont die
exquisite Spieltechnik
vor allem der Bläser.
1666 wurde Herrenhausen,
vor den Toren Hannovers,
Sommerresidenz des
Herzogs. Es versteht
sich, daß im Laufe der
folgenden Jahre zunächst
große Planungen im
Ausbau der Schloßanlage
und der Gärten
realisiert werden
mußten. Die Musik tritt
im Rahmen Herrenhausens
nur begrenzt in
Erscheinung. Erst gegen
Ende des Jahrhunderts,
als nach dem Tode des
Herzogs Johann Friedrich
(1679) der Osnabrücker
Fürstbischof Ernst
August als nächster
Verwandter das Herzogtum
Calenberg übernimmt,
entfaltet Herrenhausen
den vollen Glanz
gesellschaftlichen
Lebens.
Noch in der
Regierungszeit Johann
Friedrichs scheinen sich
neue musikalische Pläne
anzubahnen. Der
nachweisliche
vorübergehende
Aufenthalt des späteren
Wiener Hofkomponisten
JOHANN HEINRICH
SCHMELZER, dessen
Bläsermusiken (Sonaten
und Serenaden) damals
sehr geschätzt waren,
wird im Hinblick auf
Herrenhausen besondere
Bedeutung gebaht haben.
Von Schmelzers
Kompositionen befinden
sich allerdings keine in
Hannover; die
Herzog-August-Bibliothek
zu Wolfenbüttel besitzt
eine Reihe von seinen
gedruckten Partituren,
so daß mit Sicherheit
angenommen werden darf,
daß vor allem seine
Bläsermusik an den
welfischen Höfen
gespielt wurde. Die Sonata
con arie für drei
Trompeten, Streicher und
Basso continuo zeigt in
ihren kontrastreichen
Sätzen die bunte
Vielfalt dieser
Gebrauchsmusik, die vor
allem im Garten bei
festlichen Gelegenheiten
zur Aufführung kam.
Die Musik des
französischen Günstlings
JEAN BAPTISTE LULLY
(1632-1687) stand in
Hannover und in
Herrenhausen in höchsten
Ehren. Sie war Vorbild
für die hannoverschen
Hofkomponisten und
behielt ihre Gültigkeit
bis in die Zeit Georg
Friedrich Handels. Da
sich die Partitur für
die Musik zur Comédie Les
amants magnifiques
aus dem Jahre 1670
zumindest in ihren zur
Suite zusammengefaßten
Tanzsätzen in den
Beständen der
fürstlichen
Musikalienhandlung
befunden haben muß, lag
nichts näher, als sie in
die Vortragsfolge der
Festlichen Soirée in
Herrenhausen
aufzunehmen. Der Reiz
der Stücke liegt in den
rhythmischen und
klanglichen Kontrasten;
ihre formale Ordnung ist
typisch. Unter Herzog
Ernst August und seiner
kunstsinnigen Gemahlin
Sophie (von der Pfalz)
ändert sich das
musikalische Leben am
hannoverschen Hofe von
Grund auf. Die
italienischen Sänger, an
der Spitze Kapellmeister
VlNCENZO DE GRANDlS,
wurden entlassen. Neue
Kräfte konnten sich
bewähren. Zum „Maître
des Concerts“ wurde der
aus Grenoble stammente
JEAN BAPTISTE FARINELLY
(1655-1720) ernannt.
Unter seiner
musikalischen Leitung
wurde das Hoforchester
nach Versailler Vorbild
reorganisiert. Die
sinngemäße Aufgliederung
des Klangkorpers in zwei
Violinen, zwei
Bratschen, ein
Violoncello und einen
Contrabaß mit oder ohne
Cembalo aut der einen
Seite und zwei Oboen,
ein Fagott auf der
anderen Seite, dazu zwei
Trompeten und Pauken,
entsprach durchaus den
klanglichen Forderungen
Herrenhausens. Der bëi
Lully ausgeprägten
Fünfstimmigkeit seiner
Instrumentalsätze
begegnen wir auch bei
fast allen damals in
Herrenhausen und
Hannover musizierten
Orchesterwerken. Der mit
dieser Satzweise
erreichte massierte
Klang diente
gleichermaßen dem
musikalischen Pathos wie
der besseren Hörbarkeit
in großen Sälen oder im
Freien. Insbesondere
waren es die Bläser,
deren klangliche
Tragweite einem exakten
Musizieren im Garten
dienlich war. Die
Klangverbindung der
Streicher mit den
Bläsern und die
notwendige Nuancierung
erreichte Lully durch
die von ihm geschaffene
scharfe Bogenführung,
dem „Détaché“. Höchste
Spieldisziplin zeichnete
das hannoversche
Orchester aus. Farinelly
verließ 1714 Hannover
und trat in
diplomatische Dienste.
Sein Nachfolger wurde
der bereits als Geiger
im Hoforchester
beschäftigte FRANCOIS
(FRANCESCO) VENTURlNl
(um 1675-1745); er wird
in den Hofakten als
französischer Musiker
geführt, stammte aller
Wahrscheinlichkeit nach
aus Brüssel. Sowohl von
Farinelly als auch von
Venturini sind
zahlreiche
Instrumentalkompositionen
nachweisbar. Die in
unserer Programmfolge
aufgeführte Ouverture
a-moll aus den um
1700 bei Etienne Roger
in Amsterdam gedruckten
Concerti da camera
op. 1 bietet einen
reizvollen Einblick in
die Gesellschaftsmusik
am Herrenhäuser Hofe.
Diese l\/lusik diente
verschiedenen
Forderungen; ihre
einzelnen Sätze konnten
bei Tanzveranstaltungen
verwendet werden, kamen
für Ballettaufführungen
in Frage oder erklangen
lediglich zur
Unterhaltung. Obgleich
Venturinis Schaffen nur
Durchschnittswert hatte
und nichts anderes sein
konnte als
Gebrauchsmusik von
Niveau, bleibt er als
Komponist doch
einflußreich. Kein
Geringerer als GEORG
FRIEDRICH HÄNDEL
informierte sich an
diesen Stükken, die
bereits eine
überzeugende Synthese
des italienischen und
französischen
Instrumentalstils
darstellen. Händel hat
in der kurzen Zeit
seines hannoverschen
Aufenthaltes an den
Werken Farineliys und
Venturinis den neuen
Entwicklungsweg der
Orchestermusik studiert.
Nach seinem mehrjährigen
Aufenthalt in italien
wurde ihm Hannover
gewissermaßen zur Stätte
der Besinnung auf sich
selbst. Sein Schaffen
entwickelte sich von da
an in europäischer
Sicht. Der geistige
Einfluß Agostino
Steffanis ist auf diesem
Wege unverkennbar.
Für das hännoversche
Musikleben wurde 1688
der aus Venedig
stammende AGOSTINO
STEFFANI (1654-1728)
maßgebend. Unter seiner
Führung verlagerte sich
das Schwergewicht auf
die Oper. 1689 wurde das
mit hohen Kosten im
Zentrum Hannovers
(Leinstraße) errichtete
Opernhaus mit Steffanis
Henrico Leone
eröffnet. Während in
Herrenhausen die
Kammermusik ausgiebig
gepflegt wurde, machte
in Hannover das
musikalische Theater von
sich reden. Bis 1697
kamen im hannoverschen
Opernhaus mindestens
sieben Werke von
Steffani zur
Uraufführung. Leider
dauerte die Blüte des
mit großer Pracht
entfalteten
Opernunternehmens nur
kurze Zeit. Die
Interessen des
absolutistischen
Herrschers, der 1692 die
neunte deutsche Kurwürde
erhielt, richteten sich
wieder auf andere
Objekte. Als Kurfüst
Ernst August im Januar
1698 starb, war es mit
der Opernpflege am
hannoverschen Hofe auf
lange Zeit vorbei.
Immerhin zeichnen sich
die neun Jahre
wechselseitiger
Opernpflege im deutschen
Musikleben als
entvvicklungsgeschichtlich
bemerkenswertes Ereignis
ab. Steffani quittierte
1703 seinen
musikalischen Dienst,
nachdem er im Auftrag
des kurfürstlichen Hofes
bereits längere Jahre
diplomatisch tätig
gewesen war. Seinem
Verhandlungsgeschick
verdankt der
hannoversche Hof das
politisch hohe Ansehen,
das den Kaiser letzten
Endes veranlaßte,
Hannover zum
Kurfürstentum zu
erheben. Steffani ging
von Hannover als
Regierungspräsident nach
Düsseldorf und
avancierte bald darauf
zum apostolischen Vikar
für Norddeutschland mit
der Residenz in
Hannover. Er starb 1728
auf einer Reise in
Frankfurt am Main; dort
wurde er auch begraben.
Auf Steffanis
Veranlassung kam Georg
Friedrich Händel nach
Hannover. Beide hatten
sich in Venedig kennen
und schätzen gelernt.
Musikalisch bieten
Steffanis Opern eine
Fülle herrlicher Musik.
Formal konzentriert,
knapp in den Solo- und
Chorpartien, lyrisch und
dramatisch gleichermaßen
auf melodische Schönheit
gearbeitet,
charakterisiert sie die
Träger der Handlung in
ihrer Wesensart und in
ihren Affekten.
Steffanis Kunst zeigt
sich in der empfindsamen
Liebesarie Il dolce
respiro aus der
Oper Il turno
aus dem Jahre 1709. Die
Solopartie der Lavinia
wird von der Laute
begleitet,
Orchesterritornelle
(instrumentale
Zwischensätze) geben
dazu den klanglichen
Kontrast Als
sinfonisches
Zwischenspiel
präsentiert sich die mit
La Lotta
überschriebene reine
Instrumentalmusik; sie
gehort zur Oper La
Lotta d'Ercole con
Acheloo. Das Werk
erlebte 1689 im
hannoverschen Opernhaus
die Uraufführung. Beide
hier wiedergegebenen
Kompositionen vermitteln
einen Einblick in die
musikalisch typische
Eigenart Stetfanis, der
die italienischen und
französischen
Stilkomponenten seiner
Zeit genial zu verbinden
wußte. Die Deutschen
Siegismund Kusser und
Reinhart Keiser folgten
diesem Beispiel ebenso
wie Georg Philipp
Telemann, der als
Gymnasiast oft von
Hildesheim nach Hannover
kam, um die Hofkapelle
musizieren zu hören.
Steffanis
kompositorische
Tätigkeit beschränkte
sich keineswegs nur auf
die Oper.
Am 16. Juni 1710 wurde
GEORG FRlEDRlCH HÄNDEL
(1685-1759) zum
„churhannoverschen
Capellmeister“ ernannt.
Mit seinem Erscheinen in
Hannover begann ohne
Zvveitel die
bedeutendste Epoche im
Musikleben der
welfischen Residenz. Man
bewunderte den jungen
Künstler als virtuosen
Cembalisten und
gevvandten Tonsetzer.
Seine melodischen
Einfälle waren
unerschöpflich. Für die
Hofgesellschaft schrieb
Händel die berühmten
Kammerduette, für die
Hofkapelle Concerti
grossi, die später
überarbeitet als op. 3
in London gedruckt
wurden. Auch
Cembalomusik entstand in
jenen Jahren; einiges
davon ist kürzlich in
dem handschriftlich
überlieferten Notenbuch
des Grafen v. d.
Schulenburg aufgetaucht.
Obwohl Handel die kurze
Zeit seines
hannoverschen Wirkens
häufig noch durch Reisen
unterbrochen hat, fand
er die Muße für
mancherlei Plane und
Entwürfe. Vielleicht hat
er in Hannover bereits
die Skizzen für seine
Oper Amadigi
entworfen, zumindest die
Anlage verschiedener
Arien festgelegt.
Mancherlei weist
stilistisch auf die
musikalischen
Gepflogenheiten der
hannoverschen Hofmusik,
- so die solistische
Behandlung der Bläser,
die knappe französische
Melodiebildung in den
Arien und die
Dacapo-Technik nach dem
Vorbild der
neapolitanischen Oper. Amadigi
ging zum ersten Mal in
London 1715 über die
Bretter. Das Autograph
der Partitur ist spurlos
verschwunden.
Die Handlung der Oper Amadigi
war den damaligen
Theaterbesuchern
geläufig und bot deshalb
keine Schwierigkeiten.
Reizvoll war die
Szenerie mit ihren
vielen zauberischen
Verwandlungen. Der junge
Ritter Amadigi hat sich
im Garten der Zauberin
Melissa verirrt. Bei ihm
sind die Prinzessin
Oriana und sein Freund
Dardanos. Oriana und
Amadigi lieben sich.
Verzweifelt versuchen
die drei dem
Machtbereich der bösen
Zauberin zu entfliehen.
Als Melissa plötzlich
erscheint und Amadigi
zum Verweilen
auffordcrt, erhält sie
eine Absage. Vollor Wutt
sperrt sie Oriana in
einen Turm. In der arie
Ah! spietato! e non
te muove läßt sie
ihrem Zorn freien Lauf.
Auch Dardanos liebt
Oriana. In der Hoffnung,
die Schöne für sich
gewinnen zu können,
sieht er sich jedoch
getäuscht. Melissa, die
ihm wohlgesonnen ist,
soll helfen. Das
Rezitativ D'un
sventurato amante
und die darauf folgende
Arie Pena tiranna
zeichnen in ergreifender
Klage die
Hoffnungslosigkeit des
unglücklich verliebten
Dardanos. Der Zauberin
Melissa gelingt es auch
mit Gewalt nicht, das
Liebespaar
Oriana-Amadigi zu
trennen. Ihr grausamer
Haß kennt deshalb keine
Grenzen. Mi deride
l'amante
(Rezitativ) und die
forsche, mit
konzertierender Trompete
besetzte Arie Desterò
dall'empia Dite ogni
furio a farvi guerra
unterstreichen den
flammenden Unmut
Melissas. An der
unauslöschlichen Liebe
Amadigis und Orianas
zerbricht endlich das
Zauberreich und mit ihm
die Kraft und das Leben
Melissas. In
ergreifendem Sterben Addio,
crudo Amadigi!
nimmt sie Abschied von
ijrer unglücklichen
Liebe.
Handel verließ Hannover
endgültig 1712, um sich
in England
niederzulassen. Er war
in Hannover
kontraktbrüchig
geworden. 1714 siedelte
der hannoversche Hof
nach London über,
nachdem Kurfürst Georg
Ludwig als Georg I. den
englischen Königsthron
bestiegen hatte. Im
gleichen Jahr starb in
Herrenhausen die
Kurfürstin Sophie. Ihr
hoher Kunstsinn hatte
dem Geistesleben der
Residenz jahrzehntelang
das Profil gegeben.
Musikalisch sinkt das
Niveau der hannoverschen
Hofkapelle nicht mit
einem Schlage. Tüchtige
Musiker und begabte
Kapellmeister sorgen für
qualitativ gute
Darbietungen, zumal bis
in die Mitte des 18.
Jahrhunderts das
höfische Leben in
Hannover nicht erlischt.
Häufig halten sich die
englischen Könige in
Hannover und
Herrenhausen auf.
Neues Leben aber erwacht
erst wieder nach der
französischen
Okkupation, als Hannover
1814 zum Königreich
erklärt wurde. Unter der
Regierungszeit der
beiden letzten Könige,
Ernst August und Georg
V., erlebte Hannover
eine musikalische
Blütezeit, die ihre
Spuren bis in die
Gegenwart hinterlassen
hat. Herrenhausen wurde
wieder Sommerresidenz
und während der
Regierung Georgs V.
Treffpunkt vieler
bedeutender Musiker. Der
König, der ein guter
Klavierspieler und ein
geschickter Komponist
war, liebte es,
regelmäßig
Kammermusikabende in
Schloß Herrenhausen
abzuhalten. Zu den
häufigen Gästen zählte
der Geiger Joseph
Joachim, der sich oft
solistisch aber auch mit
seinem Quartett vor der
königlichen Familie
hören ließ. Aber auch
fremde Künstler, die in
Hannover Konzerte gaben
oder im Opernhaus
auftraten, wurden nach
Herrenhausen eingeladen,
um dort ihre Kunst zu
zeigen. Die Soiréen in
Herrenhausen fanden 1866
ihr jähes Ende, als das
Königreich Hannover von
Preußen annektiert
wurde. Erst seit 1937
entwickelte sich in
Herrenhausen wieder ein
sommerliches Musikleben,
das in den letzten
Jahren, dank der
Initiative der
Landeshauptstadt
Hannover, europäischen
Rang gewann. Das
Galeriegebäude und das
Gartentheater bieten
heute, den musikalischen
Forderungen entsprechend
hergerichtet, den Rahmen
für bedeutende Konzerte
und Opernaufführungen.
Stilbewußte
interpretationen
barocker Musik
unterstreichen die
Einmaligkeit der
Herrenhäuser Schloß- und
Gartenanlage, die die
zahlreichen Besucher aus
nah und fern etwas von
dem Geist verspüren
läßt, der Vergangenes
gegenwärtig macht.
Heinrich
Sievers
(EMI
Electrola 1 C 037-45
578)
|
|