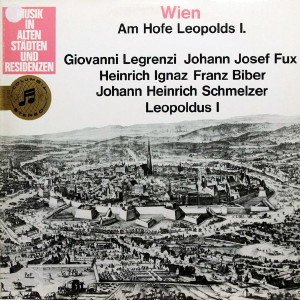 |
| 1 LP - C
91 115 - (p) 1964 |
 |
| 1 LP - 1
C 037-45 574 - (p) 1964 |
 |
| 1 CD -
50999 6025112 1 - (c) 2012 |
 |
| 1 CD - 9
28334 2 - (p) & (c) 2013 |
|
| WIEN - Am Hofe
Leopolds I. |
|
|
|
|
|
|
|
| Johann Joseph
Fux (1660-1741) |
Sinfonia II -
aus: Concentus musico
instrumentalis... 1701 |
|
16' 11" |
A1 |
|
(4 Violinen, 3
Oboen, Tenor,-Gambe, Bass-Gambe,
Violone, Fagott, Cembalo) |
|
|
|
|
-
Allegro assai - Grave - Allegro -
Adagio |
4' 51" |
|
|
|
-
Libertein |
1' 46" |
|
|
|
-
Entrée |
2' 03" |
|
|
|
-
Menuet |
1' 43" |
|
|
|
-
Passepied |
1' 00" |
|
|
|
-
Ciacona |
5' 08" |
|
|
|
|
|
|
|
| Giovanni Legrenzi
(1626-1690) |
Sonata Quinta a
quattro Viole da gamba - aus:
La Cetra 1682 |
|
5' 35" |
A2 |
|
(Pardessus de
Viole, Tenor-Gambe, 2
Bass-Gamben, Violone) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Heinrich Ignaz Franz
Biber (1644-1704) |
Pars III -
aus: Mensa Sonora... 1680
|
|
7' 55" |
A3 |
|
(Violine,
Viola, Tenor-Gambe, Bass-Gambe,
Violone, Cembalo) |
|
|
|
|
-
Gagliarda (Allegro) |
1' 06" |
|
|
|
- Aria
|
2' 37" |
|
|
|
-
Ciacona |
3' 22" |
|
|
|
-
Sonatina |
0' 53" |
|
|
|
|
|
|
|
| Johann
Joseph Fux |
Sinfonia VII
- aus: Concentus
musico instrumentalis... 1701 |
|
12' 06" |
B1 |
|
(Blockflöte,
Oboe, Bass-Gambe, Cembalo) |
|
|
|
|
- Adagio - Andate
- Allegro |
6' 21" |
|
|
|
- La joye des
fidels sujets (Allegro)
|
1' 55" |
|
|
|
- Aria italiana -
Aire françoise (Andante)
|
2' 31" |
|
|
|
- Les enemis
confus (Maestoso e deciso) |
1' 35" |
|
|
|
|
|
|
|
| Johann Heinrich
Schmelzer (um 1623-1680) |
Sonata III
- aus: Sacro profanus concentus
musicus... 1662
|
|
4' 46" |
B2
|
|
(2 Violinen,
Viola, Tenor-Gambe, 2
Bass-Gamben, Violone, Cembalo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Leopoldus
I (1640-1705) |
Regina coeli à 5,
Mense Maio 1655 - Accompagnamento di
Viole del Antonio Bertali, hrsg. von
Guido Adler
|
|
7' 26" |
B3
|
|
(Altstimme*, 2
Violinen, Tenor-Gambe, 2
Bass-gamben, Violone, Cembalo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Johann Heinrich
Schmelzer |
Sonata X -
aus: Sacro profanus concentus
musicus... 1662
|
|
3' 57" |
B4
|
|
(Violine,
Viola, Tenor-Gambe, Bass-Gambe,
Violone, Cembalo) |
|
|
|
|
|
|
|
| Jeanne
Déroubaix, Mezzosopran * |
Concentus Musicus
Wien / Nikolaus Harnoncourt,
Leitung
|
|
|
- Alice Harnoncourt, Violine
& Pardessus de Viole |
|
|
- Eva Braun, Josef de
Sordi, Violine |
|
|
- Kurt Theiner, Violine
& Viola |
|
|
- Nikolaus Harnoncourt,
Tenor- & Bass-Gambe |
|
|
- Elly Kubizek, Hermann
Höbarth, Bass-Gambe |
|
|
- Eduard Hruza, Violone |
|
|
- Leopold Stastny, Blockflöte |
|
|
- Jürg Schaeftlein,
Karl Gruber, Bernhard Klebel, Oboe |
|
|
- Otto Fleschmann, Fagott |
|
|
- Georg Fischer, Cembalo |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
Sinfonia-Studio,
Wien (Austria) - 16/21 giugno 1963 |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Gerd
Berg / Christfried Bickenbach /
Ernst Rothe |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- C 91 115 - (1 lp) - durata 59'
05" - (p) 1964 - Analogico |
|
|
Altre edizioni
LP
|
|
EMI
Electrola - 1 C 037-45 574 - (1
lp) - durata 59' 05" - (p) 1964 -
Analogico |
|
|
Edizioni CD |
|
EMI Records Ltd
/ Virgin Classics - 50999
6025112 1 - (1 cd) - durata 59'
05" - (c) 2012 - ADD
EMI Music - 9 28334 2 - (1 cd) -
durata 59' 05" - (p) & (c)
2013 - ADD
|
|
|
Cover |
|
- |
|
|
|
|
Die
Zeit Leopold I. - eine
Epoche Kulturellen
Wohlstandes
Leopold I., der von 1657
bis 1705, also
ungewöhnlich lange, die
Geschicke Österreichs
und darüber hinaus als
römischer Kaiser auch
die eines großen Teils
Europas lenkte, schien
keineswegs vom Schicksal
besonders begünstigt. Es
war die Zeit der Kriege
gegen die Türken, die
1683 vor Wien standen,
die Zeit der ungarischen
Magnatenverschwörung und
gegen Ende seines
Regierungsamtes die
unsichere Epoche des
spanischen
Erbfolgekriegs, die
große Auseinandersetzung
mit den Bourbonen. Dazu
kam die Geißel der Pest,
die im furchtbaren Jahr
1679 unzählige Opfer
forderte. Wahrhaftig, es
war keine Zeit, von der
man sagen könnte, sie
hätte das Blühen der
Künste begünstigt.
Daß diese Dezennien
dennoch zur Epoche
höchsten künstlerischen
Glanzes auf allen
Gebieten wurde, ist
demzufolge in erster
Linie der Persönlichkeit
des Kaisers zu danken,
der weder Kosten noch
Mühe sparte, Wien zum
Zentrum der europäischen
Kultur zu machen. Daß
dieses Zentrum in erster
Linie Zuzug vom Süden
erhielt, gehörte bereits
zur Tradition des
Kaiserhauses, das sich
nicht nur durch Titel
und mancherlei
verwandtschaftliche
Beziehungen mit ltalien
verbunden fühlte,
sondern auch die große
kulturelle Leistung des
Nachbarlandes
respektierte.
Demgegenüber kam das
spanische Element kaum
zur Geltung, und dies
obwohl Leopold als Sohn
einer spanischen
Habsburgerin und als
Gatte der Infantin
Margarete gewissen
Einflüssen von dieser
Seite ausgesetzt war.
Sagte er doch einmal
unwillig: „Die mujeres
espagnoles wollen meinen
Hof ganz spanisch
machen". Nach dem Tode
seiner ersten Gattin
unterblieben weitere
Versuche in dieser
Richtung. Italienisch
wurde zur Hofsprache.
Die zweite Gattin,
Claudia Felicitas von
Tirol, und auch die
dritte, Eleonore
Magdalena von
Pfalz-Neuburg, hatten
dagegen nichts
einzuwenden. Es mag
indessen ihrem Einfluß
zuzuschreiben sein, daß
das deutsche Element am
Hofe nicht völlig in den
Hintergrund trat, was
schon von Zeitgenossen
als absonderlich
bezeichnet wurde, „da in
Österreich diese Sprache
fast in fremden Landen
ist".
Im Zuge der
Italianisierung wurde
Wien eine prachtvolle
Barock-Stadt, eine Stadt
voll von Adelspalästen
und Kirchen. Der Kaiser
ging mit gutem Beispiel
voran und ließ jenen
Teil der Hofburg
erbauen, der noch heute
der Leopoldinische Trakt
genannt wird; er ließ
ferner in einem
südlichen Vorort
(Kaiser-Ebersdorf) ein
Jagdschloß errichten, um
für seinen Sohn Joseph,
der 1690 römischer König
wurde, durch Fischer von
Erlach einen ersten
Entwurf für das
Lustschloß Schönbrunn
herstellen, welches den
alten Bau ersetzen
sollte. Wäre dieser
Entwurf zur Ausführung
gekommen, das neue
Gebäude hätte Versailles
übertroffen. Aber schon
der Plan zeigt, in
welchen Dimensionen die
Bauherren und die
Baumeister jener Zeit zu
denken gewohnt waren.
Der Adel wollte
natürlich hinter dem
Kaiser nicht
zurückstehen: eine ganze
Reihe von Adelspalais,
die - trotz vielfocher
Umbauten im 18.
Jahrhundert - noch heute
das Bild der Stadt Wien
mitbestimmen, entstanden
in der zweiten Hälfte
jenes Jahrhunderts des
österreichischen Barock,
darunter das Palais
Dietrichstein (das
später in den Besitz des
Fürsten Lobkowitz
überging), das Palais
Caprara, das
Liechtenstein-Palais in
der Rossau, das
Stadtpalais der gleichen
Familie, das
Harrach'sche Palais etc.
Die kirchlichen Bauten
waren von nicht
geringerer Zahl: im Zuge
der Gegenreformation,
die aus der
protestantischen Stadt
wieder eine katholische
machte, wurden
zahlreiche prunkvolle
Kirchen erbaut.
Einen Bericht, wie die
Stadt damals aut einen
Fremden wirken mußte,
verdanken wir dem
türkischen Weltenbummler
Evliya Celebi, der 1665
nach Wien kam und mit
echt orientalischer
Phantasie erzählt: „Die
Gebäude innerhalb der
Festung Wien belaufen
sich auf insgesamt
40.000 Häuser und im
ganzen... Paläste außer
der Kaiserburg. Alle
diese Paläste haben fünf
bis sechs Stockwerke. An
jedem dieser Gebäude
gibt es mannigfaltige
Kanzeln und Erker,
Alkoven und Balkone. Die
Räume darinnen sind mit
Einlegearbeiten in
Perlmutter und Gold
verziert und die Säle
mit Edelsteinen
ausgeschmückt. Die Summe
der Fenster an allen
Häusern zusammen beläuft
sich auf nicht weniger
als 200.000. So
berichtete der
Hofschatzmeister, und es
stimmt gewiß, denn bei
den Giauren ist das
Lügen verboten. An den
Wänden der Erker...
hängen verschieden
gestaltete Drahtkäfige,
die selbst wieder kleine
Erker mit mannigfach
geformten Kuppeln
darstellen. Darinnen
werden Nachtigallen und
Papageien und Sittiche
und Amseln und Pirole
und viele andere
Singvögel gehalten. Die
Straßen innerhalb der
Festung sind alle in
geometrischer Ordnung...
und mit sauberen blanken
Steinpflastern bedeckt.
Übrigens dürfen außer
Pferden keinerlei Tiere
in die Stadt gebracht
werden. Wenn einmal ein
Pferd seinen Mist
innerhalb der Stadt
fallen läßt, dann kehren
und fegen die Inhaber
der Kaufläden... diesen
Pferdemist sofort weg.
Nach jedem Regen kommen
sogleich aus allen
Häusern die Buben und
Weiber heraus und fegen
die Straßen wieder
derartig rein und sauber
und spiegelblank, daß
man von ihnen ruhig
Honig auflecken
könnte... Die Zahl der
Kaufläden beträgt
insgesamt 1.500. Sie
liegen nach Zünften
nebeneinander geordnet
und sind derart schön
und reich verziert, daß
dort jeder Kaufmann ein
Vermögen von der Höhe
eines Jahrestributs der
Provinz Ägypten besitzen
muß... Und was nun die
herrlichen Kunstwerke
und wunderbaren Geräte
betrifft, die hier
geschaffen werden, so
haben diese
Handwerkerviertel
nirgends ihresgleichen.
Man stellt dort
Wanduhren mit Schlagwerk
her, die zu den
verschiedenen
Gebetszeiten schlagen...
ferner auch solche, die
auch die Tage, Monate
und Sternbilder
anzeigen... In Wien gibt
es im ganzen 66 Kirchen
mit ihren Patriarchen
und Metropoliten, diesen
schmutzigen Priestern
der Christen. Alle diese
Kirchen... sind Häuser
des Unheils und Stätten
des Unglaubens... Außer
diesen findet man
innerhalb und außerhalb
der Stadt noch 300
kleinere Kirchen. Alle
zusammen werden sie in
den Schatten gestellt
von dem sogenannten
Stephansdom... Nirgends
in der Türkei, in
Arabien, im übrigen
Giaurenreich oder
sonstwo in den sieben
Zonen unserer Erde ist
ein derartig
riesenhafter Bau und ein
solch altehrwürdiges
Kunstwerk errichtet
worden und wird auch
niemals errichtet
werden. Alle Reisenden
der Länder und Meere
meinen, daß diese Kirche
in der ganzen Welt
ihresgleichen nicht
hat... "Vieles ist
sachlich unrichtig in
diesem Bericht, seine
neidvolle Bewunderung
aber spricht Bände.
Die meisten Baumeister,
die für den Prunk der
Metropole sorgten, waren
Italiener, so Carlone,
Coccapani, Canevale,
Martinelli. Auch
Giovanni Burnacini kam
aus Italien. Er wurde
schon von Ferdinand III.
1652 nach Wien geholt,
um bei der Hofburg ein
Theater zu errichten.
Als er drei Jahre später
starb, setzte sein Sohn
Ludovico Burnacini sein
Werk fort. Für den
leidenschaftlichen
Theaterliebhaber Leopold
errichtete er auf der
Cortina, dem Wall vor
der Burg, ein großes
Theater aus Holz. Es war
65 Meter lang, 27 Meter
breit und innen 13 Meter
hoch, besaß drei Ränge
und wirkte höher als es
war, weil ein
illusionistisches
Deckengemälde den
Eindruck einer weiter
nach oben strebenden
Architektur vermittelte.
Mit dem Namen des
Theateringenieurs
Ludovico Burnacini ist
die Hochblüte des
Theaters in der
leopoldinischen Ära auf
das engste verknüpft.
Seine prunkvollen
Inszenierungen genossen
europäischen Ruhm.
Zwischen 1658 und 1705
wurden bei Hofe über 400
Opern- und
Oratorienaufführungen
gegeben.
Opernaufführungen
ergossen festlichen
Glanz über Taufen,
Verlobungen, Hochzeiten,
Geburtstage und über die
Besuche fremder
Fürstlichkeiten: „Mit
ihrer Mischung von
griechischer Mythologie,
Arien, Chören und
BalIetten, mit ihren
szenischen Wundern,
Flugmaschinen, die die
Götter auf die Bühne
schweben ließen, mit
staunenerregenden
Dekoratíonsverwandlungen,
mit Feuerwerken und
Aufzügen, mit
Huldigungen und
Schmeicheleien für das
Kaiserhaus waren solche
Opernaufführungen
farben- und
gestaltenreiche
Schaustücke wie die
großen Deckenfresken in
den neuen Palästen
Wiens, auf denen sich
der Himmel öffnete und
der Olymp sichtbar
wurde, Säulenhallen
aufragten und die Sonne
Wolken beglänzte" (Max
Graf).
Eine dieser Aufführungen
hat Geschichte gemacht:
die sensationelle
Inszenierung von „Il
pomo d'oro" (Der goldene
Apfel) im Jahre 1666 in
Burnacinis Theater auf
der Cortina. Der Anlaß
war die Heirat Leopolds
mit der spanischen
Infantin. Die
Komposition stammte von
Marcantonio Cesti, der
als Vízekapellmeister an
den Hof verpflichtet
worden war. Fünf Akte
mit 67 Szenen waren
vorgesehen, und obwohl
die venezianische Oper
jener Zeit im
wesentlichen Solooper
war, spielte der Chor
eine wichtige Rolle.
Unwahrscheinlich
prunkvoll gab sich die
Inszenierung Burnacinis,
„weIche niemals ist
gesehen worden und
vielleicht auch, weil
die Welt steht, niemals
wird gesehen werden",
wie ein Zeitgenosse
meinte. Im Vorspiel
wurden Macht und Glanz
des Hofes verherrlicht,
in den SäuIenhallen der
Bühne sah man die
Statuen der Habsburger,
in den Wolken ritt der
Österreichische Ruhm,
begleitet von Amor und
Hymen, auf der Bühne
standen die
Persifikationen des
Habsburgerreichs:
Osterreich, Ungarn,
Böhmen, Italien,
Sardinien, Spanien und
Amerika. Nach dem
Vorspiel rollte die
eigentliche Handlung ab:
die Wahl des Paris, der
aber keiner der drei
Göttinnen den Apfel
reicht, sondern der
jungen Kaiserin.
Schauplätze dieses
Theaterfestes waren die
Erde, der Himmel, die
Unterwelt, Tempel,
Höhlen, Wälder,
Säulenhallen, Gärten und
Landhäuser. Burnacini
hatte alle Wunder der
Theatermaschinerie
aufgeboten: Blitz und
Donner, Regen, Hagel,
Furien, Neptun und Venus
auf dem Muschelwagen,
Nereiden, die in Bassins
schwammen, sogar das
Schiff des Paris
inmitten eines Sturms.
Und dies war nur eine
von den großen
Festopern! Das Programm
der Kaiserhochzeit
umfaßte außer dem „Pomo
d'oro", neben
Schauspielen der
Jesuitenbühnen, Komödien
und Bällen noch Cestis
„Neptun und Flora", ein
Ballett von Heinrich
Schmelzer und ein
Rosseballett im inneren
Burghof, „La contesa
dell'aria e del'aqua"
(„Wettkampf zwischen
Luft und Wasser") mit
Musik von Bertali und
Schmelzer. Draghis „La
monarchia latina
trionfante" zählte
ebenfalls zu den
Festopern.
Auch in späteren Jahren,
vor allem aber nach dem
siegreichen Zurückwerfen
der Türken, erfüllte
Musik alle Ereignisse
bei Hof. Opern,
Ballette, Oratorien -
diese in der Fastenzeit
- folgten einander in
dichter Folge. Viele der
Aufführungen fanden auch
auf den kaiserlichen
Sommerschlössern statt,
so etwa Draghis „II
templo di Diana" im Park
von Schönbrunn.
Neben solchen
prunkvollen
Inszenierungen gab es
auch kleinere „Feste in
camera" und unzählige
andere
Musikveranstaltungen im
engeren Kreis der
Herrscherfamilie. Denn
der Kaiser war ein
echter Kenner und
Liebhaber der Musik. Wie
sein Vorgänger Ferdinand
III. und wie seine
Nachfolger Joseph I. und
Karl VI. komponierte er
selbst, und das nicht
etwa nur gelegentlich.
Wolfgang Ebner,
Athanasius Kircher und
Johann Heinrich
Schmelzer waren ihm
dabei Helfer, sei es,
daß sie Begleitstimmen
aussetzten, sei es daß
sie die Komposition
aufführungsreifmachten.
Ein Katalog in der
Wiener
Nationalbibliothek
verzeichnet eine lange
Reihe von Kompositionen
des Kaisers: 79
Kirchenwerke, darunter 8
Oratorien, 155 weltliche
Werke, zahlreiche
Einlagen für Opern und
Oratorien, 9 Festi
teatrali und 17 Bände
Balletti, von denen 102
Tänze erhalten sind.
Unter den Theatermusiken
sind Kompositionen zu
deutschen Singspielen
und sogar zu
Dialektstücken
bemerkenswert. Sie
erregten schon damals
Aufsehen.
Wie sehr das ganze
Musikleben seiner Zeit
vom Kaiser persönlich
Impulse erhielt, geht
aus einem Dokument
hervor, das zwei Jahre
nach dessen Tod in Köln
veröffentlicht wurde. Es
stammt aus der Feder
eines ehemaligen
kaiserlichen Hauptmannes
namens Rink. Dieser
Kaiser, so schreibt er,
„ist ein großer Künstler
in der Musik. Hier ist
der Ort, wo man
weitIäufig zu reden
Ursache hat, denn wo
etwas in der Welt
gewesen, so dem Kaiser
Vergnügen gemacht, so
war es unfehlbar eine
gute Musik. Diese
vermehrete seine Freude,
diese verminderte seine
Kümmernis, und man kann
von ihm sagen, daß er
unter allen
Lustbarkeiten keine
vergnügtere Stunde
gehabt, als die ihm ein
wohleingerichtetes
Konzert gemacht. Man
kunnte dieses
absonderlich in seinen
Zimmern sehen. Denn wie
er das Jahr viermal zu
changieren pflegte,
nämlich aus der Burg
nach Laxenburg, von da
in die Favorita und dann
nach Ebersburg, so war
in einem jedweden
kaiserlichen Zimmer
allezeit ein kostbares
Spinett befindlich,
darauf der Kaiser
allezeit seine müßigen
Stunden, wenn er von
anderen Geschäften sich
in dos Gemach
reterierte, zubrachte.
Seine Kapelle kann wohl
die vollkommenste in der
Welt genennet werden;
und dieses ist gar kein
Wunder, nach dem der
Kaiser allemal selbst
das Examen anstellete,
wenn einer darinnen
sollte angenommen
werden, da denn blos
nach Meriten und nicht
nach Neigungen geurteilt
ward. Wann alle Kollegia
in Wien auf solche Art
untersucht und besetzt
worden, so ist kein
Zweifel, Wien wäre ein
Paradis auf Erden, ein
Sammelplatz der
Gerechtigkeit, der
freien Künste und aller
Tugenden gewest. Man
kann aus der Menge der
erfahrensten Künstler
urteilen, wie hoch sie
dem Kaiser muß zu stehen
kommen. Denn viele unter
diesen Leuten waren
Barons und hatten solche
Besoldung, daß sie ihrem
Stande gemäß leben
konnten... Nächst der
Musik liebte er die
singenden oder Opern,
worinnen die Musik ihre
höchste Kraft erweist,
über die Massen. An
keinem Orte der Welt
sind jemals prächtigere
Opern präsentiert
worden, als in Wien. Bei
den kaiserlichen
Vermählungen und anderen
Solennitäten sind
absonderlich die
berühmten Opera ,Pomo
d'oro', ,ll Fuoco
Vestale' und ,La
Monarchia Latina' in
solcher Pracht
vorgestellt worden, daß
man versichert, es habe
alleine ,Pomo d'oro'
über 100.000 Reichstaler
gekostet, wobei aber
noch dieser Vorteil, daß
sie ein ganzes Jahr
durch mit Zulassung
aller Leute präsentiert
worden. Dieses ist sonst
bei den kaiserlichen
Opern nicht gemein,
angesehn eine Opera,
welche gar öfters
10-20.000 Gulden
konsumieret, nur ein
einziges mal zu sehen;
welches ein solcher
kostbarer Aufgang, daß
kein anderer Potentat in
der Welt solches gleich
tut; zumal, da fast bei
allen Geburts- und
Namentägen der
Herrschaften neue
Erfindungen aufgeführt
worden...
Wenn der Kaiser in einem
Konzert dieser seiner
allezeit
unvergleichlichen
Kapelle war, so fand er
sich so vergnügt dabei,
mit einer solchen
unendlichen Attention,
als wenn er sie dieses
und zum allerersten mal
hörte. Und in einer
Opera wird er nicht
leicht ein Auge von der
in Händen habenden
Partitur weggewendet
haben, so genau
observierte er alle
Noten. Wenn eine
besondere Passage kam,
die ihm gefiel, drückte
er die Augen zu, mit
mehrerer Attention
zuzuhören. Sein Gehör
war auch so scharf, daß
er unter Fünfzig
denjenigen merken
kunnte, welcher einen
Strich falsch getan."
So wie die Baumeister
waren auch die Musiker
der leopoldinischen Ära
überwiegend Italiener.
Antonio Bertali und
Felice Sances wirkten
schon unter Ferdinand
III. Marcantonio Cesti,
der den „Pomo d'oro"
komponierte, war eine
Berühmtheit seiner Zeit,
in noch höherem Maße
vielleicht Antonio
Draghí, der seit 1661
bis zu seinem Tode im
Jahre 1699 für den
Wiener Hof nicht weniger
als 172 Opern,
Festspiele, Serenaden
sowie 42 Oratorien und
Kantaten schrieb. Die
Festoper zur zweiten
Vermählung des Kaisers
im Jahre 1674 stammt von
ihm: „Il fuoco eterno
custodito dalle
Vestali". Für die
meisten seiner Texte
sorgte der ebenfalls aus
Italien stammende
Hofpoet Nicolo Minato.
Am Aufbau der Oper
hatten auch die
Kapellmeister der
Kaiserinwitwe Eleonore,
Joseph Tricarico und P.
A. Ziani, großen Anteil.
Daneben fanden die
nicht-italienischen
Musiker ein
entsprechendes
Arbeitsfeld, freilich
nicht so sehr auf dem
Gebiet der höfischen
Oper, wo lediglich
Johann Heinrich
Schmelzer zur
Komposition von
BaIIett-Einlagen
zugelassen wurde. Das
Jesuitentheater
hingegen, das in den
Nebenhandlungen
opernhaft ausgebreitet
war, besaß in Johann
Kaspar Kerll, Ferdinand
Tobias Richter und
Bernardus Staudt
tüchtige Komponisten
(nicht anders als das
Theaterwesen in Salzburg
in Andreas Hofer.
Gottlieb Teofil Muffat
und Heinrich Ignaz Franz
Biber). Es waren nicht
zuletzt diese Meister
deutscher Zunge, die
eine bemerkenswerte
Spätblüte der
Instrumentalmusik
hervorriefen. Von
Schmelzer her
entwickelte der aus
Böhmen stammende Biber
eine durchaus lokal
gebundene, in ihrer
Eigenart höchst
fesselnde Art des
vollgriffigen
Violinspiels. Schmelzer
selbst hat die lokale
Note seiner Ballette und
Instrumentalwerke durch
Aufnahme von
Volksmelodien
unterstrichen. Eine
Wiener Klavierschule
geht auf Wolfgang Ebner
zurück, findet in Johann
Jakob Froberger ihre
bodenstöndigste Form und
in dem Italiener
Alessandro Poglietti,
der bei der
Türkenbelagerung ums
Leben kam, einen
originellen Adepten.
Französische Elemente,
die in den offiziellen
Opern zugleich mit der
Sprache aus politischen
Gründen verbannt waren,
konnten in der
lnstrumentalmusik
unbemerkt Eingang
finden. Aber auch hier
wor der italienische
Einfluß, wie er etwa von
dem Kapellmeister an San
Marco in Venedig,
Giovanni Legrenzi,
ausgeübt wurde,
vorherrschend.
Das Ende der
leopoldinischen Epoche
stand keineswegs im
Zeichen des Verfalls. Im
Gegenteil: Wissenschaft
und Kunst erlebten
gerade in den letzten
Jahren Kaiser Leopolds
einen Auftrieb, der über
die Epochen Josephs I.
und Karls VI. hinweg bis
in die
Maria-Theresianische
Zeit fortwirkte, ja
letzten Endes mithalf,
das Klima vorzubereiten,
in dem dann die Wiener
Klassik gedeihen sollte.
Der Kaiser selbst
gründete die
Gesellschaft für
Noturforschung; er stand
mit Leibnitz in
Verbindung und sammelte
Partituren musikalischer
Meisterwerke. Fischer
von Erlach und Lukas
Hildebrandt konnten sich
gegen die italienische
Konkurrenz behaupten und
schmückten Wien mit
neuen Gebäuden, an
Stelle derer, die im
Türkenjahr 1683 zerstört
worden waren. Die
Mehrzahl der großen
Bauten des Hochbarocks
wurden erst unter Karl
VI. vollendet, ihre
Fundamente indes waren
noch um 1700, in der
Zeit Leopolds, gelegt
worden.
Nicht anders stand es
mit der Musik. Die
Meister der
leopoldinischen Epoche
fanden ihre Nachfolger,
die italienischen wie
die deutschen. Und
Johann Joseph Fux, der
unter Karl VI. zur
höchsten Würde des
Hofkapellmeisters
gelangte, hat in dieser
Funktion im 18.
Jahrhundert gleichsam
den Schlußstrich unter
die österreichische
Borockmusik gezogen, die
trotz des starken
italienischen Einflusses
stets ihre lokale Note
zu wahren wußte. Auch
dieser Meister wurde
durch die direkte
Einflußnahme Leopolds an
den Wiener Hof gezogen.
Als er „noch in Diensten
eines ungarischen
Bischofs war, hörte der
Kaiser dort eine noch
unbekannte Messe von
Fux, die ihm sehr wohl
gefiel. Bey der Tafel
fragte der Kaiser um den
Nomen desjenigen, der
die Messe komponiert
habe. Fux wurde
herbeigerufen. Der
Kaiser lobte ihn und
nahm die Messe mit"
(Friedrich Daube:
„Anleitung zur
Komposition", Wien
1797/98). Den Organisten
der Wiener
Schottenkirche hat dann
1698 Leopold I. zum
Hofkompositor ernannt
und so für die
Kontinuität eines Werkes
gesorgt, das lange über
den zeitlichen Wandel
hinaus fortwirken
sollte.
Rudolf
Klein
Französische und
italienische Einflüsse
auf die Wiener
Barockmusik
Wien als Metropole der
Musik. Ein Begriff, der
jedem Musikfreund durch
die im heutigen
Konzertleben
dominierende Stellung
der drei Großmeister der
Wiener Klassik geläufig
ist. Nur wenigen dürfte
es aber klar sein, daß
sich hier schon lange
vor dieser Zeit eine
musikalische Metropole
ersten Ranges befand.
Freilich, die weltweite
Ausstrahlung der Wiener
Musik war ein Geschenk,
das dieser Stadt nur
einmal beschieden war.
Eines der merkwürdigsten
Phänomene der
Musikgeschichte ist wohl
die Konzentration der
wesentlichsten
stilbildenden und
schöpferischen Kräfte
auf bestimmte, deutlich
abgegrenzte Länder oder
Landschaften. Ohne
erkennbaren Grund bilden
sich einmal hier, einmal
dort Zentren von
weltweiter Strahlkraft,
die nach einigen
Generationen höchster
schöpferischer Potenz
wieder, wie ausgebrannt,
zum Normalniveau
zurücksinken. So hat
fast jedes europäische
Land einmal, manches
sogar mehrmals, seine
,große Zeit' in der
Musik gehabt. Diese
musikalischen
Mittelpunkte waren
durchaus nicht immer
zugleich die großen
politischen Mittelpunkte
der Zeit (wenn es auch
hier oft enge
Wechselbeziehungen
gibt). So fällt zum
Beispiel die große Blüte
der niederländischen
Musik um 1500 zusammen
mit größter politischer
Macht- und
Prachtentfaltung des
französischen
Königshofes Ludwigs XII.
und des
römisch-deutschen
Kaiserhofes Maximilians
I. Wenn auch Wien als
eines der ältesten
Kulturzentren im
deutschen Raum und als
Residenz sowohl der
Babenberger als auch der
Habsburger schon seit
jeher ein reiches
Musikleben hatte,
erhielt dieses doch
lange Zeit seine
entscheidenden Impulse
von auswärtigen
Künstlern, bevor es die
eigene, entscheidende
Aussage fand. Drei
Jahrhunderte lang war
Wien ein Schmelztiegel
der verschiedenartigsten
Stilrichtungen. Die
Exponenten der
jeweiligen
schöpferischen
Brennpunkte kamen hier
im Laufe der
Jahrhunderte auf
gewissermaßen neutralem
Boden zusammen;
niederländische und
italienische, englische
und französische Musiker
konnte man hier hören.
Durch den engen Kontakt
mit der slawischen und
magyarischen Welt kamen
östliche Einflüsse dazu.
So konnte die natürliche
musikalische Veranlagung
der Wiener, der
Österreicher überhaupt,
durch diese Begegnung
mit der ganzen
musikalischen Welt nach
und nach einen alle
Formen in sich
schließenden eigenen
Stil finden. Die sehr
starke musikalische
Folklore Österreichs,
Ungarns und Böhmens
spielte dabei von Anfang
an eine bedeutende
Rolle. Es war zur Zeit
Leopolds I., in der
zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts, daß
einheimische Meister wie
Schmelzer und Fux
erstmalig die Führung
der Hofkapelle
übernahmen, daß
unverkennbar wienerische
und österreichische
Musik komponiert wurde.
Durch die engen
politischen Verbindungen
mit Italien kam die
Oper, die große
musikalisch-dramatische
Novität des beginnenden
17. Jahrhunderts, nach
Wien, wo sie sofort eine
begeistert gepflegte
Heimstätte fand. Wien
wurde im 17. Jahrhundert
eines der prunkvollsten
Zentren der
italienischen Oper.
Nahezu alle bedeutenden
italienischen
Opernkomponisten haben
hier gewirkt. In ihren
Opern konnte man aber
auch viel reine
Instrumentalmusik hören:
außer den von eigenen
Ballettkomponisten
geschriebenen
Tanzeinlagen gab es noch
instrumentale
Zwischenspiele, oft
wurden auch
Instrumentalkonzerte
eingestreut. Die
Tanzeinlagen waren meist
in Anlehnung an
französische Vorbilder
gestaltet, viele Tänze
indes verwendeten
bodenständiges
Melodiengut, wie schon
aus manchen Titeln wie
,Steyermärker Horn',
,Gavotta tedesca',
,styryaca', ,Böhmischer
Dudelsack' und anderen
hervorgeht. Die
instrumentalen
Zwischenspíele aber
wurden von den
italienischen
Opernkomponisten selbst
geschrieben. Sie wurden
als ,Sonata' bezeichnet
und waren vor allem bei
den älteren Komponisten
meist fünfstimmig. Ihre
Form leitet sich direkt
von der alten
italienischen ,Canzon da
sonar' ab. Man darf
diese vielstimmigen
,Sonaten' also nicht mit
der klassischen Sonate
für ein Soloinstrument
verwechseln. - Die
italienischen
Opernkomponisten
versorgten auch die
Wiener Hauptkirchen mit
Kirchenmusik. So waren
natürlich die
einheimischen
Komponisten wie
Schmelzer, Fux und Biber
mit der italienischen
Schreibart aller Arten
von Musik bestens
vertraut.
In Frankreich wurde die
italienische Oper nicht
übernommen. Hier hatte
sich eine eigene
tänzerische Gattung des
Musikdramas gebildet,
das ,Ballet de cour'.
Aus diesem entwickelte
Lully in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts
die typisch französische
Oper. Sie unterscheidet
sich von der
italienischen vor allem
durch eine viel stärkere
Betonung des Formalen,
des streng Tänzerischen,
der strengen
Wortgebundenheit der
Musik. Rein musikalische
Nummern, in denen der
Text eine untergeordnete
Rolle spielt, wie die
Arien der italienischen
Oper, gibt es nicht; die
Instrumentalstücke sind
durchweg Tänze. Lullys
Reformen der
französischen Oper
hatten, vor allem was
den Stil und die
Spielweise des
Orchesters betrifft, in
ganz Europa größtes
Aufsehen erregt. Die aus
seinen Opern entnommenen
Instrumentalsuiten mit
ihrer neuen Form der
Ouvertüre und den
graziösen französischen
Tänzen erfreuten sich
nicht nur in Paris
höchster Beliebtheit;
sie wurden bald auch
überall in Deutschland
und England nachgeahmt.
Die präzise
kurzstrichige Spielort
von Lullys Geigern, die
zur richtigen Wiedergabe
französischer Musik
unbedingt erforderlich
ist, war vom kantablen
Legatospiel der
Italiener himmelweit
entfernt. Viele
deutschen Kapellen
ließen sich französische
Musiker kommen.
Italienische Geiger
weigerten sich
mancherorts,französische
Musik zu spielen. Auch
in Wien hatte man die
Bekanntschaft mit der
neuen französischen
Musik schon sehr früh,
etwa um 1665, gemacht.
Zu Leopolds Zeit waren
also die stilistischen
Gegenpole in der
Instrumentalmusik die
französische Suite und
die italienische Sonata.
Die französische Suite
war genau genommen die
Nachahmung der aus den
Opern Lullys stammenden,
außerordentlich
beliebten Tanzsuiten als
selbständige
Kompositionsgattung
durch andere
Komponisten; Lully
selbst hat nie ,Suiten'
geschrieben. Die
italienische Sonata war
ein formal freies, aus
der alten Canzon da
sonar entwickeltes
einsätziges
Instrumentalstück. Die
andernorts unvereinbare
Gegensätzlichkeit dieser
beiden Richtungen wurde
in Österreich von
genialen Komponisten wie
Muffat, Fux und Biber zu
einer neuen,
faszinierenden Einheit
verschmolzen.
Muffat hat sich als
einziger zu diesen
Stilfragen geäußert,
deshalb wollen wir ihn
kurz herausgreifen, auch
wenn er auf dem Programm
der Platte nicht
erscheint: Er hatte in
Paris bei Lully
studiert, war dann an
den Wiener Hof gekommen,
wo er von Leopold I.
gefördert wurde, und
ging als Hofkomponist
des Erzbischofs nach
Salzburg. Er bezeichnete
sich selbst als den
ersten „LulIysten"
Deutschlands. Der
Salzburger Erzbischof
sandte ihn aber zur
weiteren Vervollkommnung
nach italien. Dort
schrieb er Concerti
grossi in der Art
Corellis, in deren
Vorwort er die schönen
Worte schrieb: „...da
ich mich beflissen die
Tieffsinnige
ltalianische Affecten
mit der frantzösischen
Lustbar- und
Lieblichkeit dergestalt
zu bemäßigen, daß weder
jene zu Dunckel +
auffgeblasen, noch dise
zu frey + außgelassen
seyn möchten. Solches
ist ein fügliches
Sinnbild Euer Hoch
Gräfflichen Gnaden hoch
erhobenen Tugend =
Gemüths... Diser
sinnreichen Vermischung
erste Gedancken hab ich
vor Zeiten zu Rom
gefast, allwo unterm
weltberühmbten Hrn.
Bernardo Pasquini, ich
die Welsche Manier auff
dem Clavier erlernet, da
ich etliche dergleichen
schön = und mit großer
Anzahl Instrumentisten
auffs genaueste
producirten Concerten
vom Kunstreichen Hrn.
Archangelo Corelli mit
großem Lust und Wunder
gehört...". In der
Widmung zum Florilegium
Primum schreibt
er: "...Gleich wie
aber deren Pflantzen und
Blumen Vielfältigkeit
der Gärten erste
Anlockung ist, und
großer Helden
Fürtrefflichkeit auß
vielen zwar, doch
gemeiner Glückseeligkeit
halber ineinander
treffenden Tugenden
erscheinet; so habet
erachtet, daß zu Euer
Hoch-Fürstl. Gnaden
unterthänigstgebührender
Bedienung, nicht
einerley, sondern
verschiedener Nationen
beste zusammengesuchte
Art sich geziemen würde.
Von Euer Hoch-Fürstl.
Gnaden, durch Deren Höfe
und Geschöfften langen
Erfahrenheit
vollkommenster Verstand
beförchte ich gar nicht
boßhaffter, oder aber
schwacher Gemüther
vermessenes Anfallen,
mit welchen, um weilen
ich in Frankreich von
denen in diser Kunst
erfahrnesten Meistern
meinen Anfang genommen,
mich dahero besagter
Nation mehr als billich
zugethan, und zu diesen
Französischen
Krigszeiten der
Teutschen günstigere
Gehör unwürdig,
freventlich urtheilen.
Ich hat warlich andere
Gedancken als: Aere
ciere viros, Martemque
accendere cantu: Die
kriegerische Waffen und
ihre Ursachen seyn ferne
von mir; Die Noten, die
Seiten, die liebliche
Musik-Thonen geben mir
meine Verrichtungen, und
da ich die Französische
Art der Teutschen und
Weischen einmenge,
keinen Krieg anstiffte,
sondern vielleicht derer
Völcker erwünschter
Zusammenstimmung, den
lieben Frieden etwann
vorspiele...".
Muffat war also der
erste, der die beiden
feindlichen Stile bewußt
und geradezu mit
europöisch-versöhnlicher
Symbolik verbunden hat.
Diese Versöhnlichkeit
will angesichts der
bitteren politischen
Feindschaft zwischen
Ludwig XlV. und Leopold
I., die durchaus
imstande gewesen wäre,
auch die
,Kulturfeindschaft'
zwischen so
verschiedenen Völkern zu
vertiefen, verstanden
sein. Die engen
Verbindungen Muffats zum
Wiener Hofe sowie die
Zusammenarbeit mit
seinem Salzburger
Vizekapellmeister Biber
führten schließlich zu
einer friedlichen
Vereinigung der
italienischen und
französischen Form im
österreichischen
Musikleben. Muffat war
natürlich nicht der
Einzige, durch den
französische Musik an
den Wiener Hof gelangte.
Es gab eine große Zahl
reisender Solisten, die
das Neueste aus ihrer
Heimat überall
bekanntmachten; außerdem
muß die kaiserliche
Kapelle selbst auf ihren
Reisen die
französisierten Kapellen
Süddeutschlands
kennengelernt haben.
Wenn auch Leopold selbst
der rein französischen
Schreibart, besonders in
der Tanzmusik,
ablehnend
gegenüberstand, so haben
doch seine Komponisten
nach und nach viele
französische Elemente
ihrem Stil einverleibt.
Bei vielen der von
Muffat, Fux, Biber und
anderen komponierten
Suiten erkennt man die
italienische Schule in
ihren Einleitungssätzen
(Sinfonia), auch
gelegentlich in formal
französischen
Ouvertüren. Zwischen die
meist französisch
beeinflußten Tanzsätze
flochten sie gerne
freie, häufig langsame
Sätze italienischer
Schreibart ein. In
vielen Suiten finden
sich darüber hinaus noch
- gleichsam als Würze -
frische Tänze, die
unverkennbar von der
bodenstündigen Folklore
inspiriert sind. Diese
typisch österreichischen
Suiten sind nun aber
keineswegs ein
scheckiges Konglomerat
verschiedenartigster
Stile - die große
Leistung der Komponisten
besteht gerade darin,
aus diesen
vielschichtigen
Elementen und Einflüssen
Neues, ein vollgültiges
Ganzes gemacht zu haben.
Alle österreichischen
Komponisten von
Instrumentalmusik zur
Zeit Leopolds I.
schrieben Sonaten und
Suiten. Sie pflegten
also, im Gegensatz zu
ihren italienischen und
französischen Kollegen,
sowohl den einen wie den
anderen Stil. Allerdings
übernahmen sie von
beiden in erster Linie
die Form, wöhrend sie in
der Thematik oft
deutsche, ungarische und
böhmische Elemente zu
Wort kommen ließen. So
beginnt zum Beispiel
eine der Sonaten aus
Schmelzers ,Concentus'
mit typischen, heute
noch wohlbekannten
Czardasphrasen, und die
(französischen) Suiten
aller österreichischen
Komponisten sind von
ganz unfranzösischen
Tänzen und Themen
durchsetzt.
Zusammenfassend könnte
man sagen, daß in Wien
der italienische
Geschmack wohl offiziell
vorherrschend war, daß
aber durch die
Verbindung der
italienischen und
französischen Schreibart
mit dem natürlichen
Musikantentum der
Österreicher ein neuer,
typischer Stil entstand.
Nikolaus
Harnoncourt
Wiener
Köpfe von
Nikolaus Harnoncourt
Johann
Joseph Fux (1660-1741)
Johann Joseph Fux ist
dem heutigen Musikfreund
vor allem als
Theoretiker bekannt,
galt doch sein Lehrwerk
„Gradus ad Parnassum"
zweihundert Jahre lang
als das Standardwerk des
strengen Satzes. Der
Komponist Fux ist heute
nahezu unbekannt,
gelegentlich wır sein
angeblich
trocken-lehrhafter Stil
kritisiert, wohl weil
man dem berühmten
Theoretiker keine
blutvolle Musik zutraut.
Dabei ist Fux schon
durch seine Herkunft
alles eher als ein
Gelehrtentyp. Seiner
Karriere haftet bis
heute etwas Rätselhaftes
an: als Kind eines
Bauern in einem kleinen
steirischen Dorf 1660
geboren, kam er schon
als ausgebildeter
Musiker nach Wien. Sein
Kompositionsstil läßt
einen Lehraufenthalt in
Italien vermuten. 1696
war er Organist der
Wiener Schottenkirche,
1698 ernannte ihn
Leopold I. zum
Hofkompositeur (ein
eigens für ihn
geschaffener Titel),
1713 wurde er
Vizekapellmeister, 1715
erreichte er das höchste
Amt der damaligen
Musikwelt, er wurde
kaiserlicher
Hofkapellmeister und
blieb es bis zu seinem
Tode 1741. Obwohl er
sich eine umfassende
humanistische Bildung zu
verschaffen gewußt hatte
- sein „Gradus“ ist in
glänzendem Latein
geschrieben -, war er,
mindestens in jungen
Jahren, ein
leidenschaftlicher
Vollblutmusiker. Im
Vorwort des „Gradus"
sagt er über sich:
"...zur Zeit, als ich
noch nicht im vollen
Gebrauch meiner Vernunft
war, wurde ich durch die
Heftigkeit ich weiß
nicht welches Triebes
hingerissen, es richtete
sich all mein Sinnen und
Trachten auf die Musik
und auch jetzt bin ich
von einer beinahe
wunderbaren Begierde sie
zu erlernen durchglüht
und wie willenlos dahin
gedrängt; Tag und Nacht
scheinen meine Ohren von
süßen Klängen umtönt zu
werden, so daß ich an
der Wahrheit meines
Berufes durchaus keinen
Grund zu zweifeln habe."
Da er in seinem Alter
noch immer an der
strengen Gesetzmäßigkeit
der hochbarocken Musik
festhielt, wurde er von
der jungen
Komponistengeneration
als lebendes Monument
der Vergangenheit
betrachtet. Seine
Persönlichkeit muß von
bezwingender
Aufrichtigkeit des
Charakters gewesen sein.
Scheibe, ein
Musikliterat des 18.
Jahrhunderts, schrieb
über ihn: „Seine Tugend
und seine Klugheit
erwarben ihm die
Freundschaft des ganzen
Hofes; und seine Feinde
selbst konnten ihn nicht
hassen, ohne ihn
zugleich zu bewundern".
Fux komponierte alles:
Messen, Kantaten, Opern
und Instrumentalmusik.
Den ,Concentus musica
instrumentalis' widmete
er im Jahre 1701 dem
späteren Kaiser Joseph
I., der auch die
Druckkosten bestritt.
Diese Sammlung von
Instrumentalsonaten und
Suiten gehört zum
Besten, was Fux
geschrieben hat. Alle
diese Stücke sind von
einer jugendfrischen
Vitalität. Hier gibt es
keine überfeinerten
Spielereien: man meint
bäurisch-gesunde
Herzhaftigkeit zu
spüren. Fux selbst will
die Suiten dieser
Sammlung als ,leichte
Kost' verstanden wissen,
sagt er doch in seinem
Vorwort allzu
bescheiden: „...Hier
hast Du, lieber Leser,
meinen Concentus Musico
Instrumentalis, der
nicht zu dem Ende
herausgegeben wurde, um
Dir eine Probe eines
großen Kunstwerkes zu
liefern, sondern damit
ich Zuhörern, die keine
Musik verstehen - und
deren ist ja der größte
Teil -, eine
Befriedigung
verschaffe".
Die Sinfonia II aus dem
,Concentus' ist eine
großangelegte
Orchester-Suite. Der
Einleitungssatz ist
nicht wie in den meisten
Suiten der Zeit, eine
französische Ouverture,
sondern eine
italienische Sonata; der
Titel ,Sinfonia' bezieht
sich wahrscheinlich auf
diesen Satz. Die
Bezeichnung des nächsten
Satzes ,Libertein'
könnte (nach Liess)
Libertin = der
Freidenker, bedeuten.
Die übrigen Sätze
Entrée, Menuet,
passepied und Ciacona
folgen weitgehend dem
französischen
Form-schema, wenn man
auch dem Menuet die enge
Verwandschaft zum
steirischen ,Ländler'
deutlich anmerkt. Die
lnstrumentation der
Suite ist für jene Zeit
bemerkenswert: die Oboen
und das Fagott dienen
nicht nur zur
Verstärkung und Färbung
des Streicherchores,
sondern treten immer
wieder allein als
Soloterzett in
Erscheinung.
Der Sinfonia VII aus
derselben Sammlung,
einem Trio für
Blockflöte, Oboe und
Basso continuo liegt als
Programm der Streit des
französischen mit dem
italienischen Stil
zugrunde. Dabei vertritt
das damals moderne
französische Instrument,
die Oboe, den
französischen Stil, die
alte Blockflöte den
italienischen. Während
im ersten
(italienischen) und im
zweiten (französischen)
Satz beide Instrumente
noch einträchtig
musizieren, versteift
sich im nächsten Satz
jedes auf seinen eigenen
Stil: während die Oboe
mit dem Baß eine
typische Air française
im alla-breve-Takt
spielt, musiziert die
Flöte unbekümmert ihre
Aria italiana im
6/8-Takt dazu. Dieser
Satz ist ein besonders
schön klingendes
Dokument für die
Vereinigung der Stile
auf Wiener Boden. Der
letzte Satz, „die
verwirrten Feinde", ist
ein witziger und
ausgelassener Abschluß
des Kunststreites.
Giovanni Legrenzi
(1626-1690)
Giovanni Legrenzi war
einer der auch außerhalb
seiner Heimat
berühmtesten Komponisten
seiner Zeit. Die Namen
seiner Lehrer sind heute
nicht mehr
festzustellen. Als
junger Musiker ließ er
sich in Bergamo nieder,
wo er auch zum Priester
geweiht wurde. 1657 ging
er als Kapellmeister
nach Ferrara, 1665 nach
Venedig, wo er bis zu
seinem Tode im Jahre
1690 blieb. Bevor er
ohne feste Anstellung
nach Venedig ging,
versuchte er sich eine
für sein Alter
angesehene und gut
bezahlte Stellung zu
verschaffen. Sein Ziel
war ein
Kapellmeisterposten in
Wien, den er aber, trotz
vermittelnder Hilfe des
Mantuaner Herzogs und
seines Wiener
Botschafters nicht
bekommen konnte. In
Venedig wurde er
Vizekapellmeister und
1685 erster
Kapellmeister an der
Markuskirche.
Schon von 1654 an ließ
er in Venedig eine große
Zahl seiner
Instrumental- und
Kirchenkompositionen
veröffentlichen.
Legrenzi fühlte sich als
Komponist überall zu
Hause: seine
Instrumentalwerke - von
der Solosonate bis zu
vielstimmigen
Kompositionen - waren
wohl die lebendigsten
und originellsten seiner
Zeit. Berühmt wurden
überdies seine
zahlreichen Opern, auch
Oratorien, Messen und
Kantaten. Auf allen
Gebieten galt er als
besonders einfallsreich,
originell und vital. Als
Lehrer besaß er einen
großen Einfluß. Unter
seinen Schülern befanden
sich spätere
Berühmtheiten wie
Antonio Lotti, Antonio
Caldara (der spätere
Wiener Hofkapellmeister)
und Domenico Gabrieli.
Legrenzis Bedeutung ist
heute kaum noch
abzuschätzen, weil nur
ganz wenige seiner
Kompositionen im
Neudruck zugänglich und
vor allem seine
Hauptwerke nur wenigen
Eingeweihten bekannt
sind. Die
Instrumentalwerke zeigen
eine unmittelbare
Fortsetzung der
venezianischen
Canzonentradition. In
seiner Leopold I.
gewidmeten Sammlung von
Instrumentalstücken „La
Cetra", die er 1673
herausgab, gibt es neben
,normalen'
Streicherbesetzungen
Sonaten für vier
Violinen und zwei
Sonaten für vier Viole
da Gamba. Diese
Besetzung ist für
Italien ungewöhnlich.
Die Violine und die
Viola da Gamba sind vom
Anfang ihrer Existenz an
extreme Gegensätze.
Beide Typen wurden schon
im 16. Jahrhundert zu
einem vollgültigen Chor
vom Baß zum Diskant
ausgebaut.
Die Violinen waren in
Quinten gestimmt, hatten
keine Bünde, niedrige
Zargen, gewölbten Boden
und von Anfang an einen
dynamischen,
extrovertierten Ton. Die
Gamben dagegen waren in
Quarten gestimmt wie die
Gitarre, hatten Bünde
wie diese, hohe Zargen
und einen flachen Boden;
ihr Ton war silbrig und
durchsichtig,
unmateriell und in sich
gekehrt. Die dynamischen
Möglichkeiten der Gambe
erschienen viel geringer
als die der Geige. Die
Geige war das Instrument
der großen
Festlichkeiten, die
Gambe das der intimen
Salons. In ihrer
Vorliebe für bestimmte
Instrumente verraten die
Völker charakteristische
Eigenschaften. So wurde
die Geige das Medium
italienischen
Musizíerens par
excellence,wöhrend die
Gambe besonders in
England und Frankreich
viele Anhänger fand.
Als Kapellmeister der
Markuskirche veränderte
und erweiterte Legrenzi
die Besetzung des
Orchesters, um ein
Optimum an klanglicher
Farbigkeit zu erzielen,
und beschäftigte dabei
auch, gegenüber 21
Instrumenten der
Violinfamilie, 3 Viole
da Gamba. Legrenzis zwei
Sonaten dürfen wohl das
Einzige sein, was in
Italien für
Gambenquartett
geschrieben worden ist.
Fast unglaublich, mit
welch genialer
Sicherheit der Komponist
die technischen und
klanglichen
Besonderheiten dieser
unitalienischen
Besetzung erfaßt hat und
auf italienische Art zur
Geltung bringt!
Die auf dieser Platte
gespielte Sonate (Nr. 5
der Sammlung) beginnt
mit einem fugierten
getragenen Sätzchen,
dessen Schreibweise von
den englischen Fantasien
für Gambenensemble
inspiriert sein könnte.
Das folgende homophone
Adagio im a
cappella-Stil der
Palestrina-Zeit bringt
den samtenen Glanz und
den Verschmelzungsklang
des Gambenchores
wunderbar zur Geltung.
So wird in ständigem
Wechsel zwischen
fugierten und homophonen
Abschnitten jede
Möglichkeit der
Besetzung ausgenützt. In
einem Presto-Mittelteil
in 3/4-Takt wird
ausdrücklich dynamische
Schattierung verlangt.
Die Sonata schließt mit
einem schnellen
Abschnitt im 3/2-Takt,
in dem sich zwei
verschiedene Motive in
streng kontrapunktisch
gearbeitetem
Wechselspiel
gegenüberstehen. Dabei
scheut Legrenzi
keineswegs
stimmführungsmäßig
bedingte Härten im
harmonischen
Zusammenklang. Auch dies
ist eine bekannte
Eigenschaft
altenglischer
Gambenmusik. So
verstärkt sich der
Eindruck, daß Legrenzi
durch seine
Beschäftigung mit dem
alten Stil zu diesen
Sonaten und vor allem
auch zu deren Besetzung
angeregt worden sein
muß.
Heinrich Ignaz Franz
Biber (1644-1704)
Eine der
faszinierendsten
Musikergestalten des 17.
Jahrhunderts war
Heinrich Biber.
Hindemith nannte ihn
einmal den bedeutendsten
Barockkomponisten vor
Bach. Biber dürfte bei
Schmelzer
Violinunterricht
genommen haben,
jedenfalls ist seine
Violintechnik eine
Weiterführung derjenigen
Schmelzers. Seine erste
Stellung hatte Biber von
1660 bis 1670 an der
berühmten Kapelle des
Erzbischofs von Olmütz.
Von da an bis zu seinem
Tode 1704 war er als
Geiger,
Vizekapellmeister und
Oberkapellmeister am
Salzburger Hof
beschäftigt. Weltruf
genoß er vor allem als
Geiger; für seine
solistischen Leistungen
empfing er an vielen
europäischen Höfen
höchste Ehren und wurde
1690 von Leopold I.
geadelt. Aber auch als
Komponisterrang er,
durch die Verbreitung
seiner Werke im Druck,
weithin Popularität.
Obwohl er von der
Olmützer Kapelle ohne
Erlaubnis wegging und so
den Unwillen seines
Brotherrn erregte,
besorgte dieser sich
doch eifrig alle neuen
Werke seines entlaufenen
Musikers. Der berühmte
Tiroler Geigenmacher
Jakobus Stainer, dessen
Instrumente Biber
bevorzugte, war mit ihm
befreundet. Stainer
berief sich bei der
Bewertung seiner
Instrumente auf das
Urteil Bibers. In einem
Brief nach Olmütz
schreibt er: „,,, und
die viola da gamba, so
gar von
extraordinarischenen
holz und gleichsam ain
königin unter
dergleichen
instrumenten, auch ihrer
schen und giete nach
wohl noch soviel werth,
so der vortreffliche
virtuos her Biber wol
erkennen wirdet..."
Biber muß, nach dem
Urteil seiner
Zeitgenossen, aber auch
nach der Anlage seiner
Solokompositionen ein
grandioser Geiger
gewesen sein. Er kannte
bereits alle Raffinessen
moderner Virtuosität.
Der englische
Musik-historiker des 18.
Jahrhunderts Charles
Burney schreibt über
Biber: "...von allen
Geigern des vergangenen
Jahrhunderts war Biber
wohl der beste. Seine
Solosonaten sind die
schwersten und
phantasiereichsten, die
ich aus jener Zeit
kenne."
Biber komponierte alle
Arten von Musik, seine
größte Stärke aber war
wohl die
Instrumentalmusik. Die
meisten seiner
Instrumentalwerke sind
naturgemäß für
Streicher, wenn es auch
einige grandiose
Bläserstücke, vor allem
für Trompeten gibt.
Außer den 24
Violinsonaten ließ er
noch 12 Ensemblesonaten
,Fidicinium
sacro-profanum' für vier
und fünf
Streichinstrumente, 12
Triosonaten ,Harmonia
artificiosa ariosa' und
die
Streichersuitensammlung
,Mensa sonora' drucken.
Außerdem sind viele
Instrumentalwerke Bibers
handschriftlich
überliefert. Unter
diesen finden sich
einige für jene Zeit
geradezu unglaublich
fortschrittliche
Programmstücke, wie eine
„Pauernkirchfahrt" und
ein „Battaglia 1673".
Bibers Stil ist
leidenschaftlich und
virtuos. Sein
Einfallsreichtum scheint
unerschöpflich, von ihm
gibt es kaum ein
schwaches Stück. Er
verlangt von den
Instrumentisten hohe
technische Fertigkeit,
wobei auch die
Mittelstimmen regen
Anteil am virtuosen
Geschehen nehmen. In der
Form ging Biber überall
eigene Wege: In seinen
Violisonaten findet man
bisher auf
Streichinstrumenten nie
gehörte
rhapsodisch-tokkatenhafte
Fantasien. Seine Suiten
in ,Mensa sonora'
(Klingende Taffel, oder
Instrumentalische Taffel
Music, mit frisch
lautendem Geigenklang)
haben kaum noch etwas
mit französischen Suiten
gemein. Sie sind echte
Konzertsuiten, deren
Geschlossenheit durch
einen dem Anfangssatz
thematisch verwandten
kurzen Abschlußteil
(Sonatina) gewährleistet
wird. Die einzelnen
Suiten dieser Sammlung
sind ,Pars'
überschrieben, ein
anderes Wort für
Partita, was ebenfalls
Suite bedeutet.
Während die fünf anderen
Suiten des Werkes mit
förmlichen
Einleitungssätzen,
Sonaten oder Intraden
beginnen, wird Pars III
mit einer Gagliarda
eröffnet. Die Gagliarda
ist eigentlich ein Tanz
des 16. Jahrhunderts und
um die Mitte des 17.
Jahrhunderts bereits so
gut wie ausgestorben.
Nur einige
österreichische und
deutsche Komponisten
schrieben noch Tänze
dieses Namens, die aber
mit der eigentlichen
Gagliarda kaum noch
etwas gemeinsames haben.
Sie soll im Tripeltakt
stehen, die vorliegende
steht im alla breve.
Hier ist wohl der Name -
galliard =
draufgängerisch - als
programmatische
Satzbezeichnung zu
verstehen. Die übrigen
Sätze sind stilisierte
Tänze, die Aria eine
etwas italianisierte
Gavotte. Die unerhört
dicht komponierte kurze
Ciacona wird durch
rondoartige Verwendung
der Anfangsstrophe
übersichtlich
gegliedert. Die
abschließende Sonatina
ist ausnahmsweise ein
gänzlich neukomponierter
Ausklang, ohne
thematischen
Zusammenhang mit einem
der übrigen Sätzen.
Johann Heinrich
Schmelzer (1623-1680)
Heinrich Schmelzer war
der Sohn eines
Offiziers, der im
Dreißigjährigen Krieg
fiel. Geboren wurde er
zwischen 1620 und 1630,
wahrscheinlich im
Heerlager, wo er wohl
auch aufgewachsen ist.
Schon 1649 wurde er als
Mitglied der
kaiserlichen
Musikkapelle geführt.
Hier diente er sich vom
einfachen Tuttigeiger
bis zu höchsten Würden
empor. Er wurde
Vizekapellmeister und
endlich, 1679, als
erster Nicht-Italiener
sogar Hofkapellmeister.
Im Jahre 1680 starb er
an der Pest. Schmelzer
gehörte zu den
Lieblingsmusikern
Leopolds I. Er war
mindestens seit dem Tode
Bertalis (1669) der
engste musikalische
Ratgeber und Mentor des
Kaisers, der ihm auch
ein Adelsprädikat
verlieh. Seine
Hauptaufgabe als
Komponist lag zunächst
auf dem Gebiet der
Tanzmusik. Er schrieb
die BalletteinIagen zu
einer großen Zahl
italienischer Opern
Draghis, Cestis,
Bertalis und anderer,
versorgte den Hof mit
Gelegenheitsmusik für
alle erdenklichen
Anlässe, wie
Rosseballette,
Schlittenfahrten,
Faschingsunterhaltungen.
Man hat ihn später den
,Hofballdirektor'
Leopolds I. genannt. Das
erklärt, warum seine an
musikalischer Substanz
viel bedeutenderen Werke
reiner, nicht
tanzgebundener Kirchen-
und Instrumentalmusik
kaum bekannt geworden
sind.
Schmelzer war zugleich
bedeutender Komponist
und einer der ersten
Violinvirtuosen im
modernen Sinne. Leider
wissen wir nicht, wem er
seine geigerische
Ausbildung verdankt,
auch seine Lehrer in der
Komposition sind uns
unbekannt. Es ist wohl
anzunehmen, daß er im
Heerlager, wo er
aufwuchs, nicht nur
musikaIische Eindrücke
aller Art empfing,
sondern auch, vielleicht
bei einem ungarischen
oder polnischen
,Volksvirtuosen', auf
der Violine ausgebildet
wurde. Jedenfalls war er
schon in jungen Jahren
als Violinsolist eine
europäische Berühmtheit:
Johann Joachim Müller
nennt ihn in seinem
,Reisediarium bey
Kayserlicher Belehnung
des Chur und fürstlichen
Hauses Sachsen'
"...den berühmten und
fast vornehmsten
Violinisten in ganz
Europa".
1662 erschien sein
,Sacro-profanus
concentus musicus', dem
die beiden Sonaten (Nr.
3 und 10 der Sammlung)
der vorliegenden
Schallplatte entnommen
sind. Dieses Sammelwerk
enthält zwölf
verschieden besetzte
Sonaten. Es gibt hier
Triosonaten für zwei
Violinen und Continuo,
Sonaten zu vier, fünf,
sechs und sieben Stimmen
sowie ein achtstimmiges
doppelchöriges Werk. An
Instrumenten werden
Violinen, Violen (da
Gamba), Trompeten,
Posaunen und Zinken
verlangt. Formal sind
sämtliche Sonaten
Schmelzers - sowohl die
Violinsonaten als auch
die Ensemblesonaten des
,concentus' - dem
italienischen Stil
zuzurechnen.
,Sonata' nannte man
damals kurze, meist
einsätzige
Instrumentalstücke
verschiedenster
Besetzung. Eine
Gliederung in langsame
und schnelle Teile oder
auch in Teile
verschiedener Taktart
gab es wohl, doch sind
diese Teile nicht
voneinander getrennt:
einer geht nahtlos in
den nächsten über,
manchmal sind sie sogar
durch Wiederholungen
ineinander verzahnt. Im
17. Jahrhundert hatte
man den großen Bedarf an
Instrumentalmusik
vorwiegend auf die Art
gedeckt, daß man
Vokalmusik, französische
Chansons, italienische
Madrigale oder Ähnliches
für Instrumente
adaptierte. Von dieser
Praxis angeregt,
komponierten
Frescobaldi, die beiden
Gabrieli und viele
andere reine
Instrumentalstücke,
,Canzoni da sonare', die
wohl einsätzig waren,
aber schon erste
Anzeichen einer
Gliederung, etwa durch
Taktwechsel, zeigen.
Diese Canzonen waren
noch nicht
instrumentiert, das
heißt, sie konnten auf
beliebigen Instrumenten
gespielt werden. Aus der
zunehmenden Freude an
virtuosem Musizieren
entstand bald auch eine
Soloversion der Canzone,
die, von den Virtuosen
selbst geschrieben,
schon für bestimmte
Instrumente, etwa
Violine oder Zink,
konzipiert ist.
Diese italienischen
Canzonen aller
Besetzungen waren das
formale Vorbild von
Schmelzers Sonaten. Was
diese Sonaten besonders
reizvoll macht, sind das
virtuose Element, das
der Sologeiger Schmelzer
auch in seine
vielstimmigen
Ensemblestücke bringt,
und die häufigen
unüberhörbaren Anklänge
an ungarische und
böhmischeVolksmusik, zu
denen erwohlauch durch
Jugenderlebnisse im
Heerlager angeregt
worden sein mag. Bei den
in den Sonaten des
,concentus' für die
Mittelund Unterstimmen
geforderten ,Violen'
kann es sich wohl nur um
Tenor- und Baß-Violen da
Gamba gehandelt haben,
da Bratschen nicht den
notwendigen Tonumfang
besitzen. Außerdem
werden, besonders in der
sechsstimmigen Sonata 3,
immer wieder die Violen
chorisch den beiden oft
solistisch behandelten
Geigen
gegenübergestellt. In
den lnstrumentarien der
für diese Musik in Frage
kommenden Höfe (Wien,
Kremsier) tauchen auch
unverhältnismäßig viele
Violen da Gamba aller
Größen auf.
Die beiden hier
gespielten Sonaten sind
besonders schöne
Beispiele der
einsützigen Sonatenform.
Bei der vierstimmigen
Sonata X wird das
markante Anfangsmotiv,
das zugleich das
thematische Material der
ganzen Sonate stellt, am
Schluß, verlängert durch
acht Abschlußtakte,
wiederholt und so dem
Ganzen sein fester
Rahmen gegeben.
Dazwischen wird, in
aufgelockertem Satz, im
3/2- und 4/4-Takt, -
jede Stimme hat ihre
solistischen Stellen -
das Anfangsmotiv auf
mannigfache Art
abgewandelt. - Bei der
Sonata III ist das
Prinzip, das
Anfangsmotiv zum Schluß
zu wiederholen,
besonders reizvoll
angewandt: Die Sonata
beginnt mit einer
verzierten Skala, die
von den tiefen
Instrumenten aufsteigend
in einem hohen Duett der
beiden Violinen endet.
Am Schluß wird nun
dieses Skalenmotiv
umgekehrt von oben nach
unten ausklingend
geführt; an diese
umgekehrte Reminiszenz
schließt sich wieder ein
vollstimmiger, groß
angelegter Abschluß an.
Der ganze Mittelteil
dieser Sonata ist wie
sehr häufig bei
Schmelzer über einer
ostinaten Baßfolge
aufgebaut. So erhält der
überaus lockere Satz -
die Instrumente spielen
sich oft, einzeln oder
paarweise, nur ganz
kurze Motivteilchen zu -
einen sinnvollen
Zusammenhalt.
Leopold I.
(1640-1705)
Leopold I., eine der
profiliertesten
Herrschergestalten auf
dem Habsburger Thron,
Gegenspieler Ludwig XIV.
- diesen Kaiser uns als
Komponisten
vorzustellen, fällt
nicht ganz leicht. Bei
den Habsburgern war
Musikliebe
Familientradition,
persönliche Musikalität
fast eine
Selbstverständlichkeit.
Schon Maximilian I.
hatte für den Aufbau und
die Erhaltung seiner
berühmten Hofkapelle
Unsummen verwendet.
Diese Musikliebe
steigerte sich dann bei
den Kaisern des 17.
Jahrhunderts zur
Leidenschaft. Nach der
musischen Dürre des
Dreißigjährigen Krieges
begann eine Blüte der
Künste, wie sie in
diesem Ausmaß noch kaum
erlebt worden war. Der
Vater Leopolds I.,
Ferdinand III., hatte
eine derart solide
musikalische Ausbildung
genossen, daß er nicht
nur seine Kapelle
sachverständig betreute,
sondern auch selbst
komponierte. Er zog die
besten italienischen
Musiker nach Wien und
bestimmte so die
Richtung, die in den
folgenden Jahrzehnten
beschritten wurde.
Leopold I. war
ursprünglich für den
geistlichen Stand
bestimmt gewesen. Er
genoß bei den führenden
Hofmusikern seines
Vaters eine gründliche
musikalische
Fachausbildung. Der
berühmte Organist
Wolfgang Ebner
unterrichtete ihn im
Klavierspiel, Antonio
Bertali in der
Komposition und
vielleicht auch im Spiel
von Streichinstrumenten.
Später wurde Leopold in
allen musikalischen
Fragen von Heinrich
Schmelzer beraten.
Leopold I. war als
Komponist überaus
fruchtbar. Die frühesten
von ihm erhaltenen
Kompositionen stammen
aus seinem 15.
Lebensjahr. Er
komponierte italienische
und deutsche Oratorien,
Messen und Motetten; zu
vielen Opern Draghis,
Cestis und anderer
schrieb er Teile;
außerdem hinterließ er
deutsche Lieder und
Tanzmusik. Oft gab er
nur die Melodie und den
Baß an und ließ die
Mittelstimmen von seinen
Musikern ausführen.
Merkwürdig ist, daß
Leopold, der der
italienischen Musik, ja
sogar der italienischen
Sprache offiziell vor
jeder anderen den Vorzug
gab, selbst eine Menge
deutscher Texte
komponierte. Sogar
Dialektgedichte finden
sich in seinen Werken.
Seine Zeitgenossen
priesen ihn, wohl mit
untertanenhafter
Ubertreibung, als den
besten aller Musiker.
Ohne Übertreibung kann
man aber sagen, daß er,
besonders in seiner
Kirchenmusik, ein guter,
solider, wenn auch nicht
genialer Komponist war.
Leopolds
Musikleidenschaft ging
so weit, daß er, um ein
Beispiel zu nennen,
Trauervorschríften nicht
einhielt; in einem Brief
schreibt er: „...Diese
Fasching hätt ziemlich
still sein sollen wegen
der Klagen, doch haben
wir etliche Festl in
camera gehabt, denn es
hilft den Toten doch
nicht, wenn man traurig
ist". Wenn seine
Staatskasse auch noch so
leer war: für Musik
hatte er immer Geld. In
jeder seiner Residenzen
hatte er zu seinem
persönlichen Gebrauch
ein kostbares Cembalo
stehen. Die Hofkapelle
wurde unter seiner
Herrschaft auf annähernd
100 Musiker erweitert.
Persönlich kümmerte er
sich um die
Neuengagements und nahm
selbst Probespiele ab.
Das ,Regina coeli' für
Alt und Instrumente ist
eines der ersten Werke
aus seiner Feder.
Leopold hat es mit 15
Jahren geschrieben. Die
Handschrift der Wiener
Nationalbibliothek
enthält die Bemerkung
„Accompagnamento di
Viole del Antonio
Bertalli". Bertali,
selbst Streicher, hat
also offenbar das Werk
des jungen Erzherzogs
instrumentiert: für zwei
Violinen, zwei Violen da
Gamba und Basso
continuo. Die Violinen
stellen das
instrumentalsolistische
Gegengewicht zur
Singstimme dar, mit der
sie in der Führung
abwechseln, die
samtweichen Gamben geben
das akkordische
Fundament für die
Gesangsteile. Nur in der
Einleitungssonata und im
Schlußteil vereinigen
sich alle drei Elemente.
Das eingeschobene
Ritornell der beiden
Geigen soll das Alleluja
als Engelsmusik
illustrieren.
(Columbia
C 91 115)
|
|