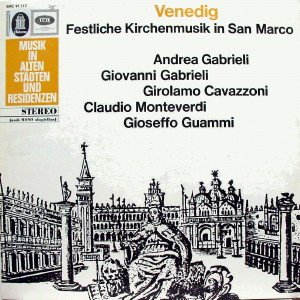 |
| 1 LP
- SMC 91 117 - (p) 1966 |
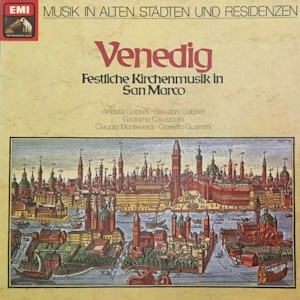 |
| 1 LP
- 1 C 037-45 579 - (p) 1966 |
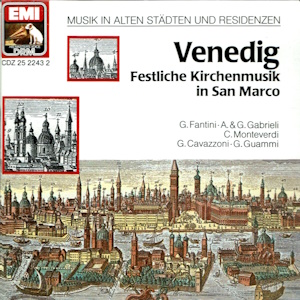 |
| 1 CD -
CDZ 25 2243 2 - (c) 1990 |
 |
| 1 CD - 9
28332 2 - (p) & (c) 2013 |
|
| VENEDIG -
Festliche Kirchenmusik in San Marco |
|
|
|
|
|
| Girolamo Fantini
(1600-?) |
1. L'Imperiale
- Oberstimme von Fantini, Modo per
imparare a sonare di tromba,
Frankfurt 1638 |
1' 34" |
A1
|
|
|
|
|
| Andrea Gabrieli
(1510-1586) |
2. Ricercare
secondo tono - in: ndrea
Gabrieli, Ricercari für Orgel |
4' 12" |
A2
|
|
|
|
|
| Giovanni Gabrieli
(1557-1613) |
3. Magnificat
primi toni - in: Musica sacra,
Band 21 |
6' 20" |
A3
|
|
4.
Sonata pian' e forte - aus:
Canzoni e sonate a più strumenti
cobntenute nelle Sacrae Symphoniae,
1597 |
4' 30" |
A4
|
|
5. Intonazione
d'Organo - in: Torchi,
L'Arte musicale in Italia, Band 3 |
0' 41" |
A5
|
|
6. Quis est
iste - Doppelchörige Motette
in: Giovanni Gabrieli, Opera omnia
Crpus mensurabilis musicae, Reihe
12 |
5' 05" |
A6
|
|
|
|
|
| Girolamo Fantini |
7. L'Imperiale
- (wie 1) |
1' 32" |
A7
|
|
|
|
|
| Giovanni Gabrieli |
8.
Canzon a 10 - aus: Canzoni e
sonate a più strumenti cobntenute
nelle Sacrae Symphoniae, 1597 |
3' 56" |
B1
|
|
|
|
|
| Girolamo Cavazzoni
(um 1525-1560) |
9. Christe
Redemptor omnium - Hymnus
in: Torchi, L'Arte
musicale in Italia, Band 3 |
1' 47" |
B2
|
|
10. Ave Maris
Stella - Hymnus in: Girolamo
Cavazzoni, Orgelwerk I, 1543 |
2' 03" |
B3
|
|
|
|
|
| Claudio Monteverdi
(um 1567-1643) |
11. Ave Maris
Stella - Doppelchörige
Motette aus: Vesperae Beatae
Mariae Virginis (Marienvesper) |
8' 31" |
B4
|
|
|
|
|
| Gioseffo Guami
(1540-1611) |
12. Canzon
- in: Johann Woltz, Nova musices
organicae, Tabulatura, 1617 |
2' 37" |
B5
|
|
|
|
| Rudolf
Ewerhart, Orgel (2,5,9,10,12) |
Valerie Noack,
Friedrich Schmidtmann, Blockflöte
(3,6,8,11) |
|
| Consortium Musicum,
(1,3,4,6-8,11) |
Walter Holy, Robert
Bodenröder, Pieter Dolk, Michael Steiner,
Naturtrompete (1,7) |
|
| RIAS-Kammerchor
(3,6,11) |
Edward H. Tarr,
Naturtrompete (1,7), Zink (3,4,6,11)
|
|
| Günther Arnt,
Leitung (3,6,11)
|
Helmut Schmitt, Harry
Barteld, Kurt Federowitz,
Renaissance-Posaune (3,4,6,11) |
|
|
Otto Steinkopf,
Bass-Dulzian (3,6,11) |
|
|
Emil Seiler (3,11),
Heinz Jopen (4), Viola |
|
|
Herbert Naumann,
Viola da gamba (3,11) |
|
|
Alfred Lessing,
Wolfgang Eggers, Horst Hedler, Heinrich
Haferland, Viola da gamba (8) |
|
|
Heiner Spieker,
Viola da gamba (8), Violone (3,6,11) |
|
|
Emil Morneweg,
Kontrabass (4,8) |
|
|
Michael Schäffer,
Renaissance-Laute (6,8,11) |
|
|
Wolfgang Meyer,
Orgel-Positiv (3,6,11) |
|
|
Annemarie Bohne,
Spinett (8) |
|
|
Ulla Laban, Harfe
(8) |
|
|
Wenzel Pricha, Pauke
(1,7) |
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
-
Marienfeld (Germania) - aprile
1965 (2,5,9,10,12)
- Berlin (Germania) - giugno 1964
(3,6,11)
- Brauweiler (Germania) - febbraio
1963 (8)
- Brühl (Germania) - settembre
1965 (1,7)
- Knechsteden (Germania) -
settembre 1964 (4) |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Gerd
Berg / Christfried Bickenbach /
Wolfgang Gülich |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- SMC 91 117 - (1 LP) - durata 43'
12" - (p) 1966 - Analogico |
|
|
Altre edizioni
LP
|
|
EMI
Electrola - 1 C 037-45 579 - (1
LP) - durata 43' 12" - (p) 1966 -
Analogico |
|
|
Edizioni CD |
|
EMI Electrola -
CDZ 25 2243 2 - (1 CD) - durata
43' 12" - (c) 1990 - ADD
EMI Music - 9 28332 2 - (1 CD) -
durata 43' 12" - (p) & (c)
2013 - ADD |
|
|
Cover |
|
- |
|
|
|
|
Kapellmeister
an San Marco
Als der Doge Andrea
Gritti entgegen den
Ansprüchen einheimischer
Musiker am 12. Dezember
1527 den berühmten
Adrian Willaert
(1490-1562) zum
Kapellmeister der
Markuskirche ernannte,
verhalt er Venedig zu
einer außergewöhnlichen
musikalischen
Entwicklung, die unter
dem Namen „venezianische
Schule“ in die
Musikgeschichte
eingegangen ist. Der
kontrapunktische Stil
des aus der
Josquin-Schule
hervorgegangenen
Niederländers wandelte
sich in Venedig zu einer
harmonisch-malerischen
Satzweise, deren Reiz
der Klanggegensatz hoher
und tiefer Stimmgruppen
ausmachte. Die beiden
einander
gegenüberliegenden
Orgelemporen in den
Chornisohen der
Nebenapsiden von San
Marco und ihre
Möglichkeit, zwei
räumlich getrennte
Vokal- oder
Instrumentalchöre
aufzustellen, sollen
Willaert zur Erfindung
der doppelchörigen
Motette angeregt haben.
Dem Schülerkreis, der
sich um Willaert in
Venedig scharte, gehörte
sein Landsmann Cyprian
de Rore (1516-1565),
Claudio Merulo
(1533-1604) und die
Venezianer Giuseppe
Zarlino (1519-1590) und
Andera Gabrieli
(1510-1586) an.
Andrea Gabrieli, seit
1564 zweiter Organist
und Kapellmeister an San
Marco, machte sich den
neuen Stil seines
Meisters zu eigen und
steigerte die
doppelchörige Motette zu
Klangkombinationen von
fünf (Sacrae
cantiones 1565)
bis zu 16 Stimmen (Cantiones
sacrae 1578). Die
altertümlichen
Kirchentonarten
durchsetzte er mit
modernem Dur und Moll
und ließ erstmalig die
Vokalmusik durch
Instrumente, Violinen,
Gamben, Blockflöten,
Zinken und Posaunen
unterstützen, die sich
später in einem eigenen
Orchestersatz
verselbständigten. Das
Orgelwerk Andrea
Gabrielis erschien erst
nach seinem Tode, am
Ende des 16.
Jahrhunderts im Druck.
Sein Neffe Giovanni
Gabrieli edierte die
Canzonen, Intonationen,
Toccaten und drei Bände
seiner Ricercari, denen
das Ricercare
secondo tono
entnommen ist. Der
Unterschied zwischen
„Canzone“ und „Ricercar“
macht sich bei Andrea
Gabrieli weniger in der
Bezeichnung, als im Stil
bemerkbar. Das Ricercar
kennzeichnet sein
Kontrapunkt und lange
polyphone Melodielinien.
Das häufig zweiteilige
Hauptthema erscheint
verändert und ungeformt;
manchmal trägt der
zweite Teil schon den
Charakter des
Kontrapunktes einer
Fuge. Das Ricercar läßt
keine Gliederung in
einzelne Abschnitte
erkennen, seine Phrasen
überschneiden sich ohne
Caesuren nach Art der
traditionellen
Polyphonie.
Der künstlerischen
Wirkung Andrea Gabrielis
entspricht sein
weitreichender Ruf als
Lehrer. Die Anwendung
der Mehrchörigkeit
vererbte er seinem
deutschen Schüler Hans
Leo Haßler (1564-1612),
über seinen Neffen
Giovanni Gabrieli, den
er zu seinem
künstlerischen Erben und
Nachfolger erzog,
vermittelte er die neuen
Gattungen und Begriffe (Symphonie
sacra) an Heinrich
Schütz. Es spricht für
seine künstlerische
Großzügigkeit und
Weitsicht, daß er den
Neffen zur Gewinnung
neuer Eindrücke zu
Orlando di Lasso nach
München in die Schule
gehen ließ. In einer
Vorrede an Jakob Fugger
in Augsburg setzte die
Dankbarkeit des Neffen
dem väterlichen Lehrer
ein Denkmal:
„Wäre
Andrea Gabrieli nicht
mein Oheim gewesen, so
dürfte ich ohne Furcht
und Tadel behaupten,
daß, wie es im Ganzen
wenig ausgezeichnete
Maler und Bildhauer
zugleich gegeben, auch
wenig Tonmeister und
Orgelspieler gelebt
haben, die ihm gleich
kämen. Seine
Fertigkeit könnte ich
loben, seine seltenen
Erfindungen, seine
neuen Wendungen, seine
anmutige Schreibart.
Des Ernstes, der
Gelehrtheit seiner
Gesänge könnte ich
gedenken, aber auch
ihrer Frische und
Lieblichkeit. Ich
könnte sagen, daß aus
seinen Werken
offenkundig
hervorgehe, wie er
einzig gewesen in
Erfindung von Klängen,
welche die Kraft der
Rede und der Gedanken
ausdrücken. Es gefiel
Gottes höchstem
Ratschluß, ihn im
vergangenen Jahre von
der Erde in seine
himmlische Freude zu
versetzen, in reifem,
an Jahren hohem Alter,
aber zu einer Zeit, wo
sein Geist mehr als je
lebendig und
erfindungsreich in der
Tonkunst war. Mehrere
Konzerte, Dialoge und
andere Tonstücke, für
Singstimmen und
Instrumente
eingerichtet, wie in
den Hauptkirchen der
Fürsten und in den
Akademien der
Vornehmen üblich sind,
hatte er auf das
Fleißigste
ausgearbeitet, um
Euch, Herr, damit zu
beschenken. Euch widme
ich diese Früchte
seiner Kunst und
genüge damit seinem
wie meinem Wunsche.“
Der
Hauptmeister der
„venezianischen Schule“,
Giovanni Gabrieli
(1557-1613) übernahm
nach kurzen Lehrjahren
bei Orlando di Lasso als
29jähriger das Amt des
ersten Organisten und
Kapellmeisters an San
Marco, um es bis zu
seinem Tod 1613, 27
Jahre lang auszuüben.
Seine Persönlichkeit ist
durch Briefe, Berichte
und Zeugnisse seiner
zahlreichen Schüler
bekannt. Freundschaft
verband ihn mit dem
nahezu gleichaltrigen
Hans Leo Haßler und
seinem Schüler Heinrich
Schütz, dem er,
allerdings vergeblich,
seine Nachfolge an San
Marco anbot. Giovanni
Gabrielis Ruf genoß seit
dem Beginn des 17.
Jahrhunderts
europäisches Ansehen.
Mit Orlando di Lasso
uncl der Kapelle des
Herzogs von Bayern hielt
er zeitlebens Fühlung,
dem Hause Fugger war er
- wie die Widmungen
vieler Druckwerke zeigen
- freundschaftlich
verbunden. Giovanni
Gabrieli war kein
revolutionärer Neuerer
der Musik, wie vor ihm
Willaert, sondern der
Vollender des neuen
Stils der
„venezianischen Schule“.
In der Glanzzeit
Venedigs unter dem
prachtliebenden Dogen
Marino Grimani verhalf
er der venezianischen
Musik zu einer
monumentalen
Festllchkeit, wie sie
Tintoretto und Veronese
in der Malerei
verwirklicht hatten. Die
doppelchörige Motette
vermehrte er um einen
dritten, meist
instrumentalen Chor,
ihre Kontrastwirkung
steigerte er zu einer
Gegensätzichkeit von
zwei bis zu 22 Stimmen (Canzoni
e Sonate 1615),
die Klangregie der
räumlich verschieden
aufgestellten
Instrumental- und
Vokalchöre
abwechslungsreichster
Besetzungen meisterte er
mit Virtuosität, die
Ausbildung eines
selbständigen
Orchestersatzes als Symphonia
(Einleitung und
Zwischenspiel der
Motette) und die
Förderung
solistisch-konzertanter
Kirchenmusik sind seine
großen Leistungen.
Das dreichörige Magnificat
und die doppelchörige
Motette Quis est
iste geben
Aufschluß über die
konzertierende und
dialogisierende
Kompositionstechnik
Giovanni Gabrielis. In
abwechslungsreicher,
vielfältiger Weise lösen
sich die einzelnen Chöre
in kurzen Absätzen und
häufigen Einwürfen ab,
den fortlaufenden
Kontrapunkt älteren
Stils ersetzt die
Wiederholung und
Abwandlung des
Hauptthemas in
verschiedenen
Klangfarben. Vokalsoli
und Vokalchor sind
deutlich voneinander
abgesetzt, in den
Einleitungs- und
Schlußtakten vereinigen
sich zumeist alle Chöre
zu festlicher
Gesamtwirkung.
Giovanni Gabrielis
eigenste Schöpfung ist
die rein instrumentale
Mehrchörigkeit.
Verglichen mit der
vokalen erscheint sie
noch konservativ in den
Sacrae Symphoniae
1597. Die Canzon à
10 erfordert durch
lebhafte Figuration
schon eine gewisse
Virtuosität, der
Kontrapunkt tritt an
Bedeutung hinter einer
reichen Ornamentation
zurück. Die zweichörige
Sonata pian' e forte
aus dem Nachlaßdruck von
1615 wurde vor allem
dadurch berühmt, daß sie
das erste gedruckte
Musikwerk mit
dynamischen Zeichen ist.
Ihr wirkungsvoller
Kontrast zwischen einem
Streichinstrumentenchor
(Violen, Kontrabaß) und
einem Bläserchor
(Zinken, Posaunen) und
ihr feierlicher Klang
geben ein
eindrucksvolles Beispiel
musikalischer
Staatsrepräsentation in
Venedig.
Die Orgelmusik Giovanni
Gabrielis schließt sich
eng an das Vorbild
seines Onkels an. In den
Veröffentlichungen von
Orgelkanzonen,
Intonationen, Toccaten
und Ricercari Andrea
Gabrielis edierte
Giovanni Gabrieli auch
eigene Kompositionen.
Seine Intonationi
sind kurze,
improvisatorische
Zwischenspiele zwischen
gottesdienstlichen
Handlungen, den späteren
Praeludien verwandt. Sie
bestehen aus einer
Akkordfolge, die durch
Passagen und
Verzierungen verbunden
ist, und bildeten das
Handwerk des Organisten
für die kirchliche
Gebrauchsmusik im 16.
und 17. Jahrhundert.
Peter
Kertz
Claudio Monteverdi
Die ehrenvolle Berufung
Claudio Monteverdis 1613
zum ersten Kapellmeister
an San Marco brachte
eine folgenschwere
Entscheidung für den
Verlauf seines weiteren
Lebens und Werkes mit
sich. Hatte ihn - nach
Lehrjahren bei Marc'
Antonio Ingegneri in
Cremona - der prunkvolle
Hof der Gonzaga in
Mantua zur weltlichen
Kunst der Madrigale,
Intermedien und Opern
angeregt, - L'Orfeo,
L'Arianna und Il
Ballo delle Ingrate
komponierte Monteverdi
als „Maestro di Musica“
des Herzogs Vincenco I.
Gonzaga, - so erwartete
die Republik Venedig von
ihm eine Reorganisation
ihrer Kirchenmusik im
Sinne des überkommenen
Erbes. Nach der
Unsicherheit seiner
Existenz am Hof von
Mantua, den politische
Krisen und häufige
Thronwechsel
gefährdeten, bot das
reiche Venedig nach dem
Tode Giulio Cesare
Martinengos,
Kapellmeister an San
Marco 1609-1613, dem
46iährigen die Position
des „Maestro di Capella
di
San Marco“ mit einem
Jahresgehalt von 300,
später 400 Dukaten und
freier Wohnung in der
„Canonica“ der
Markuskirche. Nach
eigenen Aussagen
entrückte ihn „der
Kirchendienst dem Typus
der theatralischen
Musik“. Sein
harmonisches Verhältnis
zu den Prokuratoren der
Seerepublik trübte
nichts, er erzog die
Kapelle der Markuskirche
zu einem erstklassigen
Aufführungsinstrument
und bereicherte ihr
Repertoire um viele
eigene Kompositionen.
Der Rückkehr nach Mantua
und
Kompositionsaufträgen
der Gonzaga zeigte sich
Monteverdi wenig
geneigt, dagegen knüpfte
er Beziehungen zum Hof
von Parma, wo Margarita
von Toscana, die Gattin
Odoardo Farneses, seine
Gönnerin wurde.
Die Eröffnung des ersten
öffentlichen Opernhauses
San Cassiano 1637 in
Venedig ließ dort das
allgemeine Interesse an
Monteverdis
Opernkompositionen
erwachen. Schon 1639
wurde seine Arianna
gespielt, und der
75iährige Meister schuf
- ähnlich Verdi - im
Alter seine reifsten
Opern, Il Ritorno
d'Ulisse in Patria,
Le Nozze di Enea con
Lavinia und L'lncoronazione
di Poppea für
Venedigs Operntheater.
Unter dem Eindruck der
furchtbaren Pest, die
Venedig 1630/31
heimsuchte, war der seit
langen Jahren verwitwete
Monteverdi in den
geistlichen Stand
getreten. Er starb nach
einem Besuch in Cremona
und Mantua am 29.
November 1643.
Monteverdis Gesamtwerk
umfaßt drei Gattungen:
Madrigal, Oper und
Kirchenmusik. Reine
Instrumentalmusik,
Kompositionen für Orgel
oder andere
Tasteninstrumente sind
von ihm ebensowenig
erhalten wie von seinem
deutschen Zeitgenossen
Heinrich Schütz. Mit den
Madrigalen, in denen er
die musikalische
Interpretation des
Dichterwortes versuchte,
und der Neubewertung des
Wortes innerhalb der
musik-dramatischen
Situation seiner Opern
setzte sich Monteverdi
in einen ständig
wachsenden Gegensatz zur
traditionellen Musik,
den er mit der Antinomie
von Prima Prattica
und Secondo Prattica
auch theoretisch
(Vorrede zum V.
Madrigalbuch, 1605)
begründete.
Der Zwiespait
stilistischer
Grundhaltung tritt am
deutlichsten in seiner
Kirchenmusik zutage, die
sich am wenigsten vom
Zwang motettischer
Polyphonie befreien
ließ. Deswegen bedeutete
die Komposition der
großen Marienvesper
1610 im „stile
concitato“ der Mantuaner
Opern einen
revolutionären Einbruch
in liturgische
Stiltradition. Die Vespro
della beata Vergine
ist ein Versuch, die
überlieferte Form der
polyphonen, auf Psalm
und Hymnus beruhenden
Motette mit den modernen
Mitteln psychologischer
Wortdeutung und
affektbetonter,
dramatischer Musik zu
erfüllen. Das Ergebnis
war eine Tonschöpfung,
die das liturgische Maß
weit überstieg, mit
einer Vielfalt von
musikalischen Formen
älteren und neueren
Stils und einem selbst
für das an Klangpracht
gewohnte Jahrhundert
ungewöhnlichen Aufwand
an Instrumenten. Unter
den 14 „Sätzen“ der
Vesper befindet sich
auch ein Magnificat
(in zwei Fassungen),
eine große Orchester-Sonata,
eine Solo-Monodie (Nigra
sum) von geradezu
opernhafter Dramatik,
und eine doppeichörige
Motette Ave Maris
Stella. Letztere
bedient sich der
kirchenmusikalischen
Errungenschaften
Giovanni Gabrielis,
insbesondere seiner Sonata
con voce. Mit
ihrem reichhaltigen
Instrumentarium von
Streichern (Viola,
Gambe, Violone), Bläsern
(Blockflöte, Zink,
Posaune), Laute und
Orgeipositiv bietet sie
ein typisches Beispiel
der Gattung, die
Giovanni Gabrieli mit
seinen Symphoniae
sacrae in die
venezianische
Kirchenmusik einführte.
Peter
Kertz
Die Orgel und ihre
Meister
Die Markuskirche in
Venedig soll nach der
Überlieferung schon in
den ersten Jahren nach
ihrer Erbauung mit
Orgeln ausgestattet
worden sein. „Unter dem
anderen vorzüglichen
Schmuck, der allen
Völkern der Christenheit
sichtbar wird“, heißt es
in den amtlichen
Regierungsakten 1588,
„sind es die Orgeln von
San Marco, die wegen
ihrer hervorragenden
Güte und wegen ihres
Alters nicht
ihresgleichen finden“.
Im Gefolge des
großartigen Aufschwungs,
den die venezianische
Musik in der zweiten
Hälfte des 16.
Jahrhunderts nahm, wurde
den beiden Hauptorgeln
um 1588 eine dritte
hinzugefügt, weil es für
die Konzerte „notwendig
und nützlich“ erschien.
Außer den beiden
Organisten unterhielt
die Republik seit 1563
einen eigenen Pfleger
für die Orgeln in der
Markuskirche.
Die Ämter des ersten,
zweiten und seit etwa
1590 dritten Organisten
an San Marco waren
äußerst begehrt und
umworben. Der Nürnberger
Komponist Paulus
Hainlein, der - wie so
viele deutsche Meister
in jener Zeit - zum
Studium der Musik
Venedig besuchte,
berichtet, daß „sie
selbsten auf ein ander
neudisch (neidisch)
seindt“ und es gar nicht
so leicht sei, von ihnen
etwas zu lernen:
"...Seindt
auch die Organisten in
praeambulirn bißweiln
häckel (heikel), dan
sie unterzeiten die
vornembsten
Register... verziehen
(wechseln) da man dan
scharf genug
auffmercken muß, etwas
zu (er-)fassen...
Obzwar die Organisten
hier nit allerdings so
künstlich sind, daß
ich vor diesem gehört,
werde ich doch noch
was vom Zuhören lernen
können. ist auch das
Schlagen nit so gemein
alß wie in Teutschland
an bäbstlichen Orten,
da man in der Wochen
keine Orgeln rühren
thut, auch die
Sonnabend nit, es
falle denn ein Fest
mit ein, laßt sich
auch der beste
Organist namens Sig.
Gaballi (Cavalli) in
S. Marco nit hören, es
sey denn der Hertzog
dabey, welches doch
seiten geschieht..."
(Brief Paulus
Hainieins vom 1.
November 1647).
Zur Zeit,
als Giovanni Gabrieli
das Amt des ersten
Organisten bekleidete,
erhielt Gioseffo Guammi
am 30. Oktober 1588 die
zweite Orgelstelle der
Domkirche. Auch Guammi,
der vermutlich zwischen
1530 und 1540 in Lucca
geboren wurde, gehörte
dem Schülerkreis Adrian
Willaerts in Venedig an.
Zusammen mit seinem
Bruder Francesco, der
1568-1580 in der
Münchner Hofkapelle als
Posaunist tätig war, kam
er in den Dienst Herzog
Albrechts V. von Bayern.
Dort schloß er
Freundschaft mit
Giovanni Gabrieli, der
sich zu dieser Zeit als
Schüler Orlando di
Lassos in München
aufhielt. Für kurze Zeit
übte er das Amt des
Organisten an der
Kathedrale San Marino
seiner Heimatstadt Lucca
aus, 1585 kam er nach
Venedig, zunächst als
Musiklehrer des Prinzen
Gian Andrea d'Oria, seit
1588 als 2. Organist von
San Marco. Drei Jahre
später kehrte Gioseffo
Guammi wieder als
Organist an die
Kathedrale von Lucca
zurück und blieb dort
bis zu seinem Tode 1611.
Gioseffo Guammi war
einer der berühmtesten
Organisten seiner Zeit,
von seinen Kollegen
(Zarlino, Banchieri)
hoch geachtet. Seine nur
mit wenigen Werken
erhaltene Orgelmusik
steht dem
polyrhythmischen Stil
Orlando di Lassos nahe
und ist auch der
virtuosen Kunst Andrea
Gabrielis verwandt. 1542
erschien in Venedig ein
Orgeltabulaturbuch mit
den ersten
Kompositionsversuchen
Girolamo Cavazzonis.
Girolamo Oavazzoni ist
der Sohn eines berühmten
Vaters, des lange in
Venedig und Padua (im
Dienste der Kardinäle
Francesco Cornaro und
Pietro Bembo), später
als Domorganist in
Chioggia wirkenden
Marc'Antonio Cavazzoni
da Bologna detto
d'Urbino (1490 bis
wahrscheinlich 1517). In
musikalischer Umgebung
wuchs der vermutlich
1525 in Urbino geborene
Girolamo auf, begab sich
nach der Lehrzeit bei
seinem Vater an den Hof
von Mantua, wo er noch
1577 als Domorganist des
Herzogs bezeichnet
wurde. Gegenüber den
Werken seines Vaters,
der die polyphone Kunst
der Orgelkomposition
oftmals übersteigerte
und sich in Gegensatz
zur satztechnischen
Zucht der venezianischen
Orgelmeister um Willaert
setzte, hält sich das
erste Buch der
Orgelwerke Girolamos
streng an den
fugierenden Stil drei-
bis vierstimmiger
Satztechnik. Er widmete
es 1542 seinem Brotherrn
und Taufpaten, dem
Kardinal Bembo:
„Da ich
zu meinem großen Glück
zum Diener und
gehorsamen Sohne Eurer
Erlauchtesten und
Verehrungswürdigsten
Herrschaft nicht
gemacht, sondern
geboren wurde, als
Sohn Eures alten und
sehr ergebenen Dieners
Marc'Antonio da
Bologna detto
d'Urbino, dachte ich,
sobald ich die ersten
Versuche meiner Jugend
drucken lassen wollte,
daran, sie für Sie
drucken zu lassen und
sie lhnen zu widmen.
Ich hielt es für
angebracht, sie unter
der Obhut desselben
Herren erscheinen zu
lassen, der auch mich
zur Welt hat kommen
sehen... Ich,
Niedriger, beinahe
noch ein Knabe, wagte
meine Augen zu solcher
Höhe zu erheben...
diese Musik war
praktische, gemeine
Instrumentalmusik und
Dutzendware... Aber da
mit mir Ihnen alles
gehört, was ich
schaffe, schulde ich
Ihnen auch die Werke
meiner Jugend... Diese
meine schlecht
geratenen Versuche,
die dennoch ihre
Wurzeln haben in einer
gelobten und fleißig
studierten
Wissenschaft, habe ich
mit viele anderen,
besseren, vereinigt...
Ich bitte Sie, meinen
Vater und mich unter
Ihrem gewohnten Schutz
zu halten als Ihre
ergebensten und
treuesten Diener, wie
auch wir und unser
ganzes Haus die
göttliche Weisheit
unaufhörlich bitten,
Ihnen Schutz und
dauerndes Glück nicht
zu versagen. Venedig,
am 25. November 1542.“
Girolamo
Cavazzonis erste
Orgelwerke enthalten
Ricercari, Canzonen und
Hymnen. Die Hymnen Christe
Redemptor omnium
und Ave Maris Stella
geben Aufschluß über die
damals übliche
Aufführungspraxis der
Alternation von Chor und
Orgel. Mit
kontrapunktischer
Strenge bearbeitete
Girolamo Cavazzoni die
Hymnen für Orgel: über
einem cantus firmus im
Baß läßt er in Christe
Redemptor omnium
die Oberstimmen immer
reicher bis zu einem
majestätischen Schluß
hin figurieren, das Ave
Maris Stella
charakterisiert eine
üppige Linienführung und
strenge Imitation zweier
Themen, deren erstes am
Schluß in Sopran und Baß
wiederholt wird.
Peter
Kertz
L'Imperiale
Der fürstliche
Absolutismus bedurfte
bei feierlichen
Anlässen, Staatsaktionen
und zeremoniellen Festen
des Trompetenmarschalls
zu seiner Repräsentation
und Verherrlichung. Das
offizielle Erscheinen
des Fürsten bei
Empfängen, im Theater
(Trompeterlogen)
kündigten die Trompeter
an, sie gaben als
Herolde das Geleit zu
Kaiserkrönungen und
Staatsbesuchen.
Die Zunft der Trompeten-
und Posaunenmacher von
streng gewahrter
Exklusivität wurde im
16. und 17. Jahrhundert
geradezu zu einem
musikalischen Orden, den
geistliche und weltliche
Höfe gleichermaßen
umwarben. Kein Wunder,
daß in Frankfurt, der
Stadt der
Kaiserkrönungen, 1638
eine Trompetenschule
erschien, die außer
Übungen (passaggi di
lingua) auch
verschiedene
generalbaßbegleitete
Kompositionen (capricci,
sonate, balletti)
enthielt. Ihr Verfasser,
der um 1600 in Spoleto
geborene Italiener
Girolamo Fantini, besaß
außerordentliche
technische und
künstlerische
Fähigkeiten. Die
Beispiele aus seiner
Trompetenschule Modo
per impara a sonare di
tromba enthalten
alle Zwischentöne (von
c” aufwärts), ihr
kompositorischer
Einfallsreichtum
rhythmischer und
dynamischer Art
(Echowiederholungen),
übertrifft die
zeitgenössische deutsche
Trompetenkunst. Girolamo
Fantini war 1630
Oberhoftrompeter des
Großherzogs Ferdinand
II. Medici von Toscana
und begleitete seinen
Fürsten auf vielen
Reisen in Italien und
Deutschland. Während der
Wahl Ferdinands III. zum
römischen König am 22.
Dezember 1636 weilte er
in Regensburg, in Rom
ist er mehrere Male
gewesen. Die Namen
vieler deutscher und
italienischer Familien
auf den Sonaten und
Suitensätzen seiner
Trompetenschule zeigen
ihre große Beliebtheit
und weitverbreitete
Anerkennung.
Peter
Kertz
(EMI
Electrola 1 C 037-45
579)
|
|