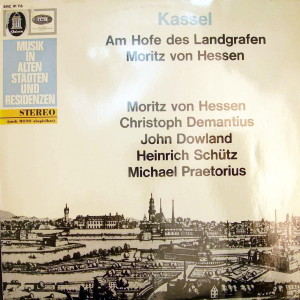 |
|
1 LP -
C 91 116 - (p) 1965
|
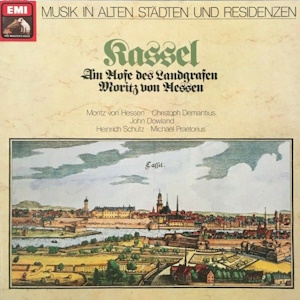 |
| 1 LP -
1C 037-45 577 - (p) 1965 |
|
| KASSEL - Am Hofe
des Landgrafen Moritz von Hessen |
|
|
|
|
|
| Moritz von Hessen
(1572-1632) |
Pavana del
Francisco Segario - in "Erbe
deutscher Musik", Land Kurhessen I
|
1' 43" |
A1
|
|
Friedrich
Schmidtmann, Sopran-Blockflöte |
Helmut Hucke, Diskant-Pommer |
Helmut Schmitt, Alt-Posaune
Alfres Lessing, Tenor-Gambe |
Horst Hedler, Tenor-Gambe
|
|
|
| Moritz
von Hessen |
Gagliarda
Brunsvicese - in "Erbe deutscher
Musik", Land Kurhessen I |
1' 23" |
A2 |
|
Heiner Spicker,
Diskant-Gambe | Alfred Lessing,
Wolfgang Eggers, Alt-Gambe
Horst Hedler, Tenor-Gambe |
Heinrich Haferland, Tenor-Gambe
|
|
|
| Christoph Demantius
(1567-1643) |
Diese
Nacht hatt ich ein Traum - aus
"Fasciculus Chorodiarum", 1613, Nr.
10 |
1' 01" |
A3 |
|
Helen Donath,
Sopran | Alfons Jonen, Tenor |
Friedrich Schmidtmann,
Sopran-Blockflöte
Edward H. Tarr, Zink | Helmut
Schmitt, Tenor-Posaune |
|
|
| Christoph Demantius |
Galliarde
II - aus "77 neue
auserlesene polinischer und
deutscher art Tänze mit und
ohne Texten 4- und 5st.",
Nürnberg 1601 |
1' 19" |
A4 |
|
Friedrich
Schnidtmann, Rosemarie
Daehn-Wilke, Sopran-Blockflöte |
Werner Neuhaus, Violine
Edward H. Tarr, Zink |
Helmut Schmitt, Tenor-Posaune |
|
|
| Christoph Demantius |
Zart
schönes Bild - aus "Anderer
Theil neuer deutscher Lieder", 1615,
Nr. 2 |
1' 27" |
A5 |
Helen Donath,
Sopran | Alfons Jonen, Tenor |
Franz Müller-Heuser, Baß
Friedrich Schmidtmann,
Sopran-Blockflöte | Helmut
Schmitt, Tenor-Posaune
|
|
|
| Moritz von Hessen |
Pavana del
povero soldato - in "Erbe deutscher
Musik", Land Kurhessen I |
1' 43" |
A6 |
|
Franz
Willi Neugebauer, Kurt
Schmidt, Zink | Helmut
Schmitt, Alt-Posaune
Wilhelm Wendlandt,
Tenor-Posaune | Kurt
Fedderowitz, Baß-Posaune
|
|
|
| Moritz von Hessen |
Gagliarda del
Sopradetto - in "Erbe deutscher
Musik", Land Kurhessen I |
2' 10" |
A7 |
|
Friedrich
Schmidtmann, Sopran-Blockflöte |
Helmut Hucke, Diskant-Pommer |
Alfred Lessing, Heinrich
Haferland, Tenor-Gambe
Werner Mauruschat, Baß-Pommer |
Franz Willi Neugebauer, Kurt
Schmidt, Zink
Wilhelm Wendiandt, Tenor-Posaune
| Kurt Federowitz, Baß-Posaune |
|
|
| Moritz von Hessen |
Madrigal
"Avanturoso piu d'altro terreno"
- in "Erbe deutscher
Musik", Land Kurhessen II |
1' 35" |
A8
|
Helen
Donath, Sopran | Alfons
Jonen, Tenor | Franz
Müller-Hauser, Baß
Friedrich Schmidtmann,
Sopran-Blockflöte |
Edward H. Tarr, Zink |
|
|
John Dowland
(1562-1626)
|
Can
she excuse my wrongs? - aus "First Book
of Airs 1597" Part 1 (Nos. 1-10)
in "The English School of Lutenist
Song Writers" |
3' 10" |
A9 |
|
Barry McDaniel, Bariton | Michael
Schäffer,
Renaissance-Laute
|
|
|
| John Dowland |
Pavana
"Semper Dowland, semper dolens"
- London 1604 |
6' 11" |
A10 |
|
Heiner
Spicker, Diskant-Gambe
| Alfred Lessing,
Wolfgang Eggers,
Alt-Gambe | Horst
Hedler, Heinrich
Haferland, Tenor-Gambe |
|
|
| John Dowland |
Say, Love, if
ever thou didst find - aus
"Third Book of Airs 1603", Songs I
to X, in "The English Lute-Songs",
Series I |
1' 33" |
A11 |
|
Barry
McDaniel,
Bariton |
Michael
Schäffer,
Renaissance-Laute
|
|
|
| Moritz von Hessen |
Pavana
del Francisco Segario - in "Erbe deutscher
Musik", Land Kurhessen I |
1' 43" |
A12
|
|
Friedrich
Schmidtmann, Sopran-Blockflöte |
Helmut Hucke, Diskant-Pommer
Helmut Schmitt, Alt-Posaune |
Alfred Lessing, Horst Hedler,
Tenor-Gambe
|
|
|
Alfred Lessing,
Diskant-Gambe | Herbert Naumann,
Alt-Gambe | Heinrich Haferland,
Tenor-Gambe
|
|
|
Heinrich Schütz
(1585-1672)
|
Aus
der Tiefe ruf ich, Herr, zu dir
- 130. Psalm aus "Psalmen Davids",
Dresden 1619
|
4' 37" |
B1 |
|
RIAS-Kammerchor |
Valerie Noack, Friedrich
Schmidtmann, Tenor-Blockflöte |
Emil Selier, Alt-Viola | Herbert
Naumann, Tenor-Gambe
Heiner Spicker, Violone | Otto
Steinkopf, Baß-Dulcian | Edward H.
Tarr, Zink | Helmut Schmitt,
Alt-Posaune
Harry Barteld, Tenor-Posaune |
Kurt Federowitz, Baß-Posaune |
Wolfgang Meyer, Positiv | Gunther
Arndt, Leitung |
|
|
| Moritz von
Hessen |
Pavana
del Tomaso de Canona
à 5 Tromboni - in "Erbe deutscher
Musik", Land Kurhessen I |
1' 57" |
B2 |
|
Helmut Schmitt,
Harry Barteld, Alt-Posaune |
Wilhelm Wendiandt, Günther
Grätzig, Tenor-Posaune | Kurt
Federowitz, Baß-Posaune |
|
|
| Heinrich Schütz |
Herr, nun
lässest du
deinen Diener
in Frieden
fahren -
Deutsches Konzert aus dem
zweiten Teil der
"Symphoniae sacrae 1647" |
4' 24" |
B3 |
|
Franz
Crass, Baß | Werner
Neuhaus, 1. Violine |
Matthias Nakaten, 2.
Violine | Emil
Morneweg, Kontrabaß
Michael Schäffer,
Renaissance-Laute |
Wilhelm Neuhaus,
Positiv |
|
|
| Michael
Praetorius (1571-1621) |
Christ
unser Herr zum Jordan
kam -
"Concert-Gesang",
Wolfenbüttel 1617
|
9' 30" |
B4 |
|
RIAS-Kammerchor
mit Knaben | Friedrich
Schmidtmann,
Sopran-Blockflöte |
Valerie Noack,
Tenor-Blockflöte |
Emil Seller,
Tenor-Gambe
Otto Steinkopf,
Baß-Dulcian | Heiner
Spicker, Violone |
Edward H. Tarr, Zink |
Helmut Schmitt,
Alt-Posaune | Harry
Berteld, Tenor-Posaune
Kurt Federowitz,
Baß-Posaune | Wolfgang
Meyer, Positiv |
Michael Schäffer,
Renaissance-Lute |
Günther Arndt, Leitung |
|
|
Moritz von Hessen
|
Fuga à 4 -
in "Erbe deutscher
Musik", Land Kurhessen II |
2' 45" |
B5
|
|
Friedrich
Schmidtmann,
Sopran-Blockflöte
| Helmut Hucke,
Diskant-Pommer |
Helmut Schmitt,
Alt-Posaune
Wilhelm
Wendiandt,
Tenor-Posaune |
Werner
Mauruschat,
Baß-Pommer
|
|
|
| Christoph
Demantius |
Her, nun läßt
du deinen Diener in Frieden
fahren - aus "Corona
harmonica", Leipzig 1610 |
4' 10" |
B6 |
|
RIAS-Kammerchor | Friedrich Schmidtmann,
sopran-Blockflöte
| Valerie
Noack,
Tenor-Blockflöte
| Edward H.
Tarr, Zink |
Helmut
Schmitt,
Alt-Posaune
Harry Barteld,
Tenor-Posaune
| Kurt
Federowitz,
Baß-Posaune |
Heiner
Spicker,
Violone |
Wolfgang
Meyer, Positiv
Michael
Schäffer,
Renaissance-Lute
| Günther
Arnst, Leitung
|
|
|
|
|
|
Interpreters (see
above).
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
- |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Fritz
Ganss / Gerd Berg / Christfried
Bickenbach / Horst Lindner |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- C 91 116 - (1 LP) - durata 52'
21" - (p) 1965 - Analogico |
|
|
Altre edizioni
LP
|
|
EMI
Electrola - 1C 037-45 577 - LC
0233 - (1 LP) - durata 52' 21" -
(p) 1965 - Analogico |
|
|
Edizioni CD |
|
- |
|
|
Cover |
|
Matthäus
Merian "KASSEL" 1648 - Sammlung
Bläsner, Bonn / Selva de Mar
|
|
|
|
|
Moritz
von Hessen, Mäzen und
Meister der Musik
Die Zahl der Fürsten,
die um ihrer
persönlichen Leistungen
in Kunst und
Wissenschaft willen auf
den Ruhmesbiättern
abendländischer Kultur
verzeichnet sind, ist
keineswegs gering. Man
denke an Gesualdo,
Fürsten von Venosa, den
ausgezeichneten
Ballett-Tänzer Ludwig
XV., an Friedrich den
Großen und den Prinzen
Louis Ferdinand von
Preußen. Nicht viele
allerdings haben mit
ihrer künstlerischen
Potenz politische
Klugheit und aufrechtes
Fürstentum in solchem
Maße vereinigen können
wie Moritz von Hessen.
Moritz, Landgraf von
Hessen, wurde am 25. Mai
1572 in Kassel geboren.
Wichtiger als die Namen
seiner Erzieher, Tobias'
v. Homberg und Caspar
Crucigers, ist für die
Nachwelt der des Mannes,
der Moritz v. Hessen zum
Musiker erzog. Es war
Georg Otto, ein damals
sehr bekannter und
hochgeachteter Musiker
und Komponist, dessen
Werke zuerst vom
spätniederländischen
Motettenstil beeinflußt
waren und später, im
Morgengrauen des
anbrechenden Barock, die
Zeitenwende deutlich und
überdies in trefflicher
Satzkunst widerspiegeln.
Otto wurde auch der
Organisator der
ausgezeichneten Kasseler
Hofkapelle. Die Größe
des Wirkungs- und
Einflußbereiches sowie
der weite künstlerische
Horizont dieses Mannes
(er starb 1618 -
achtundsechzigjährig -
an der Pest) und endlich
seine pädagogische
Lauterkeit bildeten die
geistige und
handwerkliche Grundlage
für das eigene
ungewöhnliche Talent des
zukünftigen Landgrafen
Moritz. Der
Dreißigjährige Krieg
(1618 bis 1648) mit
seinen chaotischen
politischen und
apokalyptischen sozialen
Zuständen, aber auch
heillos komplizierte
Erbstreitigkeiten
machten Moritz die
Regierung in steigendem
Maße schwierig; als 1627
schließlich die
charakterschwache
hessische Ritterschaft -
obwohl doch aus
unbeugsamen Protestanten
bestehend - mit der
katholischen Liga
gemeinsame Sache machte,
war es für den
rechtschaffen und lauter
denkenden und handelnden
Moritz von Hessen zuviel
(sein Wahlspruch hieß
„Omnibus aequum" =
„Allen gleich recht“),
er dankte ab und lebte
bis zu seinem Tode am
15. März 1632 nur noch
seinen geistigen und
besonders seinen
künstlerischen
Neigungen.
Sie indes hatten von
jeher sein eigentliches
Wesen ausgemacht und
Moritz von Hessen im
Geistesleben. vollends
aber im Musikleben
Europas zu einer
Persönlichkeit werden
lassen, mit der
Verbindung zu suchen und
zu pflegen auch die
Größten der Zeit nicht
für Hofschranzentum
hielten. Gabriel,
Praetorius, Demantius,
Hans Leo Haßler, auch
John Dowland, der größte
Lautenist seiner Zeit
und eigentliche Schöpfer
des Liedes als legitime
Kunstform - sie alle
pflegten mit Moritz von
Hessen Umgang oder
Briefwechsel als mit
ihresgleichen, als mit
einem ebenbürtigen
Fürsten der Musik. Denn
mag der Mäzen Moritz
auch eine nie
versiegende Quelle
materieller Förderung
großer Talente gewesen
sein, so können der
preziöse Lautenist
Moritz von Hessen und
vollends der Komponist
Moritz von Hessen den
fürstlichen Mäzen
geradezu vergessen
lassen.
Die Zahl von Moritz'
Musikwerken ist
stattlich. Sie enthält
sowohl Vokal- als auch
instrumentalmusik. Die
wichtigsten Vokalwerke
sind die Zehn Gebote
Gottes, der Lobgesang
Simeonis und eine
Sammlung von Motetten.
Doch nicht die
Vokalmusik war Moritz'
von Hessen eigene
Domäne, sondern die
Instrumentalmusik, in
der er Außerordentliches
geschaffen hat, das auch
hohe Vergleiche
ungefährdet aushält.
Anders als bei den
Vokalwerken läßt sich
bei Moritz' von Hessen
Instrumentalmusik kein
besonderes oder gar
Hauptwerk nennen,
sondern ihre Aufzählung
kann nur in dem
summarischen Plural
geschehen, der für die
weltliche
Instrumentalmusik des
Mittelalters bezeichnend
war: „Paduanen,
Galliarden, Fugae,
Canzonen, Madrigale,
Intraden“; das ist die
Mehrzahl, in der die
Meister des Mittelalters
auch ihre noch so
kostbaren instrumentalen
Kleinode, wie zur
Agraffe oder zu einem
Sträußlein
zusammengefaßt, an den
Tag zu legen pflegten.
Damit ist auch über die
Instrumentalmusik
Moritz' von Hessen das
für sie
Charakteristische
gesagt. Obwohl der
Lebenszeit ihres
Schöpfers nach zwischen
dem letzten Schein des
Mittelalters und dem
ersten Dämmern des
Barock entstanden,
gehört sie ihrer
geistigen Substanz,
ihrem Klang und ihrer
inneren wie äußeren
Bewegung nach noch dem
Mittelalter an, das
damals eben im Erlöschen
war, während man in
Venedig schon den Tod
Gabrielis und in ihm den
Anbruch des neuen
Zeitalters erwartete.
Die Paduanen (Pavanen),
Galliarden, Intraden,
Canzonen und Madrigale
(die zuletzt genannten,
wie Air oder Aria, aus
der vokalen in die
Instrumentalmusik
übernommen) sind, wie
später die Sätze der
barocken Suite,
Tanzformen. im Gegensatz
zum gegenwärtigen etwas
zu esoterischen Trachten
nach möglichst
abstrakten Formen
verschmähte damals kein
Meister die Tanzformen
als Behältnisse auch der
abstraktesten
musikalischen Gedanken.
Die Paduanen, Galliarden
und Canzonen Moritz' von
Hessen gehören noch dem
musiksoziologischen
Zeitalter an, wo Musik
noch fern war von der
späteren und erst recht
der heutigen
„Vermenschiichung“ durch
die vordergründige Rolle
dessen, der sie spielt.
Damals galt noch nicht
der „Interpret“, ja,
meistens war nicht
einmal das Instrument
expressis verbis
vorgeschrieben; vielmehr
wurde die Disposition
zur Besetzung eines
Werkes dem damals
unfehlbaren Sinn für
seine Substanz aus dem
wundersam schönen
Instrumentarium der Zeit
getroffen: Blockflöte,
Pommern als Diskant,
Alt, Tenor oder Baß,
Gamben in allen
Stimmlagen, dann Zink,
Posaunen, Laute,
Spinettino; wurde
freilich auch im
glücklichen Besitze und
in der durch nichts
getrübten Gewißheit
einer heute leider schon
fast unbegreifiichen
Fähigkeit getroffen:
diese allem Frenetischen
oder auch nur Lauten
abgewandte, still
inständige Musik in
jeglicher Besetzung und
selbst in unvollkommener
Ausführung gleichsam von
Angesicht zu Angesicht
wahrzunehmen und in
ihrer glückseligen
Vereinigung von
Transzendenz und
betörender irdischkeit
ganz zu begreifen.
Friedrich
Schmidtmann
Christoph Demantius
Christoph Demantius
wurde am 15. Dezember
1567 zu Reichenberg in
Böhmen geboren, war also
knapp achtzehn Jahre
älter als Heinrich
Schütz, der ihn aber um
fast drei Jahrzehnte
überlebte. Bereits als
Wittenberger und
Leipziger Student
veröffentlichte
Demantius mehrere
Gelegenheitswerke, die
bei Fachleuten Beifall
fanden. Anno 1597
erhielt er den
angesehenen Posten des
Zittauer Stadtkantors;
freilich fühlte er sich
in dieser Position nicht
recht glücklich, weil
verworrene
Schulverhäitnisse seine
Schaffenskraft lähmten.
Deshalb reichte er im
April 1604 seine
Bewerbung um das vakante
Amt des Freiberger
Domkantors ein, gestützt
auf das Gutachten eines
autoritativen Gönners,
der den „berühmten und
kunstreichen Musicus“
den Behörden der
sächsischen
Bergmannsstadt
nachdrücklich empfah!.
Hier blieb er nun nach
erfolgreich abgeiegter
Probe seßhaft.
Hochbetagt starb er in
Freiberg am 20. April
1643.
Ein befreundeter
Chronist widmete seinem
Andenken lateinische
Distichen, die in
deutscher Übersetzung
lauten: „Soiang Apoll
den Sangesmeister, der
holden Musen Chor
umringt, Solang in
klangerfüllten Kreisen
dankbar das Lied zu Gott
erklingt: Solange wird
man deinen Namen,
Demant, mit hohem Lobe
preisen, Und deine Töne
gute Gabe wird später
Nachruhm noch erweisen".
Auch in Freiberg konnte
sich Christoph Demantius
nur mit Mühe
durchsetzen. Der
unterricht an der
Stadtschule, der
zwangsläufig zu den
Aufgaben des Domkantors
gehörte. machte ihm
wenig Freude: freilich
scheint es, daß er auch
geringe pädagogische
Begabung besaß, ähnlich
wie später Johann
Sebastian Bach, der sich
am liebsten in
Elementarklassen
vertreten ließ. Außerdem
schildert der Rektor
seinen Kollegen -
vermutlich
wahrheitsgemäß - als
„turbulentum ingenium“,
als „unverträglichen
Geist“. Vor allem aber
mußte Demantius - ebenso
wie Heinrich Schütz in
Dresden - beruflich wie
persönlich unter den
Schrecken des
Dreißigjährigen Krieges
leiden, der in
Kursachsen noch
grausamer wütete als in
anderen deutschen
Provinzen. Marodierendes
Gesindel schleppte
Seuchen ein, die die
Bevölkerung dezimierten;
Kontributionen
schwächten die
Finanzkraft ehemals
reicher Bürger, und
unter dem Einfluß der
rauhen und rohen
Soldateska verwilderten
die Sitten. So
interessierten sich nur
noch wenige Einwohner
für kulturelle
Veranstaltungen; für die
Beschaffung neuer Noten
fehlte das Geld; für
stärker besetzte Musik
standen nicht genug
Mitwirkende zur
Verfügung, und dem
Dirigenten gelang es
manchmal kaum, die
Disziplin des Chores
aufrechtzuerhalten.
Trotzdem entstanden und
erschienen in dieser
unruhigen Zeit
gewichtige Werke von
Christoph Demantius,
darunter, chronologisch
geordnet: 1601: Sieben
vnd siebentzig Newe
außerlesene,
Liebliche, Zierliche,
Polnischer vnd
Teutscher Art Täntze,
mit und ohne Texten,
zu 4. vnd 5. Stimmen;
1602: Isagoge artis
musicae... Kurtze
Anleitung recht vnd
leicht singen zu
lernen mit dem
ersten alphabetischen
Musikwörterbuch, bis
1671 in zehn Auflagen
herausgegeben; 1610: Corona
harmonica. Außerlesene
Spruch aus den
Evangelien, auff alle
Sontage vnd Fürnembste
Fest durch das gantze
Jahr, mit sechs
Stimmen; 1613: Fasciculus
chorodiarum. Newe
Liebliche vnd
Zierliche, Polnischer'
vnd Teutscher art,
Täntze vnd Galliarden
mit vnd ohne Texten,
zu 4 vnd 5 Stimmen;
1615: Ander Theil
Newer Deutscher
Lieder... mit fünff
Stimmen gesetzet.
An dieser Liste, bei der
es sich allerdings nur
um einen kleinen Auszug
handelt, fallen die
Lieder im Rhythmus
deutscher und
polnischerNationaltänze
auf, die nach Belieben
gesungen oder auf
Instrumenten gespielt
werden können. Demantius
schrieb sie in einer
Notzeit der Geschichte
unter soziologischem
Aspekt für ein Publikum,
das "eine recreation
begehret, wenn es durch
seine vielfältigen
occupationes abgemattet
oder unlustig gemachet
ist." Selbstverständlich
nahm er diese sogenannte
"Unterhaltungsliteratur"
ebenso ernst wie seine
Evangelienmotetten,
Begräbnisgesange,
Choralbearbeitungen und
seine sechsstimmige Passion
nach Johannes.
Die Produktion des
Meisters wuchs
schließlich derart an,
daß sich 1618 ein
einheimischer Verlag
etablierte, der zunächst
ausschließlich
Kompositionen des
Freiberger Kantors
druckte. Diese Noten
verbreiteten sich rasch
über das ganze Land und
gingen auch ins
Repertoire der Kasseler
Hofkapelle über; so
heißt es beispielsweise
in den Rechnungen, die
das Marburger
Staatsarchiv aufbewahrt:
„2 goldgulden Demantio
einem componisten, so l.
f. gn. (Ihrer
Fürstlichen Gnaden)
newliche cantiones
verehrt“.
Gotthold
Frotscher
John Dowland
Unter der Regierung
Elisabeth I. und James
l. errang die englische
Musik ihren ersten
Höhepunkt europäischer
Wirkung. Den größten
Anteil an diesem Erfolg
hatten
Lautenkompositionen.
Etwa ab 1580 zeichnet
sich eine Entwicklung
ab, die volkstümliche
Elemente mit höfischer
Verfeinerung erband. Die
Errungenschaften
europäischer Polyphonie
wurden in kunstvoller
Form um einen einfachen
melodischen Kern gelegt;
gleichzeitig gewannen
die besten Komponisten
(erwähnt seien nur
William Byrd und Robert
Parsons) ihrer
verfeinerten Satztechnik
eine bislang unbekannte
Gefühlstiefe ab, so daß
man die Epoche um 1600
mit Recht als das
Goldene Zeitalter
englischer Musik
bezeichnet. Dieser
plötzliche Aufschwung
steht nicht ohne Bezug
zur politischen,
wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung des
damaligen Englands. Das
Britische Reich dehnte
sich sowohl nach Amerika
als auch nach Asien aus,
und das handeltreibende
Bürgertum konnte sich
Vergnügungen leisten,
die zuvor nur der
Adelsschicht vorbehalten
waren. Das musikalische
Leben am Hof der ersten
Elisabeth wurde eifrig
in bürgerlichen Kreisen
nachgeahmt, und die
Künste, unter denen die
Musik keine geringe
Rolle spielte, wie auch
die Wissenschaften
nahmen einen ungeheuren
Aufschwung. Für die hohe
Wertschätzung, welche
die Musik fand, lassen
sich allein bei
Shakespeare so
zahlreiche und
ergriffene Belege finden
wie bei keinem späteren
großen Dichter. So wird
es auch verständlich,
daß trotz höfischen und
bürgerlichen
Mäzenatentums zum ersten
Mal in der englischen
Musikgeschichte der
freie Berufsmusiker ohne
feste Anstellung leben
konnte. Dieser
Konsolidierung der
sozialen Position
entsprach auf der
anderen Seite ein über
den bürgerlichen oder
gar höfischen
Verstehenshorizont
gehendes Streben nach
persönlicher Autonomie,
das seinen sichtbarsten
Ausdruck im unsteten
Wanderleben findet, zu
dem sich viele der
bedeutendsten
Komponisten jener Zeit
innerlich gezwungen
fühlten. Auch John
Dowland (1562-1626)
gehört zu jenen, deren
Leben aus der festen
Bahn geworfen wurde.
Wegen seines
katholischen Glaubens
(den er in späteren
Jahren aufgab) wurde er,
ähnlich wie Byrd, in
England verfolgt. So
trieb es ihn auf den
Kontinent, wo er in
Paris, Kassel, Venedig
und Florenz wirkte. Hier
machte er sich mit allen
Neuerungen europäischer
Musik vertraut, die er
bruchlos seinen
Kompositionen
einzuverleiben verstand.
Eine Zeit der äußeren
Ruhe und Seßhaftigkeit
fand Dowland als
Kammerlautenist des
dänischen Königs von
1598 bis 1606. Aber es
trieb ihn gegen Ende
seines Lebens wieder
nach England zurück, wo
er ab 1616 zum
Königlichen Lautenisten
ernannt wurde und von
seinem Ruhm zehren
konnte. Kein anderer
seiner Zeitgenossen
durfte von sich
behaupten, daß er
„Anerkennung im größten
Teil Europas gefunden
und daß man in acht
großen kontinentalen
Städten seineWerke
gedruckt“ habe. Seine
Kompositionen fallen in
zwei Formgruppen: den
Gesang mit
Lautenbegleitung sowie
reine Instrumentalsätze.
Zur ersten Gattung
gehören seine drei Books
of Songs or Ayres
(1597, 1600 und 1603),
zum zweiten Genre seine
1605 veröffentlichten Lachrymae
or seaven Tears
figured in seaven
passionate Pavans.
Die Lautenkompositionen
Dowlands zeichnen sich
aus durch eine
Vereinigung von
ausdrucksvoller Thematik
und reich figurierter
Begleitung. Der große
melodische Bogen, der
die Kompositionen seiner
Zeitgenossen Rosseter,
Campian, Morley und Ford
charakterisiert, ist
zwar auch bei ihm
vorhanden, aber weniger
glatt ausgeschrieben.
Der Melodielinie
Dowlands eignet eine
gewisse Spröde, kühne
Intervallkombinationen
und lebhafte Bewegung.
Der scheinpolyphone Stil
der Satztechnik
verbindet sich bei ihm
mit ungewöhnlicher
Leidenschaftlichkeit im
Ausdruck, die
chromatischen Harmonien
unterstützen
deklamatorische Momente.
Ein weiteres
Charakteristikum findet
sich bei Dowlands
Vokalkompositionen in
der Identität von Wort
und Musik. Seinen
Lautenliedern haftet die
Zerbrechlichkeit
feinster Schöpfunger an,
deren Gleichgewicht eben
durch die ausgewogene
Instrumentierung
dichterischer Sprache
gegeben ist. Anders als
in den spanischen und
italienischen
Vokalkompositionen der
gleichen Zeit wird von
den Elisabethanischen
Lautenkomponisten, und
besonders von Dowland,
keine dramatische
Miniaturszene in Musik
umgesetzt; vielmehr
glückt den Engländern
eine Subjektivierung des
Ausdrucks, so daß man
von musikalischer
Gefühlslyrik sprechen
kann. Die Wirkung dieser
Lieder auf den Hörer
erklärt sich dadurch,
daß nicht eine textliche
Vorlage objektiv
dargestellt wird,
sondern allein dadurch,
daß die Spannung
zwischen dem sachlichen
Vorwurf und der
musikalischen Form
völlig im Gefühl
aufgeht. Darin war
Dowland (geschichtlich
gesehen) seinen
Zeitgenossen überlegen.
Die Subjektivierung
seiner Gesänge weist auf
das deutsche Kunstlied
der Romantik hin, ja sie
steht Schubert
entschieden näher als
etwa den Liedern
Mozarts. So ist es auch
kein Zufall, daß
Dowland, von wenigen
Liedern abgesehen,
Liebesgedichte vertont,
und zwar meist düsteren
Inhalts. Immer zielt er
auf Identifizierung von
Innen und Außen und
nimmt damit den
musikalischen
Symbolismus der Lieder
des 19. Jahrhunderts
vorweg.
Ulrich
Schreiber
Heinrich Schütz
Heinrich Schütz, am 14.
Oktober 1585 zu Köstritz
in Thüringen als Sohn
eines Gastwirts geboren,
trat im Alter von
vierzehn Jahren in das
Kasseler Collegium
Mauritianum ein, das
Landgraf Moritz „Der
Gelehrte“ kurz vorher
für Pagen, Edelknappen
und Kantoreiknaben
begründet hatte. Er
erhielt in dieser
Musteranstalt eine
umfassende humanistische
Bildung, wirkte als
„alumnus symphoniacus“
bei den regelmäßigen
Aufführungen in der
Kirche wie im
Schlosse mit und lernte
unter Anleitung des
Hofkapellmeisters Georg
Otto eine reichhaltige
Literatur gründlich
kennen. Zunächst dachte
Heinrich Schütz
allerdings überhaupt
nicht daran, sich für
einen musikalischen
Hauptberuf zu
spezialisieren. Dem Rate
ängstlicher Verwandter
folgend, belegte er nach
dem Abgang von der
Schule an den
Universitäten Marburg,
Frankfurt an der Oder,
Jena und Leipzig
juristische Kollegs und
Seminare, um einen
akademischen Grad zu
erwerben und sich danach
um den sicheren Posten
eines Verwaltungsbeamten
zu bewerben. Doch dann
griff der Landgraf,
selber ein tüchtiger
Komponist, als
großzügiger Mäzen in das
Schicksal des jungen
Mannes ein, als dieser
seine Berufung noch
nicht erkannte: Im
Frühling 1609 schickte
er seinen Protegé mit
ei^em stattlichen
Stipendium zum
intensiven Fachstudium
bei dem veltberühmten
Venezianer Maestro
Giovanni Gabrieli nach
Italien, das damals
Malern, Dichtern und
Musikern als „Gelobtes
Land“ galt.
Wahrscheinlich wollte
der Hohe Herr seinen
Günstling durch dieses
Beneficium' für dauernd
zu seinen Diensten
verpflichten; jedenfalls
ernannte er vorerst den
jungen Meister nach der
Rückkehr aus italien pro
forma zum Zweiten
Hoforganisten ohne
festgelegtes
Arbeitspensum. Auch in
dieser günstigen
Situation konnte sich
Schütz noch immer nicht
für die Kunst oder die
Wissenschaft
entscheiden; in seinem
"fast mühseellgen
Lebenslauf" erzählt er
später: „Undt ermangelte
damahls auch an meiner
Eltern und anverwandten
Raht und antrieb noch
nicht, welcher meinung
kurz umb war, das durch
anderweit meine zwar
geringe Qualiteten, Ich
mich bedient zu machen
und förderung zu
erlangen trachten, die
Music aber als eine
nebensache tractirer
solte“.
Schließlich trat ein
scheinbarer Zufall ein,
der unter
geschichtlichem Aspekt
wie eine Fügung anmutet:
Der hessische Lardgraf
nahm zu zwei
Staatsbesuchen seinen
Titular-Organisten in
seinem Gefolge mit nach
Dresden; und hier machte
Schütz als Sub-Dirigent
mehrchöriger Motetten
von Michael Praetorius
so starken Eindruck auf
die adlige Gesellschaft,
daß der Wettiner
Kurfürst ihn zu
engagieren wünschte.
Moritz gab seinen
Schützling nur ungern
frei; doch er wollte der
Laufbahn des Genies
nicht im Wege stehen und
mußte wohl auch aus
diplomatischen Gründen
Rücksicht auf gute
Beziehungen zu einem
mächtigen Regenten
nehmen. So übernahm denn
Heinrich Schütz
offiziell am 12. Februar
1617 die Leitung der
leistungsfähigen
Sächsischen Hofkapelle:
und er verwaltete dieses
repräsentative Amt
länger als ein halbes
Jahrhundert, bis er -
hochbetagt - am 6.
November 1672 in Dresden
starb. Zeitlebens
erhielt er die
Verbindung mit der
hessischen Residenzstadt
aufrecht. Noch nach dem
Tode des Landgrafen
Moritz schickte er
persönlich seine neun
Kompositionen nach
Kassel. Die
Landesbibliothek besitzt
seither als kostbaren
Schatz viele seiner
Manuskripte (zum großen
Teil Unica), ferner eine
fast lückenlose Sammlung
von Originalausgaben
seiner Werke, darunter
die Psalmen Davids,
als opus 2 anno 1619
gedruckt, und die Symphoniae
sacrae, deren
zweiter Teil im Jahre
1647, kurz vor dem Ende
des Dreißigjährigen
Krieges. erschien.
Gebrauchsspuren an den
abgegriffenen
Notenblättern beweisen,
daß man in Kassel diese
erhabene Musik seit je
gern und oft sang,
spielte und hörte.
Gotthold
Frotscher
Michael Praetorius
Wie Heinricn. Schütz
stammt auch Michael
Praetorius aus
Thüringen. Er wurde in
Creuzburg an der Werra
(Bezirk Eisenach)
geboren, wahrscheinlich
am 15. Februar 1571;
allerdings läßt sich
dieses Datum urkundlich
nicht belegen. Sein
Vater, der seinen
Familiennamen noch nicht
latinisierte und sich
auf gut Deutsch
Schulteis oder Schultze
nannte, mußte als
orthodoxer Lutheraner
wegen konfessioneller
Streitigkeiten bald
seine dortige
Pfarrstelle aufgeben und
siedelte nach Torgau
über, wo sein jüngster
Sohn aufwuchs.
Erstaunlich früh ließ
sich Michael Praetorius
in die Matrikel der
berühmten Universität
Frankfurt an der Oder
eintragen; während des
Studiums der Theologie
und Philosophie wirkte
er hier als Organist der
Marienkirche. Dann trat
er in die Dienste des
Halberstadter Herzogs
Heinrich Julius. Am 7.
Dezember 1604 erhielt er
die Bestallung zum
Braunschweigischen
Hofkapellmeister,
verbunden mit den
Organistenämtern in
Gröningen und
Wolfenbüttel. Außerdem
stellte er sich oft und
gern mit seinem
künstlerischen Rat und
seinem organisatorischen
Geschick anderen Städten
zur Verfügung und reiste
für kürzer oder länger
u. a. nach Bückeburg,
Dresden, Halle, Kassel,
Leipzig, Magdeburg,
Naumburg, Nürnberg und
Sondershausen. Am 15.
Februar 1621, also
vermutlich an seinem
fünfzigsten Geburtstag,
starb der
vielbeschäftigte und
unermüdlich tätige Mann
in Wolfenbüttel.
Als systematischer
Musiktheoretiker
übertrifft Michael
Praetorius frühere
Autoren durch profundes
Wissen und präzise
Definitionen; sein
dreibändiges „Syntagma
musicum", heute wieder
in Faksimileausgaben
zugänglich, behandelt
alle wesentlichen Fragen
der Aufführungspraxis,
des Instrumentenbaues,
der Formenkunde usw. Als
Komponist gehört er zu
den fleißigsten Meistern
seiner Epoche, und das
will wahrlich viel
heißen zu einer Zeit, in
der die meisten Kantoren
kaum einen Tag vergehen
ließen, ohne ein paar
Seiten Noten zu
schreiben. Viele Werke
überließ er
unentgeltlich karg
besoldeten Kollegen in
der Provinz, um ihre
wichtige Kulturarbeit in
armen Gemeinden
selbstlos zu
unterstützen.
Mit dem hessischen
Landgrafen Moritz stand
Michael Praetorius in
freundschaftlicher
Verbindung; das bezeugt
unter anderm ein
kunstvoller Concert-Gesang
Christ unser Herr zum
Jordan kam, den er
dem Fürsten
beziehungsvoll zu einer
Tauffeier am 26. Juni
1617 widmete.
Gotthold
Frotscher
Englische Musiker in
Deutschland
Die rasch aufblühende
Musikkultur des
deutschen Frühbarock ist
en Ergebnis der
Assimilierung. Vor allem
waren es natürlich
italienische und
französische Einflüsse,
die der Entstehung eines
spezifisch deutschen
Musizierstils ihren
Stempel aufdrückten.
Verhältnismäßig wenig
bekannt aber ist es, wie
stark insbesondere die
eigenständige deutsche
Instrumentalmusik
vorübergehend durch
englische Musiker
angeregt wurde. Neben so
europäischen
Berühmtheiten wie dem
Lautenisten John Dowland
und dem Virginalisten
John Bull finden sich in
den Jahren zwischen 1580
und 1630 fast in jedem
Kapell-Register
deutscher Höfe Namen
ausgewanderter
englischer Musiker, die
als geschätzte Violin-
und Lautenspieler den
wechselvollen und mit
mancherlei
Unduldsamkeiten
geführten
Glaubensstreitigkeiten
ihrer Heimat entflohen
waren. Oft treten diese
Musiker in ganzen
„Compagnien“ auf, und
zur Zeit von Elizabeth
I. und Jacob I.
durchzogen englische
Schauspielertruppen ganz
Europa. Die reich mit
Musik durchsetzten
Stücke ihres Repertoires
wurden durch ein äußerst
typisches und
charaktervolles Ensemble
bestritten, das
sogenannte gemischte
Consort (Laute, Zither,
zwei bis drei Violen,
Baß-Gitarre, Blockflöte,
Pfeife und Trommel).
Durch englische
Violisten, wie Brade,
Simpson, Flood, Price,
Jordan, Dixon u. a.,
wurde der
kunstvoll-polyphone,
durch rhythmisches
Raffinement bereicherte
Streichersatz in
Deutschland heimisch.
Einzelne Typen von
Tanzsätzen, wie die
„Branden", die
Mascheraden und die
Volten, bürgerten sich
auf diese Weise ein, und
so wurde eine
entscheidende
Erweiterung des
ursprünglichen
Tanzpaares: Pavane und
Galliarde eingeleitet,
eine Entwicklung, die
dann entscheidend die
Entstehung der Suite in
Gang setzte. Die
Tanzmusik jener Zeit,
wie sie uns von Scheidt,
Haußmann, Otto und
anderen vorliegt, ist
ohne das Wirken dieser
englischen Musiker nicht
denkbar.
Aber nicht nur als
Komponisten, sondern
auch als Kapellmeister
und vorzügliche
Instrumentalisten haben
die englischen
Emigranten nachhaltig
auf die Musizierpraxis
ihres Gastlandes
eingewirkt. Insbesondere
Dowlands Lautenlieder in
ihrer für jene Zeit
ungewöhnlichen
Subjektivität, ihrer
sangbaren Melodik und
dem bezwingenden
melancholischen Charme
ihrer Harmonien waren so
populär und durch
zahlreiche deutsche
Nachdrucke verbreitet,
daß man ihren Einfluß
auf das private und
höfische Musizieren
nicht hoch genug
einschätzen kann.
(EMI
Electrola 1 C 037-45
577)
|
|