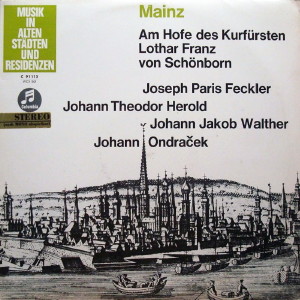 |
|
1 LP -
C 91 111 - (p) 1963
|
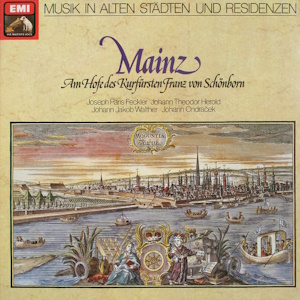 |
| 1 LP -
1C 037-46 524 - (p) 1963 |
|
| MAINZ - Am Hofe
des Kurfürsten Lothar Franz von
Schönborn |
|
|
|
|
|
| Joseph Paris Feckler
(1666-1735) |
Applauso poëtico
al giorno di Nome di Gioseppe Gran
Re de Romani - Kantate für
Sopran, Alt, Baß und Orchester
(Manuskript)
|
28' 35" |
A
|
|
- Sonata ([Grave] ·
Vivace · Grave · Presto
|
|
|
|
-
Aria: "La gloria tua" |
|
|
|
- Rezitativ: "Qual
applausi canori"
|
|
|
|
-
Aria: "Valerò Valerò" |
|
|
|
- Aria: "Ninfe e
pastori" |
|
|
|
-
Rezitativ: "Dal margine adoroso" |
|
|
|
- Terzett: "Biondo
Apoll" |
|
|
|
-
Aria: "Fra il ben Coro" |
|
|
|
- Rezitativ: "Nume
al dolce" |
|
|
|
- Aria:
"Con la spada"
|
|
|
|
- Quartett:
"All'armi alle glorie" |
|
|
|
Maria
Friesenhausen, Sopran | Sylvia
Anderson, Alt | Georg Jelden,
Tenor | Franz Müller-Heuser, Baß
Consortium
musicum: Friedrich
Schmidtmann,
Soprano-Blockflöte |
Helmut Hucke,
Barock-Oboe | Walter
Holy, Clarin
Walter Gerwig, Theorbe
| Walter Thoene,
Cembalo | Horst
Hedler,
Continuo-Violoncello
|
|
|
Johann Theodor Herold
(1660-1720)
|
Sinfonia
zur Siegeskantate (1702) - (Manuskript) |
2' 35" |
B1 |
|
Consortium musicum
|
|
|
| Johann Jakob Walther
(1650-1717) |
Aria
e-moll - aus den Scherzi da
Violino solo con il Basso continuo,
in "Das Erbe Deutscher Musik", Band
17 |
7' 09" |
B2 |
|
-
Malincon · Adagio · Allegro |
|
|
|
Werner
Neuhaus, Violino |
Eugen Müller-Dombois,
Theorbe | Herbert
Naumann, Gambe |
|
|
| Johann Ondraček
(1680-1743) |
Sonata à
Violino, Flauto e Basso da
Signor Jan Ondraček - Sammlung
Biancheton, Paris,
Bibliothéque du
Conservatoire (Manuskript) |
9' 33" |
B3 |
|
-
Allegro assai · Minuetto ·
Scharmante Aria · Andante · Musette |
|
|
|
Valerie Noack,
Flöte | Helga Thoene, Violine |
Horst Hedler, Violoncello
|
|
|
|
|
|
Interpreters (see
above).
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
- |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Fritz
Ganss / Gerd Berg / Christfried
Bickenbach / Horst Lindner |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- C 91 111 - (1 LP) - durata 47'
52" - (p) 1963 - Analogico |
|
|
Altre ediyioni
LP
|
|
EMI
Electrola - 1C 037-46 524 - LC
0233 - (1 LP) - durata 47' 52" -
(p) 1963 - Analogico |
|
|
Edizioni CD |
|
- |
|
|
Cover |
|
- |
|
|
|
|
Musik
am Mainzer Hof unter
Kurfürst Lothar Franz
von Schönborn
Lothar Franz von
Schönborn (geb.
4.10.1655 zu
Aschaffenburg, gest.
20.1.1729 zu Mainz) war
eine der
faszinierendsten
Persönlichkeiten des
deutschen
Barockzeitalters. „Als
Reichsfürst besaß Lothar
Franz mit Bamberg und
Mainz zwei altangesehene
Territorien am Obermain
samt einem Annex in
Kärnten sowie am
Untermain und Rhein samt
dem Eichsfeld und
Erfurt. Die Mainzer
Kurwürde war die
vornehmste, und so war
Lothar Franz im Sinne
des Protokolls der erste
nach dem Kaiser: ihm
oblag es, die Kurfürsten
zusammenzurufen, auch
die Kaiserwahl
anzusetzen, bei der er
vor seinen
Mitkurfürsten, unter
denen mittlervveile
drei, bald vier Könige
waren, die erste Stimme
hatte; sein vornehmstes
Privileg aber war es,
den Kaiser im
Frankfurter Dom zu
krönen.“ (Max H. v.
Freeden). Aber Lothar
Franz begnügte sich
nicht mit dieser Rolle.
Ganz abgesehen von den
vielen Arbeiten seiner
Stellung als Haupt des
Mainzer Erzbistums und
des Bamberger
Fürstbistums, hat er
auch aktiv die deutsche
Reichspolitik geführt
und gelegentlich auch
entschieden
eingegriffen. In seinem
Auftrag stützte sein
Neffe, der
Reichsvizekanzler
Friedrich Karl in Wien
die Reichspolitik des
Prinzen Eugen gegenüber
partikularistischen und
auseinanderstrebenden
Tendenzen. Ein
bescheidenes Beispiel
bildet sein Vorgehen am
Beginn des Spanischen
Erbfolgekrieges. Auch
diese Feststellungen
genügen noch nicht, um
die starke und
vielseitige
Persönlichkeit Lothar
Franzens ins rechte
Licht zu stellen.
Mit ihm bestieg am 30.
April 1695 ein Glied
jener Familie den
Mainzer Erzbischöflichen
Stuhl, die in der ersten
Hälfte des 18.
Jahrhunderts das
künstlerische Angesicht
der Lande von Bamberg
bis Trier veränderten
und jene Bauwerke
erstellen ließen, die
wir heute noch
bewundern. Wer denkt
nicht an die Residenzen
von Mainz, Würzburg,
Bamberg, Trier, die
Schlösser von Werneck,
Pommersfelden, Gaibach,
Seehof, die unzähligen
barocken Kirchen und
Klöster, die damals
gebaut wurden? Dabei
standen den Schönbornern
- einer von ihnen, der
Nefte des Kurfürsten,
Friedrich Karl war
Reichsvizekanzler in
Wien - die besten
Architekten der
damaligen Zeit zur
Verfügung: Maximilian v.
Welsch, Balthasar
Neumann, Johann und
Leonhard Dientzenhofer,
Lukas v. Hildebrandt -
nicht zu gedenken des
jeweiligen Teams von
Bildhauern,
Stukkateuren, Malern,
Ingenieuren, Garten- und
Wasser-baukünstlern, die
mit den Architekten
zusammenarbeiteten! In
einer ausgedehnten
Korrespondenz hat Lothar
Franz die Verbindung mit
den Vertretern des
Wiener Reichsstiles und
mit den Architekten
Ludwig XIV (Boftrand)
aufrechterhalten. Ja er
hatte sich so ernsthaft
in die Materie
eingearbeitet, daß er
mit Stolz darauf
hinweisen konnte, die
große Treppe in
Pommersfelden sei seine
Erfindung, und daß sein
Rat von den Neffen beim
Bau ihrer Schlösser gern
eingeholt wurde.
Er pflegte zu sagen, daß
er vom „Bauwurmb“
besessen sei. Aber er
gab es einmal sogar
schriftlich, daß er von
Musik nichts verstehe.
Ob man das ganz wörtlich
nehmen muß? Jedenfalls
fand er keine Hofkapelle
vor und hatte auch
zunächst nicht die
Absicht, eine zu
gründen. Denn so sehr
verschlang seine Baulust
alle zur Venügung
stehenden Gelder, daß er
nur die ihm standesgemäß
zustehenden Trompeter
besoldete und zunächst
den einzigen großen
Musiker an seinem Hof,
Johann Jakob Walther,
wie sein Vorgänger, als
italienischen
Expeditions-sekretar und
mit einer Pfründe am St.
Viktorstift besoldete.
Erst als er bei der
Kaiserkrönung Karls VI.,
1711 sich die Hofkapelle
des Kurfürsten Johann
Wilhelm von der Pfalz
aus Düsseldorf leihen
mußte, gewannen die
Vorstellungen seiner
Neffen Einfluß. Zuerst
ernannte er den
Canzlisten Johann
Tceoscr Herod zum
Hofkapellmeister, der
aber mit Johann Jakob
Walther und einigen
musikalischen Hofbeamten
und Lakaien wohl nicht
viel zuwege brachte.
Die Freude des
Kurfürsten an der Jagd
sollte es sein, die ihn
zur Gründung einer
Kapelle brachte. Er
stellte nämlich zwei
böhmische
„Jagerhornisten“
(Waldhornisten) ein,
darunter jenen Johann
Ondraček, den er in
Würzburg ausbilden ließ,
und dem es nach dem Tode
Herolds gelang,
allmählich eine Kapelle
aufzustellen. In dieser
Kapelle wirkte Nikolaus
Stulik in den letzten
Jahren des Kurfürsten
als Konzertmeister.
Schon seit 1707 standen
die Neffen des
Kurfürsten, Rudolf Franz
Erwein und Johann
Philipp Franz, der
spätere Würzburger
Fürstbischof, mit dem
Düsseldorfer
Kabinettsmusikdirektor
Joseph Paris Feckler in
Verbindung, ließen sich
von ihm Werke
komponieren, Musikalien
und Instrumente
beschaffen und sogar im
Hinblick auf eine zu
bildende Mainzer
Hofkapelle Sänger
ausbilden. Feckler
selbst wünschte sich
stets ein Kanonikat an
einem Mainzer Stift und
wäre gerne Kurmainzer
Hofkapellmeister
geworden. Leider ging
sein Wunsch erst nach
dem Tode des Kurfürsten
in Erfüllung. Alle diese
Männer stehen mit
Ausnahme von Ondraček
noch ganz in der großen
Tradition der barocken
Musik und ihre Werke
sind den Bauwerken des
Kurfürsten kongenial.
Und so beginnt mit
Lothar Franz der von der
Musikgeschichte seither
nicht beachtete Aufbau
eines Mainzer
Hofmusiklebens, das in
den Meistern Johann
Zach, Johann Franz
Sterkel und Vincenzo
Righini seinen Höhepunkt
erreichen sollte.
Joseph Paris Feckler
Aus einem Brief des
Kurfürsten Lothar Franz
wissen wir, daß Feckler
aus Salzburg stammte, am
19. 3.1666 in Laufen
(Salzach) getauft und am
25. 3. 1690 in Salzburg
zum Priester geweiht
wurde. Als
Erzbischöflicher
Kapellknabe wurde er am
11.10.1679 unter die
Rudimentisten der
Salzburger Universität
inskribiert. Aus seinem
Briefwechsel mit den
Schönborn-Neffen ergibt
sich, daß er sich in
Italien seine
musikalischen Studien
viel hat kosten lassen,
daß er Bernabei kannte
und spätestens seit 1707
als Hofkaplan und
Kabinettsmusikdirektor
bei dem Kurfürsten
Johann Wilhelm in
Düsseldorf lebte, wo er
zugleich dem berühmten
Komponisten und späteren
Apostolischen Vikar der
nordischen Missionen
Agostino Steffani als
Privatsekretär diente.
In dieser Zeit
entstanden Sechs
Concerti für einen
kurpfälzer Prinzen, ein
Miserere für den
Kammerdiener Rudolf
Franz Erweins v.
Schönborn, Sachen aufs
Klavier für die Töchter
Rudolf Franz Erweins und
Märsche für Anselm Franz
v. Schönborn. Außerdem
schrieb Feckler seit
1708 an seinem
„ouvrage“, einem
musiktheoretischen Werk
„del regolato e
cantabile
accompagnamento a tre,
quattro e piu parte
ordinate delle regole
della compositione“.
Alle diese Werke sind
bis heute noch nicht
aufgefunden. Erhalten
ist lediglich der Applauso
poetico al giorno di
Nome et alle glorie
della Sac. Maesto di
Gioseppe Gran Re dei
Romani.
Immer wieder bittet
Feckler in seinen
Briefen an die
Schönborn-Neffen um eine
Anstellung in Mainz, um
ein Kanonikat an einem
Mainzer Stift. Er läßt
sich aus Mainz Wein und
Sauerkraut schicken,
weil er das Düsseldorfer
Bier und Essen nicht
verträgt. Als der
Hofkapellmeister Herold
stirbt, bewarb er sich
um die Nachfolge; aber
er sollte erst auf
Umwegen nach Mainz
kommen. Nach dem Tod
Johann Wilhelms ging er
an den Hof von dessen
Bruder, des Kurfürsten
Franz Ludwig von Trier
als Hofkapellmeister.
Und erst als dieser 1729
die Nachfolge von Lothar
Franz in Mainz antrat,
wurde er auch Mainzer
Hofkapellmeister und
Kanonikus am
Heiligkreuzstift. Er
lebte noch bis 1735 und
wurde am 4.10. auf dem
heute noch vorhandenen
St. Peters-Friedhof
beigesetzt.
Es ist jammerschade, daß
wir nur ein Werk von ihm
besitzen, denn dieser
Applauso poetico stellt
ihn in die Reihe der
ersten Musiker seiner
Zeit. Er beginnt mit
einer Sonate in der Art
der Kirchensonaten
Corellis für
Streichorchester, und
dann folgen 24 Nummern:
Rezitative, Arien und
ein Terzett, in denen
die vier Singstimmen -
Gloria (Sopran), Fama
(Alt), Apollo (Tenor)
und Mars (Baß) - den
Ruhm des Königs singen,
um sich zum Schluß in
der Art der Licenza
einer italienischen Oper
zu einem Quartettfinale
zu vereinigen. Dabei
wechseln von Arie zu
Arie die begleitenden
Instrumente (Generalbaß,
Sologeige, Solotrompete,
Flautino und Oboe, Geige
und Bratsche, Theorbe,
Streichorchester).
Obwohl Feckler zur Zeit,
da er den Applauso
komponierte,
wahrscheinlich nicht in
Mainz war, dürfte Lothar
Franz in diesem Werk den
treuesten Ausdruck
seines Stilwollens
empfunden haben, wenn
der hohe Herr etwas von
Musik verstanden hätte.
Johann Theodor Herold
Der aus einer Mainzer
Familie stammende Herold
muß um 1650 geboren
worden sein, denn am 1.
5.1663 wurde er als
Altist (dh. hoher Tenor)
in die Hofkapelle
aufgenommen. Er sang
also noch unter dem
bedeutenden Komponisten
Philipp Friedrich
Buchner (1614-1669) aus
der Schule Monteverdis.
Vier Jahre später trat
er in die kurfürstliche
Verwaltung über, wurde
1680 Canzlist, 1687
Hofgerichtssekretär und
am 29.10.1695
Hofkapellmeister. Er
scheint aber auch schon
vorher nebenamtlich, wie
so mancher andere, in
der bescheidenen
Hofkapelle musiziert zu
haben. Seine großen Tage
kamen, als auf der
Rückkehr von Landau der
König Josef über Mainz,
Aschaffenburg, Bamberg
nach Wien zurückkehrte.
Dabei hatte Herold am
13. Oktober im
Kurmainzer
Residenzschloß zu
Aschaffenburg, dem König
seine Lautenpartiten -
offenbar als Tafelmusik
- vorgespielt, wie es
der Titel eindeutig
angibt:
Harmonia
quadripartíta
Serenissimi et
Potentissimi
Romanorum Regis
auribus, in arce
Suicardiana
suaviter insonans,
post felicem et
gloriosum Landavij
Ex-pugnationem
Anno quo
ReX
JosephVs atqVe
Regina pLaVDente
lMpelo aVstriaCas
terras bonis a
VibVs repetVnt.
(Chronostichen:
die groß
geschriebenen
Zahlwerte ergeben:
1702).
Man merkt an der
Satzfolge der
Partiten deutlich
den französischen
Einfluß; z. B.
Partia prima:
Ouverture, Suitte,
Eccho, Entrée,
Courente,
Sarrabande, Gigue,
Eccho, Cappriccio
fugato.
Den
Einfluß der
französischen Musik
zeigt auch deutlich die
Cantate, die offenbar
schon in Mainz dem König
vorgespielt worden ist.
Die Verwendung von nur
vier Streichinstrumenten
und einer Tenorstimme
dürfte ziemlich genau
den Bestand der damals
noch sehr bescheidenen
Hofkapelle umschreiben.
Herold starb in Mainz am
26. November 1720.
Johann Jakob Walther
„Neben den Violinsonaten
von J. F. Biber, die
durch die Herausgabe in
den Denkmälern der
Tonkunst in Osterreich
seit langem allgemein
zugänglich sind, gehören
die beiden Werke von
Johann Jakob Walther,
seine Scherzi da
Violino solo und
sein Hortulus
musicus zu dem
Bedeutendsten, was an
violonistischer
Literatur im 17.
Jahrhundert überhaupt
erschienen ist.“ (Gustav
Beckmann). Walther ist
um 1650 in Witterda,
einem zum kurmainzischen
Erfurt gehörigen Dorf
geboren. Wer sein Lehrer
gewesen, wissen wir
nicht Jedenfalls war er
bereits von 1670 bis
1674 Geiger in der
Kapelle Cosimos III. in
Florenz. Dort
konzipierte er auch sein
erstes Werk, die
Scherzi, die er aber
erst 1676 Johann Georg
II. von Sachsen widmete,
in dessen Dienste er
getreten war. Nach dem
Tod seines Herrn ging er
nach Mainz, wo erals
Kleriker (er hatte
offenbar nur die
niederen Weihen) vom
Kurfürsten Anselm Franz
v. Ingelheim ein
Kanonikat am St.
Viktorstift erhielt und
als italienischer
Expeditionssekretär
diente. Auch Lothar
Franz v. Schönborn wußte
ihn zu schätzen und
wolle ihn sogar-
offenbar um sein
Einkommen zu verbessern
- zum Scholastikus am
St. Viktorstift machen,
wogegen aber das Kapitel
bei der Rota Romana
erfolgreich Einspruch
erhob. Walther muß
mitten in der Altstadt
von Mainz gewohnt haben,
denn erwurde am 4.11.
1717 auf dem Friedhof
von St. Emmeran
begraben. Sein zweites
Werk, der Hortulus
Chelicus (das
Geigengärtlein) erschien
1688 in Mainz und
erlebte weitere zwei
Auflagen 1694 und 1708.
Walther muß den aus
Böhmen stammenden
Salzburger Hofmusiker J.
F. Biber gekannt haben;
denn in der Vorrede zur
ersten Auflage der Scherzi
eiferte er gegen die
Künste der Scordatura,
die Biber so raffiniert
pflegte. Unter dem
Eindruck dieser Kritik
hat wohl Biber in seinen
1681 erschienenen „Sonata
a Violino solo“
Die Scordatur ganz
aufgegeben, während
umgekehrt Walther in
seinem Hortulus
Chelicus 1688 ein
Stück mit demselben
Titel und Inhalt hat wie
Biber in seinen Sonaten:
Gara di due Violini
in uno. So bestand
zwischen diesen beiden
größten Violinmeistern
Deutschlands ein
gegenseitiges Geben und
Nehmen.
In den Scherzi
herrscht noch die
italienische Sonate vor,
in der wie in
Frescobaldis Orgelsätzen
rasche und langsame
Sätze abwechseln. Nur
ein Stück der Sammlung
ist eine Suite. Nun
erschien damals in Mainz
eine Ausgabe der
Klavierpartiten J. J.
Frobergers, die die Form
der Suite mit ihrer
Folge von Allmande,
Corrente, Sarabande,
Gigue geschaffen hatten.
Es ist nun interessant
zu sehen, daß in
Walthers Hortulus
Chelicus von 28
Stücken 19 die
Suitenform haben, wobei
Walther manchmal die
Allemande durch eine
Arie ersetzt.
Johann Ondraček
Mit Walther, Herold,
Feckler und Stulik war
die Zeit des
musikalischen Barocks in
Mainz endgültig vorbei.
Der neue
Hofkapellmeister Lothar
Franzens inaugurierte
eine neue Epoche. Schon
1717 wurden zwei
böhmische
„Jagerhornisten“ in die
Hofkapelle eingestellt,
die ihrem Prager Herrn
entlaufen waren. Da dies
einige Schwierigkeiten
machte und da der eine
von ihnen sich nicht
bewährte, schickte
Lothar Franz den sehr
begabten und fleißigen
Jan Ondraček zur
Ausbildung nach
Würzburg, wo einer der
Schönborn-Neffen die
Fortschritte überwachte.
Ondraček lernte bei
Fortunato Chelleri so
gut, daß er bald Messen
komponieren und
aufführen konnte. 1724
hatte ihn Rudolf Franz
Erwein v. Schönborn in
seinem Schloß
Wiesentheid und schrieb
darüber an seinen Onkel
Lothar Franz, daß er ihm
„solchergestalten in
gusto und facilität
gefunden habe, wie es
mir nit vorgestellet.“
Am 5. Mai kehrte
Ondraček nach Mainz
zurück, wo er in der
Favorite „cum summa
approbatione“ in einem
großen Kreis von
Kavalieren und Damen ein
Konzert gab, dessen
Musik als etwas „Rares“
empfunden wurde.
Offenbar hörten die
Mainzer Herrschaften zum
ersten Mal anstatt der
Barockmusik nun Töne der
Vorklassik. Das einzige
bis jetzt aufgefundene
Werk Ondračeks ist eine
Trio-Sonate ohne
Generalbaßbegleitung.
Die beiden Mittelsätze
Menuett und Scharmanta
Aria im herkömmlichen
Stil sind von zwei
Ecksätzen umrahmt, in
der böhmische
folkloristische
Vitalität wie
Frühlingsrauschen durch
die barocke Repräsentanz
stürmt.
(EMI
Electrola 1 C 037-46
524)
|
|