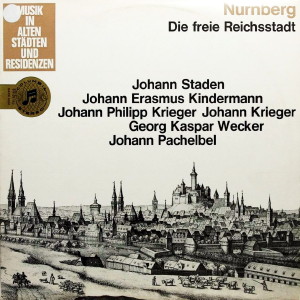 |
|
1 LP -
C 91 110 - (p) 1962
|
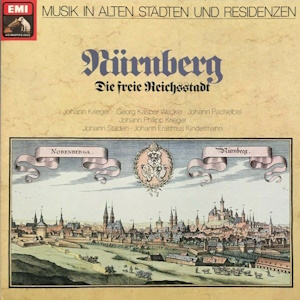 |
| 1 LP -
1C 037-45 575 - (p) 1962 |
|
| NURNBERG - Die
freie Reichsstadt |
|
|
|
|
|
| Johann Erasmus
Kindermann (1616-1655) |
Intrada à cinque
stromenti in C und Ritornello in G
- aus "Deliciae Studiosorum", III,
1643 Nr. 35 in DTB 21-24
|
1' 50" |
A1
|
|
Otto Steinkops,
Albrecht Renz, Zink | Helmut
Schmitt, Alt-Posaune | Harry
Berteld, Tenor-Posaune
Kurt Federowitz, Baß-Posaune |
Walter Thoene, Spinett
|
|
|
| Johann Erasmus
Kindermann |
Murbergisches
Quodlibet - aus "Musical.
Zeitvertreiber" (1655) in "Corydon"
(H. J. Moser) |
4' 35" |
A2 |
|
Friedrike Sailer,
Sopran | Erwin Wohlfart, Tenor |
Hans-Olaf Hudemann, Baß
Hans Köth, Violine | Karl Brehm,
Violoncello | Josef Ulsamer,
Violone | Willy Spilling, Cembalo
|
|
|
| Johann Staden (1581-1634) |
Couranta
- in DTB 8, 2 |
0' 47" |
A3 |
|
Friedrich
Schnidtmann, Sopran-Blockflöte |
Fritjof Fest, Diskant-Krummhorn
Otto Steinkopf, Nicolo | Heinrich
Göldner, Tenor-Dulcian |
|
|
| Johann Staden |
Gagliarda
- in DTB 8, 2 |
0' 45" |
A4 |
|
Helga Thoene,
Violine | Heinz Jopen, Viola |
Emil Seller, Viola | Horst
Hedler, Tenor-Gambe |
|
|
Johann Krieger
(1651-1735)
|
Die
Losung ist: Geld! - aus "Neue
musikalische Ergötzlichkeit" II.
Frankfurt, 1684 |
0' 44" |
A5 |
Theo Altmeyer,
Tenor | Alfred Lessing, Violone
| Walter Thoene, Spinett
|
|
|
| Johann Erasmus
Kindermann |
Ritornello in D
- aus "Deliciae Studiosorum" II,
1643, Nr. 8 in DTB 21-24 |
0' 30" |
A6 |
|
Werner
Neuhaus, Helga Thoene,
Violine | Otto
Steinkopf, Barock-Fagott
| Walter Thoene, Spinett
|
|
|
| Johann Philipp Krieger
(1649-1725) |
Wer's Jagen
recht begreifen will - Lied aus der Oper
"Procris" (Weißenfels 1689) |
0' 57" |
A7 |
|
Maria
Friesenhausen, Sopran | Otto
Steinkopf, Barock-Fagott |
Walter Thoene, Spinett |
|
|
| Johann Erasmus
Kindermann |
Symphonia
in E - aus "Deliciae
Studiosorum" II, 1643, Nr. 10 in
DTB 21-24 |
1' 00" |
A8
|
| Helmut
Schmitt, Alt-Posaune |
Harry Berteld,
Tenor-Posaune | Kurt
Federowitz, Baß-Posaune |
|
|
Johann Philipp Krieger
|
Freien
ist kein Pferdekauf - Lied aus der Oper
"Flora" (Weißenfels 1687) |
0' 47" |
A9 |
|
Claus Ocker, Baß | Alfred Lessing,
Violine | Otto
Steinkopf,
Barock-Fagott
| Walter
Thoene,
Spinett
|
|
|
| Johann Staden
(1581-1634) |
Aufzug
- in DTB 8, 2 |
0' 50" |
A10 |
|
Fritjof
Fest, Diskant-Pommer |
Albrecht Renz, Zink |
Otto Steinkopf, Nicolo
| Heinrich Göldner,
Tenor-Pommer |
|
|
| Johann Staden |
Galliarda "Ach
Traurigkeit" - in DTB 8,
2 |
1' 54" |
A11 |
|
RIAS-Kammerchor
| Günther Arnt, Leitung | Harry
Berteld, Tenor-Posaune | Walther
Theone, Spinett
|
|
|
| Johann Staden |
Pavane
- in DTB 8, 2 |
1' 17" |
A12
|
|
Helga Thoene,
Violine | Heinz Jopen, Emil
Seller, Viola | Horst Hedler,
Tenor-Gambe |
|
|
| Johann Staden |
Gaudium mundi
vanum - in DTB 8, 1 |
2' 10" |
A13 |
RIAS-Kammerchor
| Günther Arnt,
Leitung | Alfred
Lessing, Violone |
Gerhard Kastner,
Positiv
|
|
|
| Johann Krieger |
Partita in d - aus "Sechs
musicalische Partien, 1697 in DTB
XVIII
|
9' 25" |
A14 |
|
Walter Thoene, Cembalo |
|
|
Johann
Pachelbel (1653-1706)
|
Toccata
in C
|
2' 30" |
B1 |
|
Rudolf Zartner
and der Orgel (1770/78) zu Piech,
Oberfranken |
|
|
| Johann Erasmus
Kindermann |
Kantate
"Wachet auf, ruft uns
die Stimme" - in DTB
13
|
5' 33" |
B2 |
|
Windsbacher
Knabenchor | Hans
Thamm, Leitung
Werner Neuhaus, Helga
Thoene, Matthias
Nakaten, Rolf Maschke,
Ruth Nielen-Wagner,
Violine | Horst
Hedler, Violoncello
Alfred Lessing,
Violone | Otto
Steinkopf,
Barock-Fagott | Helmut
Schmitt, Baß-Posaune |
Rudolf Zartner,
Positiv
|
|
|
| Johann
Erasmus Kindermann |
Ach Herr,
wie lange
haben wir
gebeten um den
Frieden hier - in DTB
21-24 |
2' 15" |
B3 |
|
Emmy
Lisken, Alt | Werner
Neuhaus, Helga Thoene,
Violine | Alfred
Lessing, Violone |
Gerhard Kastner,
Positiv |
|
|
| Johann Staden |
Motette
"Beati omnes qui timent
Dominum" (a capella)
- in DTB VII/1
|
3' 50" |
B4 |
|
Windsbacher
Knabenchor | Hans
Thamm, Leitung |
|
|
Johann erasmus
Kindermann
|
Nun so singen
wir mit Schalle - in DTB
21-24
|
1' 25" |
B5
|
|
Maria
Friesenhausen, sopran |
Werner Neuhaus, Helga
Thoene, Violine | Alfred
Lessing, Violone |
Gerhard Kastner, Positiv
|
|
|
| Johann
Pachelbel |
Choralvorspiel
"Allein Gott in der Höh sei Ehr"
- in DTB IV/1 |
2' 40" |
B6 |
|
Rudolf Zartner an der Orgel (1770/78) zu Piech,
Oberfranken
|
|
|
| Georg Kaspar
Wecker (1632-1695) |
Allein Gott in
der Höh sei Ehr - Kantate
für Soli, Chor, Bläser, Streicher
und Continuo - in DTB 6, 1 |
8' 00" |
B7 |
|
Windsbacher
Knabenchor | Hans
Thamm, Leitung
Werner Neuhaus, Helga
Thoene, Matthias
Nakaten, Rolf Maschke,
Ruth Nielsen-Wagner,
Violine | Horst
Hedler, Violoncello
Alfred Lessing,
Violone | Otto
Steinkopf,
Barock-Fagott | Helmut
Schmitt, Baß-Posuane |
Rudolf Zartner,
Positiv
|
|
|
|
|
|
Interpreters (see
above).
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
- |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Fritz
Ganss / Gerd Berg / Christfried
Bickenbach / Horst Lindner |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- C 91 110 - (1 LP) - durata 53'
44" - (p) 1962 - Analogico |
|
|
Altre edizioni
LP
|
|
EMI
Electrola - 1C 037-45 575 - LC
0233 - (1 LP) - durata 53' 44" -
(p) 1962 - Analogico |
|
|
Edizioni CD |
|
- |
|
|
Cover |
|
Nürnberg,
Stich v. Merian 1651
|
|
|
|
|
Alte
Nürnberger Meister und
ihre Werke
Das Nürnbergerische
findet sich bei Johann
Erasmus Kindermann
(1616-1655) besonders
ausgeprägt: der
ernsthafte Realismus,
die energische
Lebensauffassung, die
natürliche Gemütsart,
die ungekünstelte
Frömmigkeit und die
Freude am derben Spaß.
Kindermann begann und
beschloß sein kurzes
Leben in Nürnberg, wo er
Stadens Schüler gewesen
war, bevor er sich, dem
Zeitgeist huldigend, zu
Studien nach Venedig
begab, dann 1636
Organist der
Frauenkirche und 1640
Organist bei St. Ägidius
wurde. Seine Lebenszeit
umfaßte ungefähr die
Zeit des Dreißigjährigen
Krieges. - Kindermanns
populärstes Werk - es
erlebte mehrere
Neuauflagen - waren die
Deliciae Studiosorum
von allerhand
Symphonien, Arien,
Sonaten . . . auff
Blasinstrumenten;
daneben entstanden
Orgelwerke und
geistliche Kantaten. Die
„Studentenfreuden“, das
Erfolgswerk eines
jungen, hochgeschätzten
Komponisten, sind
herzhafte, kernige
Spielmusik: die von fünf
Blechbläsern (mit Basso
continuo) in strahlendem
C-dur angestimmte
Intrada, deren Hauptsatz
reichsstädtisches Pathos
zur Schau trägt und
deren Ritornell an
fränkischen Volksweisen
orientiert zu sein
scheint, wie auch die
Ritornelle und kurzen
Symphonien, deren
lapidare, frische
Harmonik und
Stimmführung dem
jugendlichen Meister
alle Ehre machen. - Ins
Herz blickt man
Kindermann bei den
Kirchenkompositionen und
bei den Vokalsätzen, die
den Frieden preisen; ein
tiefreligiöses Kind des
Dreißigjährigen Krieges
spricht seine Sehnsucht
nach Frieden und Ordnung
aus, ähnlich vvie die
zeitgenössischen Lyriker
des Barocks. Der Choral
Wachet auf, ruft uns
die Stimme
beschäftigte mit seiner
Verkündigung des Glanzes
der Stadt Jerusalem auch
Kindermann, so wie er
später Bach und Reger
inspirierte; in ihrem
unverschnörkelten Ernst,
ihrer herben Harmonik
und ihrer realistischen
Prägnanz gibt seine
Kantate ein
musikalisches Gegenstück
zur wortgewaltigen und
eindringlichen
Barockdichtung eines
Gryphius, Opitz oder
Grimmelshausen. Die
fränkische Freude am
handfesten, mundartlich
eingefärbten Spaß bricht
sich in dem Nürnbergischen
Quodlibet Bahn,
das dem Musicalischen
Zeitvertreiber
entnommen ist. Das
Gesellschaftslied. das
seine Anfänge im
italienischen Scherzlied
hatte, wurde surch
Kindermann von den
verqueren Klang- und
Silbenspielereien
befreit und zu einem
derben, pausbäckigen
Naturalismus hingeführt.
Der ausgeprägte
Wirklichkeitssinn des
Franken zeichnete
klangmalerisch allerhand
Volkstypen. In dieser
handfesten Form blieb
das Quodlibet bis zu
Mozarts Tagen im
Schwange.
Johann Staden
(1581-1634) begann und
beschloß sein Leben
gleichfalls in Nürnberg.
Nach kurzen Jahren als
fürstlich
brandenburgischer
Hoforganist in Bayreuth
machte er sich 1610 in
seiner Vaterstadt
ansässig und gelangte
als Organist des
Heilig-Geist-Spitals
sowie der Lorenz- und
Sebalduskirche zu hohem
Ansehen. In Staden
manifestiert sich die
Übergangszeit in der
Mischung von
konzertierendem
(geistliches Konzert mit
Basso continuo) und
motettischem Stil sowie
von Kirchentönen und
Dur-Moll-Harmonik. Seine
kurzen Tanzsätze, die
Couranten, Gagliarden
und Pavanen, wurden wohl
von den Stadtpfeitern zu
suitenähnlichen Folgen
aneinander gruppiert.
Bemerkenswert ist, daß
Staden eine Klagemelodie
Ach Traurigkeit
im raschen Zeitmaß der
Gagliarda singen läßt.
Seine Chorsatze verraten
italienischen Einfluß.
Die Motette Beati
omnes qui timent
Dominum ist eine
lateinisch eingekleidete
Bitte um den Frieden,
wie sie den
Leidtragenden des großen
Krieges aus
leiderfülltem Herzen
kommen mußte. Verwiesen
sei noch auf Stadens
Sohn Siegmund
Theophilus, von dem die
älteste erhaltene
deutsche Oper stammt,
das „geistliche
Waldgedicht oder
Freudenspiel“ mit dem
romantisierenden Titel Seelewig.
Johann Philipp Krieger
(1649-1725) war ein
gebürtiger Nürnberger,
hielt sich aber nach
Studienjahren in
Kopenhagen und einer
kurzen Organistenzeit in
Bayreuth vornehmlich in
Mitteldeutschland auf,
pendelte - einer der
frühesten
Reisedirigenten der
Operngeschichte -
zwischen den
Operntheatern Sachsens
und Norddeutschlands,
wurde von Kaiser Leopold
in Wien geadelt und
starb als
Hofkapellmeister in
Weißenfels. Sein
Schaffen umfaßt etwa 50
Opern und Singspiele,
Kirchenmusik, die
Ariensammlung Musikalischer
Seelenfriede und
die Lustige
Feldmusik. Die von
italienischen
Koloraturen
durchzogenen, in der
Grundhaltung
liedhaft-einfachen
Opernnummern aus Procris
und Flora lassen
ihn als einen Lortzing
des Barocks erscheinen.
Die Familie Krieger war
weitverzweigt. Johann
Krieger (1651-1735). der
Bruder Johann Philipps,
war Musikdirektor in
Zittau und machte sich
vornehmlich durch
Clavierwerke und als
Kontrapunktiker einen
Namenm Händel hielt ihn
für einen der besten
Organisten seiner Zeit.
In der Neuen
musikalischen
Ergötzlichkeit
bewegt sich Johann
Krieger ganz auf der
Linie des Liedstils
seines Bruders. Die
Söhne der Brüder Krieger
festigten die
Musikerdynastie; ein
Sohn Johann Philipps
wurde sogar in
Weißenfels der
Amtsnachfolger seines
Vaters.
Johann Pachelbel
(1653-1706) war das
Haupt der
thüringisch-fränkischen
Orgelschule als Organist
in Erfurt und später an
der Nürnberger
Sebalduskirche. Seine
Hauptleistung:
Verschmelzung der
süddeutsch-italienischen
und der mitteldeutschen
Stilformen unter Wahrung
der „Cantabilität“ der
Stimmführung und der
harmonischen
Einfachheit. Er war ein
richtungweisender
Orgeltechniker,
entwickelte die Kunst
der Mensurvariation und
machte Choralbearbeitung
und Choralfuge zum
Hauptbestandteil seines
Schaffen. Pachelbel kam
in Nürnberg zur Welt,
aber seine Familie
stammte aus Eger. In
Altdorf, der ehemals
traditionsreichen
Universitätsstadt in der
Nähe von Nürnberg, ging
er zur Schule. In
Eisenach befreundete er
sich mit Johann
Sebastian Bachs Vater.
Er hatte Söhne, die
tüchtige Komponisten und
Instrumentalisten waren.
Ein Pachelbel-Sohn
wirkte in Boston und New
York. -
Musikgeschichtlich ist
Johann Pachelbel wohl
der gewichtigste unter
den komponierenden
Söhnen der alten
Reichsstadt. Seine Kunst
des Choralvorspiels und
der Choralfuge
beeinflußte Bach, seine
Spieltechnik wurde für
viele zeitgenössische
Organisten zum Vorbild.
Pachelbel führte den Ruf
Nürnbergs als Stadt
bedeutender Orgelmeister
auf den Höhepunkt. Die
Sebalduskirche, an deren
Orgel er saß, war um
1700 ein
kirchenmusikalisches
Zentrum Deutschlands,
gleichwertig den
norddeutschen Städten,
in denen die barocke
Orgelkunst zu hoher
Blüte gedieh.
Georg Kaspar Wecker
(1632-1695) war der
Lehrer Pachelbels
gewesen; auch die Brüder
Krieger gehörten zu
Weckers Schülern. Er
selbst hatte bei dem
frühvollendeten Johann
Erasmus Kindermann
studiert, so daß er als
verbindendes Glied
zwischen den noch von
der Renaissance
beeindruckten
Komponisten und den
Nürnberger
Barockmeistern zu denken
ist. Wecker kam in
Nürnberg zur Welt und
starb auch dort. Er
wurde 1655 Organist bei
St. Ägidius und 1686 bei
St. Sebaldus. An der
Sebaldusorgel war er der
Vorgänger Paohelbels.
Seine geistliche Kantate
Allein Gott in der
Höh sei Ehr eweist
ihn als Meister, der auf
der Höhe einer Zeit
stand. Pachelbels
Vorspiel über den
gleichen Choral sei der
Kantate vorangestellt,
um den
Generationsunterschied
in der Behandlung des
nämlichen thematischen
Materials darzutun.
Karl
Schumann
Die Nürnberger
Trompeten- und
Posaunenmacher
Der barocke
Orchesterklang hat bis
heute nichts von seinen
Reizen, seinem
bezwingenden Glanz,
seiner überwältigenden
Leuchtkraft verloren.
Dies ist dem Genius
einer großen,
ungewöhnlich reichen
Musikepoche zu danken,
sicher, aber nicht ihm
ganz allein. Das etwa,
was mit königlicher
Kraft die ganze Weite
und Tiefe barocker
Instrumentalpracht
überstrahlt: das Funkeln
der hohen Trompetentöne
- es hat im Grunde den
Handwerksfleiß des alten
Nürnberg zum Urheber.
Denn ohne die
Kunstfertigkeit der
Nürnberger Trompeten-
und Posaunenmacher
hätten weder Bach noch
Händel dem barocken
Orchester jene Krönung
geben können, die mit
dem Namen der legendären
Clarintrompete verknüpft
ist. Von hier, aus der
alten Reichsstadt, kamen
nämlich zu jener Zeit
die meisten und besten
dieser so wahrlich
„hohen“ Ansprüchen
gewachsenen Instrumente.
Hier wuchs, entwickelte
sich und verwelkte im
Verlauf von fast drei
Jahrhunderten eine
instrumentenbauliche
Tradition, die -
begünstigt durch ein
seltenes Zusammentreffen
von künstlerischer,
handwerklicher und
handelsgewerblicher
Blütezeit in dieser
Stadt - an Berühmtheit
in Deutschland nicht
ihresgleichen hatte.
Für eine entscheidende
Zeit wurde in den
Altstadtgassen unterhalb
der Burg den
Blechblasinstrumenten
mit dem Signum „Macht in
Nürnberg“ auch der
entwicklungs-bestimmende
Stempel aufgedrückt, und
es ist fraglich, ob ohne
die Meisterschaft des
Nürnberger Trompeten-
und
Posaunenmacher-Handwerks
unser heutiges
Instrumentarium nicht
anders aussähe. Nach
einer Periode
instrumentaler
Columbus-Taten brachte
dieses Nürnberger
Handwerk - in
eifersüchtig gewahrter
Zunft-Exklusivität einer
weiteren Entwicklung
alles andere als
förderlich - die vor
oder während seiner
Blütezeit entdeckten
neuen
Blasinstrument-formen zu
einer Vollkommenheit,
die ihnen lange, ja
teilweise bis heute die
Unantastbarkeit des
Endgültigen gab.
Schon im 15. Jahrhundert
verhalf die
handwerkliche
Kunstfertigkeit dieser
Instrumentenmacher der
genialen, damals
brandneuen Erfindung des
Posaunenzugs zu einer
Lebenskraft, die
Nürnberg geradezu zur
Geburtsstätte der
deutschen Zugposaune
werden ließ. Das damals
unerreichte Können der
Nürnberger Meister beim
Herstellen völlig
gleichmäßiger
Rohrstücke, ohne die
keine zufriedenstellende
Funktionsfähigkeit des
Zugmechanismus zu
erreichen war, ließ die
Posaune nicht nur eine
alle Jahrhunderte und
Stile fast unverändert
überdauernde Beliebtheit
gewinnen, es setzte die
Nürnberger auch instand,
als erste und wohl
einzige in Deutschland
der berühmten Quart- und
Quintposaune, dem
tiefsten Baß-Fundament
des nach der damaligen
Besetzungspraxis
üblichen Posaunen-Chors,
eine prächtige, dabei
spielbare Form zu geben
(im Nürnberger
Germanischen
Nationalmusium ist heute
noch eines dieser
mächtigen Instrumente
mit zwei Zügen und
Zug-Handhaben erhalten:
es mißt 145 cm, voll
ausgezogen sogar über 2
Meter).
Trotzdem verdanken die
Nürnberger Meister ihre
Sonderstellung im
Instrumentenbau nicht
der Posaune, auch nicht
dem von ihnen schon Ende
des 17. Jahr-
hunderts als
engmensuriertes,
tiefgestimmtes
„Clarin“-Instrument
gebauten Waldhorn,
sondern sie kam ihnen
durch jenes Instrument
zu, das noch bis ins 17.
Jahrhundert hinein das
Abzeichen eines quasi
musikalischen Ordens,
des von Johann Ernst
Altenburg so stolz
beschriebenen
„heroischen Trompeter-
und Paukerzunft“- Kults
war. Der Glanz des
Außerordentlichen blieb
davon der Trompete, auch
als sie ins barokke
Orchester aufgenommen
wurde und dort - wie es
ihr zukam - die
strahlende
Spitzenstellung erhielt.
Die Nürnberger
Handwerkskunstler aber
kamen zu europäischer
Berühmtheit, weil sie
beides mit gleicher
Vollendung konnten: den
vor allem nach dern
Dreißigjährigen Krieg
unzähligen Hot- und
Feldtrompetern der
großen und kleinen
Fürstentümer die
silberglänzenden Prunk-
und Signalinstrumente
liefern und den
virtuosen Clarinbläsern
der Bach-Zeit mit einer
engmensurierten, ganz
locker und (für die
Haltbarkeit) fast
gefährlich dünnwandigen
Naturtrornpete ein
Instrument in die Hand
geben, mit dessen
leichter Ansprechbarkeit
die heute noch
halsbrecherisch
wirkenden
Trompeten-Koloraturen
Bachs sehr wohl
bewältigt werden
konnten.
Kein Wunder, daß vor
allem im 16. und 17.
Jahrhundert die
Nürnhorger Trompeten-
und Posaunenmacher - die
in oft vielen
Generationen langer
Familientradition das
Handwerk pflegten und
von denen über 60
urkundlich nachweisbar
sind - bei Kaiser und
König, Kurfürsten und
Erzbischöfen angesehen
waren, ja sogar an
kaiserliche und
fürstliche Höfe berufen
wurden. Kein Wunder, daß
die von eigenen
Trompeten- und
Posaunen-„Stechern“ aufs
reichste geschmückten
Instrumente ihren
Schöpfern Wohlhabenheit,
ja Reichtum einbrachten.
Verständlich auch, daß
man sich bald genug vom
beispielhaft, aber auch
unnachsichtig auf
gedeihliche
Gewerbe-Entwicklung
bedachten Nürnberger Rat
eine strenge
Handwerks-Ordnung erbat
(1625), durch die - ein
einmaliger Fall in
Deutschlands
musikalischem
Kunsthandwerk! - nicht
nur eine immense Lehr-
und Gesellenzeit von 12
Jahren vorgeschrieben
wurde, sondern auch jede
unerwünschte
Vergrößerung der
Meisterzahl verhindert
werden konnte.
An dieser Exklusivität
ist das Nürnberger
Trompeten- und
Posaunenmacher-Handwerk
dann gegen Ende des 18.
Jahrhunderts
gescheitert. Seiner
wirtschaftlichen
Grundlage wurde es mit
dem Ende der Barockzeit
beraubt: die Trompete
und ebenso das Waldhorn
kamen in den Geruch von
verbesserungsbedürftigen
Instrumenten, da sie mit
der einsetzenden Klassik
in der Orchesterpraxis
aus der Clarin-Höhe in
die Tutti-Mittellage
herabgeholt wurden und
hier nur wenige
Naturtöne vorweisen
konnten; auch die
Posaune wurde für
mindestens ein halbes
Jahrhundert zum
Schattendasein verdammt.
An der weiteren
Entwicklung der
Blasinstrumente, die
schließlich in der
Erfindung der Ventile
gipfelte, wollten und
konnten die Nürnberger
Meister - auf das
hochwertige
Naturinstrument
eingeschworen - nicht
teilhaben. So ging
Nürnbergs berühmtes
Instrumentenmacher-Handwerk
letzten Endes an seinem
eigenen, zäh am Alten
festhaltenden Wesen
zugrunde - am Wesen
jeder großen
handwerklichen
Tradition.
Heute sollte man den Weg
zu den alten Nürnberger
Trompetenmachern wieder
zurückgehen, und man tut
es auch schon hier und
da; wie etwa Bach seine
glänzendsten
Orchesterwerke gehört
hat, davon kann kaum die
in der Gegenwart neu
konstruierte
„Bach-Trompete“, sondern
das eine ganze Oktave
tiefer gestimmte und
viel klanglebendigere
Clarininstrument der
Nürnberger Meister den
rechten Begriff geben.
Diese noch in
erfreulicher Anzahl
erhaltenen Nürnberger
Trompeten tragen
authentisch die
Klangvorstellung einer
großen musikalischen
Zeit in sich - einer
Zeit, der sie die
strahlendsten Töne
gaben.
Willi
Wörthmüller
(EMI
Electrola 1 C 037-45
575)
|
|