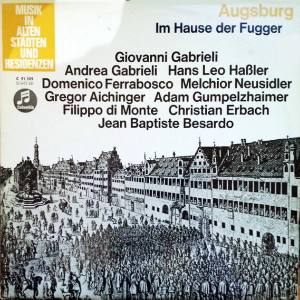 |
|
1 LP -
C 91 109 - (p) 1962
|
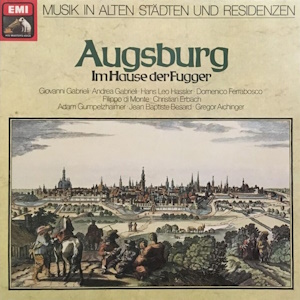 |
| 1 LP -
1C 037-46 521 - (p) 1962 |
|
| AUGSBURG - Im
Hause der Fugger |
|
|
|
|
|
| Giovanni Gabrieli
(1557-1612) |
Canzon Duodecimi
Toni A8. - aus "Canzoni e
sonate a più strimenti di Giovanni
Gabrieli nelle 'Sacrae Symphoniae',
1597"
|
3' 26" |
A1
|
|
Alfred Lessing,
Diskant-Gambe | Herbert Naumann,
Alt-Gambe | Heinrich Haferland,
Tenor-Gambe | Horst Hedler,
Violone
Otto Steinkops, Zink | Helmut
Schmitt, Alt-Posaune | Harry
Berteld, Tenor-Posaune | Kurt
Federowitz, Baß-Posaune
|
|
|
Andrea Gabrieli (1.
Teil) &
|
In
nobil sangue - Madrigal aus
"Concerti di A. e G. Gabrieli",
Venetia 1587 |
6' 15" |
A2 |
| Giovanni Gabrieli
(2. Teil) |
Alfred Lessing,
Diskant-Gambe | Herbert Naumann,
Alt-Gambe | Heinrich Haferland,
Tenor-Gambe | Horst Hedler,
Violone
RIAS-Kammerchor | Günther Arndt,
Leitung
|
|
|
| Hans Leo Hassler (1564-1612) |
Canzon
- aus "Amoenitas musicalium
hortulus, Anno 1622" |
3' 05" |
A3 |
|
Johannes
Brenneke, and der historischen
Orgel der Jakobi-Kirche zu Lübeck |
|
|
| Hans Leo Hassler |
O
tu che mi dai pene - Canzonetta |
2' 40" |
A4 |
|
Maria
Frisenhausen, Sopran | Emmy
Lisken, Alt | Theo Altmeyer,
Tenor | Claus Ocker, Bariton |
Walter Thoene, Spinett |
|
|
| Anonymus |
Saltarello
de megio - aus dem Lautenbuch
des Octavianus II, Fugger, Bologna
1562 |
0' 30" |
A5 |
Eugen
Müller-Dombois,
Renaissance-Laute
|
|
|
| Hans Leo Hassler |
Mi sento ohime
morire - Canzonetta |
0' 48" |
A6 |
|
Maria
Frisenhausen, Sopran |
Emmy Lisken, Alt | Theo
Altmeyer, Tenor | Claus
Ocker, Bariton | Walter
Thoene, Spinett
|
|
|
| Anonymus |
La fantina
- aus dem Lautenbuch
des Octavianus II, Fugger, Bologna
1562 |
0' 27" |
A7 |
|
Eugen
Müller-Dombois,
Renaissance-Laute |
|
|
| Hans Leo Hassler |
Chiara
e lucente stella - Canzonetta |
1' 09" |
A8
|
| Maria
Frisenhausen, Sopran |
Jeanne Deroubaix,
Mezzosopran | Theo
Altmeyer, Tenor | Claus
Ocker, Bariton | Walter
Thoene, Spinettino |
|
|
Domenico Ferrabosco
(1513-1574)
|
Io
mi son giovinett'e volentieri - "Ballata" |
1' 30" |
A9 |
|
Maria Friesenhausen, Sopran | Emmy
Lisken, Alto |
Theo Altmeyer,
Tenor | Claus
Ocker, Bariton
|
|
|
| Friedrich
Schmidtmann, Sopran-Blockflöte |
Wolfgang Schwarzrock,
Alt-Blockflöte | Alfred Lessing,
Tenor-Gambe | Gerhard Kastner,
Positiv |
|
|
| Melchior Neusidler
(1531-1590/91) |
Der
Fuggerin dantz - aus "Teutsch
Lautenbuch", Straßburg 1574 |
1' 20" |
A10 |
|
Eugen
Müller-Dombois,
Renaissance-Laute |
|
|
| Filippr di Monte
(1521-1603) |
Sottile e dolce
ladra - Madrigal a
cappella |
1' 37" |
A11 |
|
Maria
Friesenhausen, Sopran | Jeanne
Deroubaix, Mezzospran | Emmy
Lisken, Alt | Theo Altmeyer,
Tenor | Claus Ocker, Bariton
|
|
|
| Hans Leo Hassler |
Mein
Lieb will mit mir kriegen - für 8stimmigen
Doppelchor a cappella |
2' 25" |
A12
|
|
RIAS-Kammerchor
| Günther Arndt, Leitung |
|
|
| Hans Leo
Hassler |
Ich scheid von
dir mit leyde - 6stimmig
|
2' 55" |
A13 |
Alfred Lessing,
Diskant-Gambe | Herbert Naumann,
Alt-Gambe | Heinrich Haferland,
Tenor-Gambe
|
|
|
|
Horst Hedler, Violone | RIAS-Kammerchor | Günther Arndt,
Leitung |
|
|
Christian
Erbach (1570-1635)
|
Ricercar
VII. Toni in DTB IV/2,
herausgegeben von E. v. Werra,
Leipzig 1903
|
5' 35" |
B1 |
|
Johannes
Brenneke, and der historischen
Orgel der Jakobi-Kirche zu Lübeck |
|
|
| Adam
Gumpelzhaimer (1559-1625) |
Ach wie
elend ist uns're Zeit
- 3stimmig
|
1' 25" |
B2 |
| Adam
Gumpelzhaimer |
Die
finster Nachte -
3stimmig |
1' 25" |
B3 |
|
Windsbacher
Knabenchor | Hans
Thamm, Leitung |
|
|
| Jean Baptiste
Besardo (um 1567-1625) |
Galliarda
- in "Saggio, Sulla
Melodia Populare del
cinquecento",
herausgegeben von Oscar
Chiesotti
|
1' 40" |
B4 |
|
Eugen
Müller-Dombois,
Barock-Laute |
|
|
Gregor Aichinger
(1564-1628)
|
Beati omnes,
qui timent Dominum - Motette a
cappella - in DTB X/1,
herausgegeben von Theodor
Kroyer, Leipzig 1909
|
7' 30" |
B5
|
|
RIAS-Kammerchor
| Günther Arnst, Leitung
|
|
|
| Hans Leo
Hassler |
Herzlich lieb
hab ich dich, o Herr - für
8stimmigen Doppelchor a cappella |
6' 45" |
B6 |
|
Windsbacher Knabenchor | Hans Thamm, Leitung
|
|
|
|
|
|
Interpreters (see
above).
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
- |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Fritz
Ganss / Gerd Berg / Christfried
Bickenbach / Horst Lindner |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- C 91 109 - (1 LP) - durata 52'
27" - (p) 1962 - Analogico |
|
|
Altre edizioni
LP
|
|
EMI
Electrola - 1C 037-46 521 - LC
0233 - (1 LP) - durata 52' 27" -
(p) 1962 - Analogico |
|
|
Edizioni CD |
|
- |
|
|
Cover |
|
Die
Stadt Augsburg huldigt Gustav
Adolf von Schweden im Jahre 1634 -
Kupferstich von Jakob Custodis
|
|
|
|
|
Augusta
Vindelicorum
Geschichte und
Gestalten
Der Weg Augsburgs
umspannt fast zwei
Jahrtausende. Er beginnt
mit dem Marsch römischer
Legionäre zur Donau. Wo
sich Lech und Wertach
vermählen, in der Mitte
der
schwäbisch-bayerischen
Hochebene, machen die
Legionäre Rast. Der
Platz behagt ihnen. Aus
dem flüchtig angelegten
Lager wächst ein
behagliches Römerkastell
mit Mauern und Türmen
und beheizten Fußböden.
In einem Gemach des
Kastells schreibt
Drusus, der Stiefsohn
des Kaiser Augustus,
eine Epistel nach Rom,
daß er ein neues Lager
gegründet habe und daß
er diesen Platz künftig
Augusta vindelicorum
nennen werde. 15 vor
Christus tritt Augsburg,
Augusta vindelicorum, in
das Licht der
Geschichte.
Das Römerkastell wird
größer und größer. Zu
den Legionären gesellen
sich Kaufkeute. Sie
bringen funkelnden
Bernstein aus dem
Norden, kostbare Tücher
aus dem Orient,
Geschmeide aus Spanien
und Nordagrika uns
seltsam geformte Waffen
aus Gallien. Aber sie
bringen nicht nur
Kleinode, Raritäten. Sie
bringen auch den Schatz
der Schätze ins Land,
das eine Licht, das über
die Zeit hinwegleuchtet:
das Christentum. Die
Legionäre im Tal des
Lech spotten über den
Mann, der da in Judäa
unter Pontius Pilatus
ans Kreuz geschlagen
wurde. Ihr Lachen
verwandelt sich in Zorn,
als sie sehen, daß
dieser tote Mann - der
gar aufestanden sein
soll und gen Himmel
gefahren - mehr und mehr
Anhänger gewinnt, die
ihm Gebet und Stimme und
sogar ihr Höchstes, das
Lebenm weihen. Unter
Diokletian kommt es zu
blutigen
Christenvefolgungen,
auch in augusta
vindelicorum. Um das
Jahr 304 erleidet die
heilige Afra den
Märtyrertod. Aber der
Kaiser ist schon
geboren, der ddem
Christentum den Weg in
das Abendland öffnet -
Konstantin der Große.
Freilich strebt das
Reich, das dieser Kaiser
mit seiner Person eint
und mit seinem Geiste
erfüllt, schon dem
Untergang entgegen, der
Teilung in Ostrom und
Westrom. Die Scharen der
Goten ziehen heran, die
Hunnen folgen.
536 fällt das nun schon
gut fünfhundertjährige
Augusta vindelicorum an
die Franken, In jener
Zeitm aus der kaum
Stimmen in unsere Tage
hinüberhallen, fangen
die Lichter des Glaubens
in der Mitte Europas zu
glimmen an - in St.
Gallen und auf der
Reichneau, in Konstanz
und auch in Augsburg. In
den Tagen Kaiser Ludwigs
des Frommen, des dritten
Sohnes Karis des Großen,
klingt in den Annalen
erstmals der Name
Augsburg. Gut hundert
Jahre später klingt der
Name in ganz Europa.
Otto der Große zieht auf
dem Lechfeld südlich von
Augsburg nit seinem
Heere den anstürmenden
Ungarn entgegen. Er
trägt die Heilige Lanze
aus Burgund, die einen
Nagel vom Kreuze Christi
umhüllt. Kaiser Otto
schlägt die Ungarn, und
noch auf der Walstatt,
im Schatten Augsburgs,
umbranden ihn die
Huldigungsrufe "Pater
Patriae", die viel
später in das herrliche
Wort "Vater Europas"
umgedeutet werden. Das
frühe Augsburg liegt im
Ring des alten
Herzogtums Schwaben.
Unter Kaiser Heinrich
IV. fällt das Herzogtum
an die Hohenstaufen, die
es zwei Jahrhunderte
hindurch bewahren.
Erst nach dem Tode
Konradins auf dem
Schafott in Neapel
besinnen sich die
Augsburger auf ihre
Bürgerfreiheit. Sie
ertrotzen sich in den
ersten Regierungsjahren
Rudolfs von Habsburg die
Anerkennung als Freie
Reichsstadt. Sie treten
in der Zeit Ludwigs des
Bayern dem Schwäbischen
Städtebund bei. Sie
bewahren sich eine sehr
eigenwillige
Stadtverfassung, die den
Consulen und Patriziern
weite Rechte einräumt.
Erst in den späten
Regierungsjahren Kaiser
Karls lV. gewinnen auch
in Augsburg die Zünfte
Freiheiten und Rechte.
In dieser frühen
demokratischen Zeit
Augsburgs zieht 1368
Ulrich Fugger aus Graben
auf dem Lechfetd in die
Stadt an der Mündung der
Wertach in den Lech.
Schon dreißig Jahre
später gelten die Fugger
als wohlhabende Bürger.
Sie unterhalten eine
Barchentweberet mit
Verkaufsgewölben in der
Nähe des alten
Rathauses. Der Handel
Augsburgs blüht. Der
letzte luxemburgische
Kaiser, Sigismund,
verweist die
kaiserlichen Vögte aus
der Stadt und schenkt
Augsburg damit die
unabdingbare
Reichsfreiheit.
Jakob Fugger, der Enkel
des ersten Fugger,
vermählt sich indessen
mit der Tochter des
Augsburger Münzmeisters
Bäsinger. Aber der
Münzmeister macht
bankerott und zieht sich
eilig nach Schwaz in
Tirol zurück. Dort
schürft er in einem
Bergwerk nach Silber.
Die kritische Lage
seines Schwiegervaters
stört Jakob Fugger
nicht. Im Gegenteil, er
zieht selbst nach Schwaz
und sucht gemeinsam mit
Bäsinger nach
Silberadern im Gestein.
Und er hat Glück. Er
findet reiche Adern und
gründet mit dem großen
Silberaufkommen das
unermeßliche Vermögen
des Hauses Fugger. Er
beginnt nun Geschäfte
ganz anderen und viel
größeren Stils, durchaus
nicht nur mit Waren und
Handelsgütern, Geschäfte
auch mit und um Geld.
Das Vermögen der Fugger
vermehrt sich. Dahinter
verbirgt sich eine sehr
durchdachte
Famillenpotitik: das
Gesetz der Unteilbarkeít
des Vermögens. Die Söhne
Jakob Fuggers - Ulrich,
Georg und Jakob -
übernehmen zu gleichen
Teilen den Besitz. Sie
bewahren ihn alle
stürmische Zeit hindurch
mit Klugheit. Der
federführende unter
ihnen, der jüngere Jakob
Fugger, tritt 1534 nicht
im Überschwang zu den
Lutheranern über - wie
die meisten Augsburger.
Das trögt ihm manchen
scheelen Blick ein, aber
es erspart ihm den
schmählichen neuen
Übertritt zur
katholischen Kirche, der
wiederum den meisten
Augsburgern 1548
bevorsteht. Diese
Beständigkeit erhölt
Fugger auch die Freiheit
der eigenen Meinung.
Fugger ist Katholik,
aber er kann es sich als
guter Katholik leisten -
ohne seinen Ruf zu
schmälern -, die meist
protestantischen
Humanisten zu fördern.
Dieser jüngere Jakob
Fugger ist ein moderner
Mensch, vor allem ein
moderner Kaufmann. Er
verschließt sich keiner
Neuerung. Er nutzt als
einer der ersten
europöischerı Kaufleute
die Vorteile des
Seeweges nach:
Ostindien. Freilich
riskiert er den Verlust
seiner Gewürzschiffe.
Aber der Einsatz
gelingt. Die Schiffe
kommen durch, und Fugger
ist es, der weite Teile
des Kontinents als
erster mit kostbaren
Waren aus den fernen
Welten versorgt. Der
Ruhm des Hauses Fugger
steigt höher und höher.
Auch Kaiser erweisen den
Fuggers ihre Gunst,
allerdings nicht ohne
Grund. Sie gehen die
Augsburger Kaufherren
sehr nüchtern um Darlehn
an. Zunächst Maximilian
I., später Karl V.,
schließlich Rudolf II.
Und die Fugger geben den
Kaisern Geld, sehr viel
Geld, 70.000 Goldgulden,
170.000 Dukaten und
mehr.
Am Ende des 15.
Jahrhunderts ziehen die
Fugger in ihr Haus in
der späteren
Maximiliansstraße. Die
Zeit ist bewegt, die
Wolken des
Glaubenskrieges ziehen
am Himmel auf. Luther
kommt nach Augsburg. Ein
Jahr vor Kaiser
Maximilians Tod lädt
Kardinal Cajetan den
Augustinermönch aus
Wittenberg in die
Fuggerstadt. Kardinal
und Mönch disputieren,
aber sie finden keine
Brücke der
Verständigung. Drei
Jahre später steht
Luther in Worms und
spricht im Angesicht
Karls V. sein großes
Wort: „Hier stehe ich,
ich kann nicht anders,
Gott helfe mir, Amen."
Es ist eine seltsame
Zeit. Die Macht des
Hauses Habsburg steht im
Zenit. Ist die alte Welt
von den Schatten der
Nacht verdunkelt, so
blüht das Sonnenlicht
über Mondo Nuovo, über
der Neuen Welt, über
Mexiko. Fast ganz Europa
horcht auf das Gebot des
Habsburgers. Nur ein
Mönch versagt ihm den
Gehorsam und ein Kaiser
der Azteken. Der Mönch
übersetzt auf der
Wartburg das Buch der
Bücher, und der Kaiser
Montezuma geht weise
lächelnd in den Tod.
Karl V. träumt von einem
universalen Kaisertum,
von einer Krone, deren
Heiligkeit den Erdball
urnspannt. Er ist nahe
daran, dies hohe Ziel zu
erreichen. Aber sein
Leben verllscht - noch
vor dem Ziel - still und
in Demut in der
Bannmeile des spanischen
Klosters San Yuste. Vor
dieser dunklen Stunde
aber berührt die
Lebensbahn des Kaisers
noch oft die Reichsstadt
Augsburg.
Die Neffen des
kinderlosen jüngeren
Jakob Fugger, Raimund
und Anton, erben das
Vermögen der Familie.
Karl V. erhebt sie zu
Reichsgrafen. Er gesteht
ihnen das Recht eigener
Goldund
Silbermünzenprägung zu.
Und die Fugger wissen
diese Gunst zu nutzen.
Der Kaiser ist oft in
ihrem Hause Gast. Sie
leihen ihm große Summen
Geldes. Und sie
verbrennen, der Legende
nach, die Schuldscheirıe
des Kaisers im Angesicht
der Römischen Majestät
im Kamin ihres Hauses.
Aber sie sind nicht
allein Kaufleute (Hutten
hat sie „Knauser"
gescholten). Anton
Fugger hilft den Armen,
er steht bedrängten
Poeten und Musikanten
bei, Gelehrten und
Alchimisten. Er wird im
Reiche so etwas wie ein
„Hort der Armen und
Gelehrten". Um diese
Zeit wird die Augsburger
Pracht sprichwörtlich.
Wohl hat Elias Holl noch
nicht sein Rathaus mit
dem Goldenen Saal und
den vier Fürstenzimmern
geschaffen, auch das
Bäcker- und das
Metzgerhaus noch nicht.
Aber Dom und
Ulrichskirche, viele
Brunnen und eine hohe
Zahl stolzer
Bürgerhäuser wachsen
empor. Holbein und
Burgkmair schmücken die
Häuser mit Gemälden.
Goldschmiede aus der
Schule des Matthias
Wallbaum hämmern
kostbare
Reliquienbehältnisse und
zierliche Silberreliefs.
Fahrende Sänger aus
allen Teilen des Reiches
machen in Augsburg Rast.
Um die Mitte des 16.
Jahrhunderts gerät
Augsburg in Not. Die
protestantischen Städte
unterwerfen sich dem
Kaiser und erhalten
gegen hohe Kontribution
Verzeihung. Die
Augsburger Bürger wollen
sich diesem kollektiven
Sdtuldspruch zunächst
nicht beugen. Sie holen
ein Gutachten ihres
Landsknechthauptmanns
Schertlin von Burtenbach
ein. Der Württemberger
Schertlin sagt ja zur
Verteidigung. Aber die
Würfel sind längst
gefallen. Anton Fugger
hat sich heimlich mit
dem Kaiser getroffen und
über die Zukunft
Augsburgs verhandelt.
Die Antwort des Kaisers
ist klar: die Stadt soll
ein Fähnlein
Kriegsknechte stellen
und dem Feldhauptmann
Schertlin den Laufpaß
geben. Nun ist es nicht
einfach, einen
Kriegsmann wie Schertlin
davonzujagen. Die
Augsburger verhandeln
rnit dem Feldhauptmann.
Sie bitten ihn, „ein
paar Wochen in die
Schweiz zu gehen“, Herr
Fugger würde sich
etkenntlich zeigen: all
sein „liegendes und
fahrendes Gut" würde ihm
ersetzt. Schließlich
geht Schertlin. Aber die
Augsburger Bürger sind
mit Schertlin ihre
Sorgen nicht los. Der
Preis für die neue
kaiserliche Gunst ist
hoch. Sie lautet auf
150.000 Dukaten und
zwölf Kanonen.
Sieben Jahre später wird
in Augsburg der
Religionstriede
besiegelt. Er ist wohl
nur ein loser
Kornpromiß. Wahre
Glaubensfreiheit bringt
er nur den Fürsten, doch
er verdeckt den offenen
Streit. Aber die
Geschichte zieht
Augsburg wieder und
wieder in den Brennpunkt
der Geschehnisse.
Schweden und Kaiserliche
ringen im
Dreißigjährigen Krieg um
die Fuggerstadt. Lange
nach dem Frieden zu
Münster wird 1686 in der
Stadt die Augsburger
Allianz beschlossen, das
Bündnis von Kaiser und
Reichsständen, von
Schweden und Spaniern
gegen Frankreich. Der
Krieg im Herzen des
Reiches ist erloschen,
aber die Fackel der
Bedrohung loht zugleich
im Osten und Westen, am
Rhein und an der Donau.
Vom Balkan her ziehen
die Türken heran, und
vor den Toren
Heidelbergs stehen die
Söldner Ludwigs XIV.
Knapp zwanzig Jahre
später greifen die
Wittelsbacher das
erstemal nach Augsburg.
lm Spanischen
Erbfolgekrieg besetzt
der Kurfürst von Bayern
die Stadt der Fugger.
Gegen eine Kontribution
von vier Tonnen Gold
zieht er wieder ab. Für
ein Jahrhundert noch
bleibt der Stadt die
Reichsfreiheit erhalten.
Und immer sind es die
Fugger, die in der
Blüte, aber auch in der
ärgsten Not den Weg der
Mitte - der nicht immer
ein Weg der Feigheit zu
sein braucht - finden.
Von den Tagen
Maximilians I. über Karl
V. und Rudolf II. bis zu
Franz II. ist ihr Palais
das Haus der Römischen
Kaiser Deutsdıer Nation,
das Haus der Kaiser,
deren Geist Europa
umspannt. In der Stunde
des Untergangs des alten
Reiches, 1803, wird die
Freiheit der Stadt
Augsburg von den
Deputierten des Heiligen
Reiches noch einmal
bestätigt. In der
gleichen Stunde erhebt
Kaiser Franz II. die
Fugger in den
Fürstenstand.
Im Frieden von Preßburg
erhält Bayern die Stadt
Augsburg. Am zweiten
Weihnachtstag 1805 - im
Todesjahr Schillers -
ziehen bayerische
Regimenter in die
Reichsstadt ein. Eine
Woche später vertauscht
der Wittelsbacher
Maximlllan I. den Kurhut
mit der Königskrone. Und
im März 1806 erklärt ein
förmliches Dekret die
Reidısfrelheit der
Fuggerstadt für
erledigt. Wieder ein
Jahr darauf fällt das
legendär seit dem Jahre
600 bestehende Bistum
Augsburg - dessen Gebot
von Hohenschwangau bis
zum Donauried galt -
unter die Hoheit des
Erzstiftes
München-Freising. Der
letzte Bischof von
Augsburg ist ein
Wettiner und Sohn König
Augusts III. von Polen.
Die Stammburg der
Wittelsbacher liegt
keine dreißig Kilometer
von Augsburg entfernt.
In ihrem Schatten blühen
zweitausend Jahre
europäischer Geschichte.
Es Ist ein weiter Weg
von Augusta vindelicorum
bis Augsburg, vom
Römerkastell bis zur
Hauptstadt von
Bayerisch-Schwaben. Ein
Weg, an dessen Anfang
das Heilige Land schon
auf die Erfüllung des
Prophetenwortes von der
Geburt des Heilands
wartet; ein Weg, on
dessen Scheitelpunkt die
protestantisd'ıen Stände
Kaiser Karl V. in einem
Gemach der alten
bischhöflichen Pfalz die
Augsburgische Konfession
einhändigen. Und es ist
ein seltsamer Weg vom
mauerumgürteten Lager
der Legionäre bis zur
Zuflucht der Armen und
Heimatlosen, bis zur
Fuggerei, der Stadt in
der Stadt, abgeschlossen
durch Tore, geteilt
durch drei Haupt- und
drei Nebengassen,
dreiundfünfzig Häuser
mit hundertundsechs
Wohnungen, deren keine
mehr als 3,43 Mark an
Mietzins im Jahre
kostet.
HANS-ULRICH
ENGEL
Musik im Hause der
Fugger
Die vorliegende Platte
zeigt die Vielseitigkeit
der Renaissancemusik in
der Fuggerstadt
Augsburg, als dort ein
internationaler
Geschmack herrschte. Von
den einfachen
Lautensätzen des
Octavianus II. Fugger
über die herrliche
Canzone für mehrere
Instrumente von Giovanni
Gabrieli bis zu den
feinsinnigen Canzonetten
zu vier Stimmen des Hans
Leo Haßler und der
innigen Motette des
Gregor Aichinger finden
wir fast alle
Formgattungen der
damaligen Zeit
vertreten. Nicht alle
Werke stammen von
Komponisten, die in
Augsburg tätig waren,
aber alle sind eng mit
der Stadt oder der
Fugger-Familie
verbunden.
GAOVANNI GABRIELI, 1557
zu Venedig geboren, ist
im gleichen Jahr (1612)
wie sein Freund Haßler
gestorben. Von 1535-79
war er Adjunkt Orlando
di Lassos in München;
1584 wurde er zweiter
Organist an San Marco in
Venedig. Nach dem Tode
seines Oheims Andrea
Gabrielí übernahm er
1586 an dieser Kirche
das Amt des ersten
Organisten bis zu seinem
Tode. Unter den
Instrumentalmusik-Komponisten
der Spätrenaíssance muß
Giovanni Gabrieli an
erster Stelle genannt
werden. Er und sein
Onkel verliehen der
alten, vierstimmigen
Instrumentalcanzone
durch die Verwendung von
mehreren (bis zu 12)
Instrumenten und durch
die Steigerung der
melodischen und
rhythmisdten
Möglichkeiten neues
Leben, wodurch die
Entwicklung der
Instrumentalmusik
vorangetrieben wurde.
Gabrielis Canzone zu
acht Stimmen in zwei
Chören (Streicher -
Bläser) ist in der
Instrumentalmusik ein
außerordentlich frühes
Beispiel für eine
geschlossene Form in
strenger Da capo-Form
ABA; hier sind die Teile
- Exposition,
Durchführung, Reprise -
bereits vorhanden, aus
denen sich viel später
die Sonatenform
entwickelte. Die breit
angelegte Canzone ist in
ihren melodischen
Wendungen und ihrer
rhythmischen Vitalität
die rechte Einleitung
für ein klingendes Bild
vom prunkvoilen
Musikleben im Augsburg
der Spätrenaissance.
Der um 1510 zu Venedig
geborene ANDREA GABRIELI
war wahrscheinlich
Schüler des an San Marco
tätigen niederländischen
Meisters Adrian
Willaert. Er zählte zu
den größten und
einflußreidısten
Meistern der Renaissance
und starb Ende 1586 zu
Venedig. - Die Sammlung
„Concerti di A. & G.
Gabrieli . . . 1587“, in
der Giovanni seines
Oheims gedenkt und die
hohe Kunst dieses Mannes
eriurchtsvoll bewundert
(„ich bin ihm nur etwas
weniger als ein Sohn"),
ist „lL SIG GIACOMO
FUCCARI, SENIORI . . ."
dediziert. Daraus geht
hervor, daß Andrea die
Familie Fugger und
besonders Jakob d. Ä.
verehrte und daß er die
Sammlung als Geschenk an
Jakob Fugger geplant
hatte. Das zweiteilige
Madrigal „In nobil
sangue" und „Amor s'è in
lei" - Prima Parte von
Andrea, Seconda Parte
von Giovanni Gabrieli -
ist eines der schönsten
und empfindsamsten
Stücke dieser Sammlung.
Das Modrigal des 16.
Jahrhunderts war das
weltliche Gegenstück zur
sakralen Motette und war
wie diese
durchkomponiert. Beide
Teile unseres
fünfstimmigen Madrigals
beginnen mit demselben
polyphon gearbeiteten,
aufsteigenden
Quartsprung, werden aber
ganz verschieden
weitergeführt, wobei die
neuere Richtung des
jüngeren Komponisten
klar erkennbar wird. Die
durch melodische Linien
ineinander fließenden
Textabschnítte Giovannis
- gegenüber der
deutlichen Trennung der
Abschnitte bei Andrea -
zeigen die Entwicklung
der neueren Schreibart.
Die vierstimmige
Orgel-Canzone von HANS
LEO HASSLER ist nicht
eigentlich ein typisches
Beispiel für die
Orgelwerke des großen
Fugger-Meisters; ihre
Einfachheit zeigt aber
seine schlichte
Schreibart. Der zweite
Teil des Werkes, das die
Form aabb der vokalen
Canzonetten aufweist,
ist typisch für Haßlers
Orgel-lntroiten, weniger
tür dessen sonstige
Canzonen. Diese Caınzone
zeichnet sich durch ein
geniales
Motivwechselspiel aus.
Hans Leo Haßler, der -
wie zwei Jahrhunderte
später Mozart - die
Kunst des Nordens mit
der des Südens in einer
unverkennbar
persönlichen Schreibart
verschmelzen hat, wurde
1564 als Sohn eines
Stelnmetzen und
Organisten zu Nürnberg
geboren. Er erhielt
ersten musikalischen
Unterricht durch seinen
Vater und sehr
wahrscheinlich auch
durch den Lasso-Schüler
Leonhard Lechner. 1584
trat der junge Meister
seine berühmte
Italienreise an, um in
Venedig bei Andrea
Gabrieli zu studieren,
wobei er auch enge
Freundschaft mit dessen
Neffen Giovanni schloß.
Wohl auf Empfehlung
Andreas, der im Hause
Fugger guten Ruf genoß,
kam Haßler 1585 nach
Augsburg, wurde 1586
Kammerorganist des
Grafen Octavianus II.
Fugger und behielt
dieses Amt bis 1601.
Dann war er bis 1608 der
höchstgestellte Musiker
seiner Vaterstadt
Nürnberg. Er wurde durch
Kaiser Rudolf II.
zweimal (1595 und 1604)
in den Adelsstand
erhoben, wurde 1602 zum
kaiserlichen „Hofdiener
von Haus aus“ und
endlich 1608 zum
kurfürstlichen
Organisten bei Christian
II. von Sachsen ernannt.
Am 8. Juni 1612 verstarb
er in Frankfurt, wo er
sich anläßlich der
Kaiserwahl aufhielt.
Die Canzonetten des
jungen Haßler gehören zu
seinem Erstlirıgswerk
(1590), das er Christoph
Fugger als Dank für
erwiesene Großzügigkeit
widmete (vermutlich war
er schon 1585 in die
Dienste der Fugger
getreten). - „O tu che
mi dai pene” ist kein
gewöhnliches
Gesellschaftslied der
Zeit. Gleich vielen
anderen der Sammlung
(„Canzanette à 4 voci .
. . 1590“) zeigt es, wie
früh Haßler die
Schreibarten der
Niederländer und der
Italiener verschmolzen
hat. Trotz der
dreíteiligen
Canzonetten-Form aabcc
ist es dem Meister
gelungen, den Text von
der schmerzhaften Liebe
durch eine Musik von
verinnerlichter
Schönheit (ohne die
Schwermut der
italienischen
Madrigalisten)
auszudeuten. Polyphonie,
Homophonie und
Echotechník sind
vollkommen beherrscht
und rniteinander
verschmelzen. - „Mi
sento ohime moríre" ist
in derselben Form, aber
als echte Canzonette -
als eine Art
Tanzlled - leicht,
hübsch und durchaus
homophon ausgearbeitet.
Das Gefühl des
Sterbenmüssens (ohime
morire) ist musikalisch
nicht ernst gemeint,
sondern mehr mit
Koketterie als durch
echtes Gefühl zum
Ausdruck gebracht. -
„Chiara e lucente
stella" ist zweiteilig,
mit einer beschwíngterı
Melodie homophon
gesetzt. Haßler verleiht
dem Text durch
herrlichen Wohllaut
innigen Ausdruck der
jungen und zarten Liebe.
Bemerkenswert, wie
sorgsam er die untere
Stimme durch geschickte,
sparsame Verwendung
behandelt.
Zwei der vier
aufgenommenen
Lautenstücke stammen aus
dem „Lauttenbuech" des
damals dreizehnjährigen
OCTAVIANUS II., der 1562
in Bologna studierte und
dort die vielfältigen
Tanzlieder der
Gesellschaftsmusik des
„Welschlandt"
kennenlernte. Laut der
Pinacotheca Fuggerorum
wurde Octavian am 12.
Januar 1549 geboren. Als
Rat des Kaisers Rudolf
II. und als eines der
Stadtoberhàupter
Augsburgs war er ein
sehr einflußreicher Mann
im Kulturleben der
Stadt. Der Patron Hans
Leo Haßlers darf als
einer der wichtigsten
Pfleger der
Spàtrenaissance-Musik
gelten. „Saltarello de
megio" unıd „La fantina"
sind sehr einfach
gesetzte
Gesellschaftstäınze
(Springtänze) im
Tripeltakt, die in der
Form aa'bb' gehalten
sind.
DOMENICO MARIA
FERRABOSCO (1513-1574)
dürfte in
Musikliebhaberkreisen
der italienisch
beeinflußten Stadt
Augsburg durch sein 1542
erschienenes, bis 1654
häufig nachgedrucktes,
berühmtes Mcıdrigal
bekannt gewesen sein:
„Io mi snm giovinett'e
volontieri", ein sehr
homophon angelegtes, mit
leichter Polyphonie
belebtes Madrigal, log
1569 der „Missa Primi
Toni“ von Palestrina
zugrunde.
„Der Fuggerin dantz"
stammt aus dem „Teutsch
Lautenbuch 1574" von
MELCHIOR NEUSIDLER, dem
Sohn und Schüler des
Nürnberger Komponisten
und Lautenisten Hans
Neusidler. Melchior,
Bürger und
„Lauttenschlager“ zu
Augsburg und gern
gesehener Gast bei der
Familie Fugger, wor
Bahnbrecher der
italienischen
Lautentabulatur in
Deutschland. Der Tanz,
vielleicht einer
Fuggerin verehrt oder
von einer Fugger-Dame
besonders geschätzt, ist
ein heiterer deutscher
Gesellschaftstanz, der
für die tänzerische
Lebendigkeit der Laute
bestens geeignet ist.
FILIPPO Dl MONTE gehört,
obwohl er zeitlich in
die Spätrenaissance
hineinreicht, zur
älteren Generation der
Lasso und Palestrina.
Der flämische Meister
studierte wie Lasso in
Italien und war eine
Zeitlang an der King's
Chapel in London tätig.
1568 wurde er
Hofkomponist und Musiker
bei Maximilian II. in
Wien. Seit 1576 stand er
in Rudolfs II. Diensten
in Prag, wo er 1603
verstarb. Wie viele
andere Komponisten und
Künstler seiner Zeit
genoß er die
Großzügigkeit der
Fugger. Er brachte
seinen Dank an Johann
Fugger für die 1554/55
zu Antwerpen und zu
Augsburg erwiesene Gunst
in der Widmung seines
ersten Buches „Madrigali
Spirituali" (1583) zum
Ausdruck. Das
fünfstimmige Madrigal
„Sottile e dolce ladra"
aus dem dreizehnten Buch
ist ein Versuch in der
modernen Schreibart; di
Monte bleibt in der
Harmonieführung der
älteren Generation
verbunden, ist jedoch
sonst dem modernen Stil
Giovanni Gabrielis mit
kurzen Motiven und
Ansätzen zur
Mehrchörigkeit
verpflichtet.
HASSLERS Sammlung „Neue
teutsche Gesang" wurde
1596 zu Augsburg
gedruckt. Sie enthält
mit die besten deutschen
rnehrstimmigen Lieder
und weist eine herrliche
Stilvermischung der
Canzonetten und
Madrigale auf. Der
achtstimmige Satz „Mein
Lieb will mit mir
kriegen" für zwei Chöre
läßt eine solche
Stilvermischung
erkennen; er zeigt
ferner sehr deutlich
Haßlers meisterhafte
Beherrschung der
Mehrchörigkeit in der
wechselnden Verwendung
beider Chöre. - „Ich
scheid von dir mit
leyde" (sechsstimmig)
ist ein
durchkomponiertes
deutsches Madrigal von
außerordentlicher
Schönheit. Die tiefe
Innerlichkeit der
Melodik, ihre Erfüllung
durch die feinsinnig
ausgearbeitete Harmonie
mit trefflicher
Verwendung der
Dissononz, die Andeutung
der Mehrchörigkeit, die
bezaubernde Vermischung
der polyphonen und
homophonen Schreibart
und das schöne
melodische Fließen der
Stimme(n) vereinen sich
zu einem der schönsten
weltlichen Chorwerke
Haßlers.
CHRISTIAN ERBACH,
geboren um 1570 zu
Gaualgesheim
(Rheinhessen), von 1596
bis 1614 Organist von
Marcus Fugger d. J. und
Nachfolger Haßlers als
Stíftsorganíst an St.
Moritz, war ab 1614
Haupt-Stadtpfeífer und
Hilfsorganist am Dom.
Von 1624 bis zu seinem
Tode 1635 war er
Domorganist, daneben
eifriger Lehrer und
angesehener Komponist.
Erbachs Orgelwerke
zeigen eine gepflegte
Kontrapunktlk und eine
Vorliebe für das
Ricercar. Zum größten
Teil sind seine
Ricercare, wie das
vorliegende VII. Toni,
monothematisch
durchgeführt, wobei aber
oft melodische Ideen in
lebendigeren Rhythmen
hinzutreten, die als
Kontrapunkte zum
Hauptsubjekt im Laufe
des Stückes ihre
Durchführung erfahren.
ADAM GUMPELZHAIMER gilt
als beeutendster
Musiktheoretiker und
evangelischer
Kirchenmusiker
Augsburgs. Er wurde 1559
zu Trostberg
(Oberbayern) geboren,
erhielt seine
musikalische Erziehung
im Augsburger
Benediktinerkloster St.
Ulrich und Afra und
wurde 1581 Praeceptor
und Kantor am Gymnasium
St. Anna. 1582
begleitete er,
möglicherweise als
Erzieher, die Söhne
Johann Jakob Fuggers an
die Universität
Ingolstadt. 1590 wurde
er Augsburger Bürger und
blieb in seinem Amt am
St. Anna-Gymnasium bis
zu seinem Tode im Jahre
1625. - Die zwei
dreistimmigen
Kirchenlieder „nach Art
der Welschen
Villanellen" sind
volkstümllcher Art
(Villanellen =
Bauernlieder), aber in
ihrer geschmackvollen
imitatorischen
Polyphonie zugleich
kleine Kunstwerke. Sie
dürften neben dem
Gottesdienst auch dazu
gedient haben, die
jungen Gymnasiasten in
die Kunst der
Mehrstimmigkeit
einzuführen.
JEAN BAPTISTE
BESARD(US), geboren in
Bensançon (Burgund),
promovierte 1587 zum Dr.
juris, studierte Laute
bei Lorenzini in Rom und
ist in Augsburg 1617
nachweisbar. Hier war er
als Advokat tätig, galt
aber daneben als
ausgezeichneter Kenner
der Lautentechnik des
neuen (17.)
Jahrhunderts. Besard
ließ in Augsburg zwei
Werke für Laute
veröffentlichen:
„Isagoge in artem
testudinarium" (1614)
und „Concertationes
Musicae“ (1617). Die
Gailiarde (ein Nachtanz
im Tripeltakt, wie der
Saltarello od. Hupfauf)
- in freier Übersetzung
ihres Titels: „Galliarde
von Pomponi von Bologna,
bekannt unter dem Namen
Dolorata“ - ist ein
heiterer Tanz in
dreiteiliger Form
(aabbcc) und stammt aus
dem sechsten Buch
„Thesaurus Harmonius"
(1605).
GREGOR AICHINGER wurde
1564, im gleichen Jahr
wie sein Kollege Haßler,
geboren. 1573 war er
Singknabe bei Lasso in
München, 1578 Student in
Ingolstadt und 1584
Fuggerorganíst bei St.
Ulrich und Kammermusiker
Jakob Fuggers. Bald
darauf ging er zu
Giovanni Gabriele nach
Venedig und 1588 wieder
nach Ingolstadt, um
seine Studien
fortzusetzen. Um 1600
wurde er Geistlicher und
als Chorvikar an den Dom
berufen. Er starb zu
Augsburg 1628. . „Beati
omnes qui timent
Dominum", eine
dreiteilige Motette im
Stil der Lasso-Schule
(1. Teil: 5-stimmig; 2.
Teil: 3-stimmig; 3.
Teil: 5-stimmig) ist auf
unserer Platte das
einzige Vokalwerk über
einen lateinischen Text.
Als Abschluß folgt die
herrliche deutsche
Liedmotetle „Herzlich
lieb hab ich dich, o
Herr“ von Hans Leo
Haßler. Beide Werke sind
Perlen der Kirchenmusik
Augsburgs und stammen
von zwei der größten
Meister des süddeutschen
Raumes - Komponisten der
Stadt Augsburg unter der
Schirmherrschaft des
Hauses Fugger.
C.
RUSSELL CROSBY
(Columbia C 91 109)
|
|