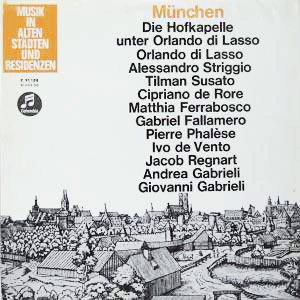 |
|
1 LP -
C 91 108 - (p) 1962
|
 |
| 1 LP - 1
C 037-45 573 - (p) 1962 |
|
| MÜNCHEN - Die
Hofkapelle unter Orlando di Lasso |
|
|
|
|
|
| Orlando di Lasso
(ca. 1532-1594) |
Princeps Marte
potens, Giulielmus - in
Lasso-Gesamtausgabe
|
6' 50" |
A1
|
|
Friedrich
Schmidtmann, Wolfgang Schwarzrock,
Gerhard Kastner, Blockflöte | Otto
Steikopf, Zink und Alt-Krummhorn
|
|
|
|
Albert Renz, Zink
| Fritjof Fest, Diskant-Pommer |
Heinrich Göldner, Tenor-Pommer
|
|
|
|
Alfred Lessing,
Gerhard Naumann, Heinrich
Haferland, Horst Hedler, Viola da
gamba | Helmut Schmitt, Harry
Berteld, Hurt Federowity,
Renaissance-Posaune
|
|
|
|
RIAS-Kammerchor |
Günther Arndt, Leitung
|
|
|
| Anonym |
Aufzug
- in "Erbe deutscher Musik" |
0' 46" |
A2 |
|
Walter Holy,
Helmut Finke, Clarin | Helmut
Schmitt, Wilhelm Wendlandt,
Renaissance-Posaune | Günther
Scholz, Pauke |
|
|
| Alessandro Striggio
(1535-1587) |
Il
gioco di primiera (Caccia) |
4' 05" |
A3 |
|
RIAS-Kammerchor |
Günther Arndt, Leitung |
|
|
| Tilman Susato
(gest. nach 1561) |
Rondo
und Saltarello - nach "Het
derde Musyck boexken mit
vier partyen" (Antwerpen
1551) |
1' 16" |
A4 |
|
Friedrich
Schmidtmann, Blockflöte | Otto
Steinkopf, Fritjof Fest,
Heinrich Göldner, Gerhard
Kastner, Krummhorn |
|
|
|
Eugen
Müller-Dombois, Michael
Schäffer, Renaissance-Laute
|
|
|
| Cipriano de Rore
(1516-1585) |
O
sonno o della queta humida ombrosa
- (Sonett von Giovanni della Casa) |
3' 05" |
A5 |
Maria
Friesenhausen, Sopran | Emmy
lisken, Alto | Theo Altmeyer,
Tenor | Claus Ocker, Bariton
|
|
|
| Anonym |
Der gestreifft
Dantz - Der Gassenhauer darauffn
- aus "Lieder und Tänze auf die
Lauten" (München, um 1540) |
0' 46" |
A6 |
|
Eugen
Müller-Dombois,
Renaissance-Laute
|
|
|
| Matthia Ferrabosco
(1550-1616) |
Che giovaebbe
haver bellezza (Canzonetta)
- Denkmäler der Tonkunst in
Österreich, Band 90 |
0' 50" |
A7 |
|
Maria
Friesenhausen,
Sopran |
Jeanne
Deroubaix,
Mezzosopran |
Emmy Lisken,
Alto | Theo
Altmeyer,
Tenor
|
|
|
| Alfred Lessing,
Diskant-Gambe | Horst Hedler,
Tenor-Gambe | Eugen
Müller-Dombois, Michael
Schäffer,
Renaissance-Laute |
Walter Thoene, Spinett |
|
|
| Gabriel Fallamero |
Vorria,
Madonna, fareti a sapere
(Canzonetta alla Napolitana) - 1584 |
2' 56" |
A8
|
| Jeanne
Deroubaix,
Mezzosopran |
Eugen
Müller-Dombois,
Michael
Schäffer,
Renaissance-Laute |
|
|
| Matthia Ferrabosco |
Se
si spezzasse sta dura catena (Canzonetta) -
Denkmäler der Tonkunst in
Österreich, Band 90 |
1' 04" |
A9 |
|
Maria Friesenhausen, Sopran |
Jeanne
Deroubaix,
Mezzosopran |
Emmy Lisken,
Alto | Theo
Altmeyer,
Tenor
|
|
|
| Alfred Lessing,
Diskant-Gambe | Horst Hedler,
Tenor-Gambe | Eugen
Müller-Dombois, Michael
Schäffer,
Renaissance-Laute |
Walter Thoene, Spinett |
|
|
| Tilman Susato |
Pavane
und Gaillarde - aus "Het derde
musyck boexken" (Antwerpen 1551) |
1' 34" |
A10 |
|
Otto
Steinkopf, Fritjof
Fest, Alt-Krummhorn |
Heinrich Göldner,
Tenor-Krummhorn |
Gerhard Kastner, Baß
Krummhorn
|
|
|
| Orlando di Lasso |
Si le long
temps (Chanson) - in
Lasso-Gesamtausgabe
|
1' 10" |
A11 |
|
Jeanne
Deroubaix, Mezzospran | Alfred
Lessing, Alt-Gambe | Gerhard
Naumann, Horst Hedler,
Tenor-Gambe
|
|
|
| Tilman Susato |
Allemainge
- aus "Het derde
musyck boexken" (Antwerpen 1551) |
0' 54" |
A12
|
|
Friedrich
Schmidtmann, Diskant-Blockflote
| Wolfgang Schwarzrock, Gerhard
Kastner, Tenor-Blockflote | Otto
Steinkopf, Alt-Krummhorn |
|
|
|
Alfred Lessing,
Gerhard Naumann Alt-Gambe |
Heinrich Haferland, Horst
Hedler, Tenor-Gambe
|
|
|
| Orlando di
Lasso |
Un aduocat dit
à sa femme (Chanson) - in
Lasso-Gesamtausgabe
|
1' 13" |
A13 |
| Jeanne
Deroubaix,
Mezzosopran |
Emmy Lisken,
Alto | Theo
Altmeyer,
Tenor
| Claus Ocker, Bariton |
|
|
|
Eugen Müller-Dombois, Michael Schäffer,
Renaissance-Laute |
|
|
| Orlando di
Lasso |
Al gran
Guilielmo nostro - Huldigungsmadrigal
für Wilhelm aus
"Continvation dv mellange
d'Orlande..." 1584
|
1' 20" |
A14 |
|
RIAS-Kammerchor
| Günther
Arndt, Leitung
|
|
|
Pierre Phalèse
(ca. 1510-1573)
|
Pavane
und Galliarde ferrarese - aus
"Liber I leviorum carminum" (Löwen
1571)
|
3' 09"
|
B1 |
|
Friedrich
Schmidtmann,
Diskant-Blockflöte |
Fritjof Fest,
Diskant-Pommer | Otto
Steinkopf, Nicolo |
Heinrich Göldner,
Tenor-Dulcian
|
|
|
|
Gerhard
Tuchtenhagen,
Baß-Dulcian | Eugen Müller-Dombois, Michael Schäffer,
Renaissance-Laute |
|
|
| Ivo de Vento
(gest. 1575) |
Ich bin
elend, wo ich umfahr
- aus "Neue teutsche
Lieder mit 4 Stimmen samt
2 Dialogen" (München
1570), Nr. 13
|
2' 13" |
B2 |
|
Emmy
Lisken, Alt | Theo
Altmeyer, Dietrich
Lorenz, Tenor | Claus
Ocker, Bariton
|
|
|
|
Alfred
Lessing, Alt-Gambe |
Horst Hedler,
Tenor-Gambe |
|
|
| Ivo de Vento |
Vor
etlich wenig Tagen -
aus "Neue
teutsche Lieder mit 3
Stimmen samt 2 Dialogen"
(München 1572), Nr. 9 |
0' 42" |
B3 |
|
Maria
Friesenhausen, Sopran
| Jeanne Deroubaix,
Mezzospran | Emmy
Lisken, Alt |
|
|
|
Wolfgang
Schwarzrock,
Alt-Blockflöte | Eugen Müller-Dombois, Michael Schäffer,
Renaissance-Laute |
|
|
| Ivo de Vento |
Ich
weiß ein Maidlein hübsch
und fein - aus
"Teutsche Lieder mit 5
Stimmen samt einem Dialog
mit achten" (München
1573), Nr. 15 |
1' 04" |
B4 |
|
Maria Friesenhausen, Sopran |
Jeanne
Deroubaix,
Mezzospran |
Emmy Lisken,
Alt | Dietrich
Lorenz, Tenor
| Claus Ocker,
Bariton
|
|
|
|
Wolfgang
Schwarzrock,
Alt-Blockflöte | Gerhard
Kastner,
Tenor-Blockflöte |
Alfred Lessing,
Alt-Gambe | Horst
Hedler, Tenor-Gambe |
Otto Steinkopf,
Baß-Dulcian
|
|
|
| Anonym |
Der Maruscat
Danntz - Der Auff und auff -
aus
"Lieder und Tänze auf die
Lauten" München, um 1540
|
1' 18" |
B5
|
|
Eugen
Müller-Dombois,
Renaissance-Laute
|
|
|
| Jacob Regnart
(1540-1600) |
Venus, du und
dein Kind - aus
"Kurzweilige teutsche
Lieder zu 3 stimmen..."
Nürnberg 1576
|
1' 30" |
B6 |
|
Jeanne Deroubaix, Mezzosopran | Emmy Lisken, Alto | Theo
Altmeyer,
Tenor
| Friedrich
Schmidtmann,
Diskant-Blockflöte
Wolfgang
Schwarzock,
Alt-Blockflöte
| Eugen
Müller-Dombois, Michel
Schäffer,
Renaissance-Laute |
Walter Thoene,
Spinettino
|
|
|
| Jacob Regnart |
Nach
meiner Lieb viel hundert Knaben
trachten - aus
"Der ander Teil
kurzweiliger
teutscher Lieder
zu 3 Stimmen..."
(Nürnberg 1577) |
2' 00" |
B7 |
|
Maria Friesenhausen, Sopran | Jeanne Deroubaix,
Mezzosopran |
Emmy Lisken,
Alto
Friedrich
Schmidtmann,
Diskant-Blockflöte
| Wolfgang
Schwarzock,
Alt-Blockflöte
| Alfred
Lessing, Tenor-Gambe
Eugen Müller-Dombois,
Michel Schäffer,
Renaissance-Laute |
Walter Thoene,
Spinettino |
|
|
Tilman Susato
|
Pavane
(La Bataille) - aus
"Het derde musyck
boexken"
(Antwerpen 1551) |
1' 10" |
B8 |
|
Otto
Steinkopf, Fritjof
Fest, Alt-Krummhorn |
Harry Berteld,
Tenor-Posaune | Kurt
Federowitz,
Baß-Posaune |
|
|
| Giovanni Gabrieli
(1557-1613) |
Sacro tempio
dßhonor - Madrigal,
Venedig 1586
|
3' 25" |
B9 |
RIAS-Kammerchor
| Alfred Lessing,
Diskant-Gambe | Gerhard
Naumann, Alt-Gambe |
Gerhard Kastner,
Baß-Blockflöte
Heinrich
Haferland, Horst Hedler,
Tenor-Gambe | Günther
Arndt, Leitung |
|
|
| Andrea Gabrieli
(ca 1510-1586) |
O sacrum
convivium |
1' 37" |
B10 |
Otto
Steinkopf, Zink |
Fritjof Fest, Nicolo |
Helmut Schmitt,
Alt-Posaune | Heinrich
Göldner, Tenor-Dulcian |
Harry Berteld,
Tenor-Posaune
|
|
|
| Orlando di
Lasso |
Wie lang, o
Gott, in meiner Not - in
Lasso-Gesamtausgabe |
3' 49" |
B11 |
|
RIAS
Kammerchor | Günther
Arndt, Leitung |
|
|
Orlando di Lasso
|
In
hora ultima - Motette
6stimmig, gedr. 1604 aus "Magnum
opus musicum" |
2' 00" |
B12 |
|
RIAS
Kammerchor |
Otto Steinkopf,
Albrecht Renz,
Zink | Helmut
Schmitt, Harry
Berteld, Kurt
Fedderowitz,
Remaissance-Posaune
Heinrich
Göldner,
Tenor.Pommer |
Günther Arnst,
Leitung
|
|
|
|
|
|
Interpreters (see
above).
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
- |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Fritz
Ganss / Gerd Berg / Christfried
Bickenbach / Horst Lindner |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- C 91 108 - (1 LP) - durata 51'
06" - (p) 1962 - Analogico |
|
|
Altre edizioni
LP
|
|
EMI
Electrola - 1 C 037-45 573 - (1
LP) - durata 51' 06" - (p) 1962 -
Analogico |
|
|
Edizioni CD |
|
- |
|
|
Cover |
|
München
im 16. Jahrhundert von Jost Ammon
- München, Graphische Sammlungen
|
|
|
|
|
Musik
in München
Als der bedeutende
Kaufherr und Kunstmäzen
Hans Jacob Fugger seinem
herzoglichen Freunde
net, Orlando di Lasso
als „magister puerorum“
nach München zu
verpflichten. war er
wohl unterrichtet über
Albrechts V. Ambitionen,
am bayrischen Hofe ein
neues Zentrum der
vielgepriesenen „Musica
reservata“ zu schaffen,
ein Zentrum, das nicht
hinter dem Glanz der
anderen deutschen
Musikmetropolen der Zeıt
zurückstehen sollte.
Diese Wünsche
verwirklichlen sich in
einem kaum zu
erwartenden Ausmaß.
Orlando. Nachfahr jener
berühmten
Niederlander-Schule. die
mit den Meistern Dufay,
Ockeghem, Obrecht.
Josquin und Willaert
seit anderthalb
Jahrhunderten
europäische Geltung
behauptete, war wie
seine Vorgänger
Kosmopolit. Durch seine
Reisen von Hof zu Hof,
von Stadt zu Stadt waren
ihm die musikalischen
Formen der damaligen
Zeit in ihren nationalen
Ausprägungen ebenso
vertraut wie die
Sprachen der Länder, in
denen er gelebt hatte.
Mit Weitläufigkeit und
kompositorischer
Unıversalität brach er
in die intime,
lokalgebundene Sphäre
des bayrischen Hofes ein
und gab innerhalb
weniger Jahre,
während derer er zum
Kapellmeister
avancierte. dem Münchner
Musikleben ein
internationales Gepräge.
Obwohl Orlando
italienisches Madrigal,
napolitanische
Villanelle. französische
Chanson und deutsches
Lied gleichermaßen in
ihren charakteristischen
Zügen zu treffen wußte,
blieb doch die
kontrapunktische Kunst
der Niederländer, der
motettische Satz.
Grundlage seines
Schaffens. In einer sehr
persönlichen Synthese
gelang diesem genialen
Meister noch einmal eine
Verschmelzung von
traditionellen Elementen
mit neuen Form- und
Klangidealen. Die beiden
Huldigungskompositionen
an Herzog Wilhelm, den
Nachfolger Albrechts V.,
zeigen, in welchem
Umfang die Grenzen
zwischen den einzelnen
Formen in dieser Zeit
des Stilumbruchs
verwischt waren (Al
gran Guilielmo nostro
ist nur seiner Sprache
wegen als Madrigal zu
bezeichnen); stilistisch
stehen beide Werke, in
der Spätzeit Orlandos
entstanden, auf einer
Ebene. Das pomphaft
dahinschreitende Pathos
der vollstımmigen Sätze,
konzentriert auf die
Entfaltung von
monumentaler
Klangpracht, wird in der
Motette Princeps
Marte potens,
Guilielmus im
letzten der neun Teile
noch durch
Doppelchörigkeit
gesteigert.
Die Chansons Si le
long tems und Un
aduocat dir à
sa femme sind in
der mittleren
Schaffensperiode des
Meisters komponiert.
Während Un aduocat
die plappernde
syllabısche Deklamation
und den tänzerisch
federnden Rhythmus der
typischen französischen
Chanson aufweist. geht Si
le long tems in
seinem musikalischen
Duktus mehr dem
lyrischen Ton der
Liebesklage nach.
Mit dem deutschen Lied
beschäftıgte sich Lasso
erstmals in seiner
Münchner Zeit, 1567 gab
er seine Herzog Wilhelm
gewidmete Sammlung Newe
teütsche Liedlein
heraus. der Wie
lang, o Gott
entnommen ist. Wenn die
beiden selbständigen
Partien auch durchaus im
choralartigen deutschen
Liedstil geschrieben
sind, so hat doch Lasso
die Wortausdeutung der
Musica reservata. wie
sie damals im deutschen
Salz noch nicht üblich
war, in seine
Komposition
hineingenommen.
In der nachgelassenen
Motette In hora
ultima, einem der
grandiosesten Werke des
späten Lasso, wird der
Text musikalisch
dramatisiert. Die
wuchtige. durch
Scheinpolyphonie leicht
verschleierte Akkordik
auf die Worte In
hora ultima
eröffnet. einem Vorhang
gleich, die Szene. in
der, wie in einem
gewaltigen barokken
Wirbel hineingerissen,
der Jubilus der
Daseinsfreuden sich
entlädt. Im Gegensatz zu
dem Sinn des
apokalyptischen Textes,
der beschreibt, was in
jener "letzten Stunde"
untergehen werde, löst
Lasso in der isolierten
Illustration des
einzelnen Wortes die
Komposition in freudig
erregte Bewegung auf.
Cipriano de Rore, wie
Lasso ein Niederländer.
war im Dienste des
Herzogs von Ferrara
tätig, der mit dem
Münchner Hol enge
Beziehung unterhielt.
Cipriano hatte dem
bayrischen Herzog und
auch der Familie Fugger
Kompositionen gewidmet
und erfreute sich
besonderer Wertschätzung
bei Albrecht V.: ein
prachtvoller
Pergamentcodex mit
seinen Motetten wurde
für die herzogliche
Bibliothek angefertigt
und von dem berühmten
Hofmaler Hans Müelich
illustriert. Sogar die
Vermählung des
bayrischen Thronfolgers
Wilhelm mit Renata von
Lothringen wurde durch
eine Meßkomposition de
Rores eingeleitet.
Lassos Schaffen wurde
besonders beeinflußt
durch die Madrigal-sätze
des älteren Meisters,
die um die Mitte des
Jahrhunderts, zusammen
mıt den Werken
Willaerts, eine
Revolutionierung der
Klangvorstellung
eingeleitet hatten. Das
Madrígal mit seinen
empfindungsstarken
Texten diente als
Experimentierfeld auf
der Suche nach neuen
Ausdrucksrnöglichkeiten,
die Ciprıano de Rore in
kühner Chromatık,
ungewohnten Dissonanzen
und plastischer Gestık
der Deklamation fand. O
sonno o della queta
humida ombrosa,
nach einem Sonett von
Giovanni della Casa,
präsentiert alle seine
Errungenschaften und ist
zudem besonders
interessant in seiner
formalen Gestaltung, die
exakte und variierte
Wiederholung einzelner
Abschnitte
miteinbezieht.
Alessandro Strıggio,
der, ebenso wie Cipriano
de Rore, Kompositionen
zu jener mit allem
Renaissance-Pomp
gefeierten Vermählung
Wilhelms beisteuerte,
war zu dieser Zeit im
Dienste Cosimos de'
Medici tätig und schrieb
für die Festlichkeiten
am Hofe von Florenz
unter anderem seine
Intermedienmusiken, die
ihn berühmt machen
sollten. Wie sehr auch
das Madrigal der
szenischen Darstellung
zustrebte, zeigt seine
Komposition Il gioco
di primıera, die
wegen ihrer Turbulenz
und dramatischen Faktur
als Caccia
bezeichnet ist. Das
amüsante Genrebild einer
Runde von
Kartenspielern, die sich
zum Primspiel
zusammengesetzt hat.
stellt satz-technische
Mittel wie Kontrapunkt,
Wechsel der Stimmenzahl
und Wortausdeutung ganz
in den Dienst einer
naturalistischen
Schilderung.
Eine enge Verbindung
zwischen den Höfen von
München und Graz ergab
sich durch die
Vermählung Erzherzog
Karls II. mit der
bayrischen
Herzogstochter Maria.
Die Musiker der beiden
Höfe wurden gelegentlich
ausgetauscht, und so kam
im Jahre 1585 Matthia
Ferrabosoo nach München,
der als
Wizekapellmeister in
Graz wirkte. Seine
vierstimmigen
Canzonetten waren soeben
im Druck erschienen und
hatten großes Aufsehen
erregt. bedeuteten sie
doch eine
Erweiterung und
Verfeinerung der
Satztechnik gegenüber
der alten dreistimmígen
Form der Villanelle. Che
giovarebbe haver
bellezza und Se
si spezzasse sta dura
catena sind in der
klar gegliederten
Dreiteiligkeit, in ihrem
frischen, dabei aber
geistvollen Ausdruck
charakteristische
Beispiele dieser neuen
Gattung einer gehobenen
Gesellschaftskunst.
Ungefähr zur gleichen
Zeit wie die Canzonetten
Ferıaboscos erschien in
Venedig eine Sammlung
intavolierter
Vokalkompositionen a
3 et a 4 voci per
cantare et sonare
composte per Gabriele
Fallamero. Über
die Lebensdaten des
Komponisten ist nichts
bekannt, einzig dieser
eine Tabutaturenband
wurde von ihm
überliefert. Von Lasso,
Cipriano de Rore und
anderen Komponisten
verwendete er in seinen
Bearbeitungen Werke, die
er ihrer polyphonen
Struktur entkleidete und
in einen homophonen
Lautensatz brachte.
Das Verhältnis zwischen
dem feinsinnigen Stück
Fallameros und den
anonymen Lautensätzen
aus einer Münchner
Handschrift um 1540 wird
etwa durch Lassos
Unterscheidung von
„italienischer
Lieblichkeit” und
„teutscher Dapfrigkeit”
charakterisien. In der
Verknüpfung von Gestreitt
Danntz und Gassenhauer
darauff von
"Mariscat Danntz" und Auff
und Auff ist die
für die damalige
Tanzmusik übliche Folge
von geradtaktigem Tanz
und seiner Variierung im
Dreierrhythmus zu
erkennen, die auch die
Kompositionen Susatos
und Phaléses weitgehend
bestimmt. Die Besetzung
dieser für vier
Instrumente
geschriebenen Stücke ist
frei, so daß eine
vielfältige Möglichkeit
klanglicher
Kombinationen gegeben
ist. Die Sammlungen
Susatos und Phalèses
(beide verlegten
überdies die Werke
Lassos) waren mit ihren
Tanzweisen im Bestand
der Münchner Hofkapelle
vertreten.
Die Musikpraxis jener
Zeit erlaubte nicht nur
die beliebige
Zusammenstellung der
Instrumente, es war auch
üblich,
Vokalkompoısitionen
instrumental
autzuführen, wie es in
der kleinen Motette des
Venezianers Andrea
Gabrieli O sacrum
convivium
praktiziert worden ist.
Das Werk wurde 1565
Herzog Albrecht V.
gewidmet. Andrea
Gabrielis Neffe Giovanni
war 1575-79 in München
Schüler Lassos und wurde
durch ihn mit der
niederländischen
Satztechnik vertraut
gemacht. In seinem
geistlichen Madrigal Sacro
tempio d'honor
verbindet er die neue
venezianische
Errungenschaft der
Doppelchörigkeit mit der
traditionellen
Polyphonie.
Nur um ein Jahrzehnt
jünger als Lasso, sind
doch bereits Ivo de
Vento und Jacob Regnart
Vertreter einer
Komponistengeneration,
die diese alten
Bindungen aufgab. Die
Vorherrschaft der
kontrapunktischen
Struktur wurde abgelöst
durch italienische
Gestaltungsweise. die
sich zunächst im
Vokalsatz in zunehmender
Homophonisierung,
Dominanz der Melodlk und
klarer symmetrischer
Formgebung bemerkbar
machte. Daß der
Schwerpunkt im Schaffen
beider Meister auf dem
Gebiet der Lied- bzw.
Villanellenkomposition
lag, ist von dieser
neuen Einstellung her zu
verstehen, vereinigte
doch die Gattung der
Villanelle alle
Charakteristika in sich,
die ietzt als Vorzüge
empfunden wurden.
Ivo de Vento stand zeit
seines Lebens im Dienste
des bayrischen
Fürstenhauses, zunächst,
noch im Knabenalter, als
Sänger, später als
Organist und
Kapellmeister. Seine
sedıs Sammlungen Neuer
teutscher Lieder gab er
innerhalb von sechs
Jahren (1569-75) heraus.
Während Ich bin elend
noch dem polyphonen
deutschen Liedsatz
Ludwig Senfls
verpflichtet ist, sind
die beiden anderen
Kompositionen. auch vom
Text her, der Form der
Villanelle angenahert.
Noch krasser als de
Vento und sehr bewußt
wendete sich Jacob
Regnart von der alten
kunstvollen Satztechnik
ab. Seine Kurzweiligen
teutschen Lieder nach
Art der Napolitanen
oder welschen
Villanellen
leitete erein mit den
Versen:
„Laß
dich darum nicht wenden
ab,
Daß
ich hierin nit brauchet
hab
Viel
Zierlichkeit der Musik
Wiß.
das es sich durchaus
nicht schick,
Mit
Vıllanellen hoch zu
prangen
Und
wöllen dadurch Preis
erlangen;
Wird
sein vergebens und
umsunst,
An
andre Ort gehört die
Kunst“
Und doch bewunderte
Lasso diese
Kompositionen Regnarts
sehr und beschäftigte
sich intensıv mit ihnen:
hinter ihrer scheinbaren
Unkompliziertheit und
Eıngängigkeit verbergen
sich höchst geistvolle
Parodıen rnadrigalesker
Manierismen wie
rustikaler
Grobschlächtıgkeit. Beim
Publikum hatten Regnarts
Villanellen überaus
großen Erfolg, wieder
und wieder wurden die
Sammlungen neu gedruckt.
Seine Weısen wurden zum
Volksgut. Nicht nur
Vulpius und Schein
brachten Venus, du
und dein Kind in
einen protestantischen
Choralsatz (Auf
meinen lieben Gott),
selbst in den Kantaten
Johann Sebastian Bachs
begegnen uns noch
Melodien Regnarts.
Doris
Beckmann
Die Hofkapelle unter
Orlando di Lasso
In aller Fülle und
Breite durfte die Musik
in Deutschland wirken,
als das Zeitalter der
Renaissance sich
vollendete. In dieser
Spätperiode erstanden
bedeutende Ptlegestätten
der Musik. Man nennt
diese Zeit „Manierismus“
in der Kunstgeschichte.
In der Musikgeschichte
bedeutet diese späte
Stilphase 1550-1600
höchste Reifung der
mehrstimmigen Technik
und zugleich Einbruch
eines neuen akkordischen
Hörens, wie es dann im
Frühbarock den
„Generalbaß“ eingeleitet
hat.
Es kann nicht
verwundern, daß in der
Zeil der Stllvollendung
auch das äußere Wirken
der Musik eine
Verfeinerung erfuhr.
Daher das Emporblühen
glanzvoller fürstlicher
Kapellen an vielen
Orten: ln Österreich
waren es vor allem Wien,
Graz, Innsbruck. nach
1580 auch Salzburg. In
Süddeutschland aber
überragte München alle
anderen Kapellen an den
Höfen deutscher Zunge.
Das war kein Zufall.
Nach dern Vorgange von
Andreas Zauner und
Ludwig Daser stand dort
seit etwa 1563 der
„belgische Orpheus"
Orlando di Lasso an der
Spitze der Kapelle. Als
einfacher Tenorist hatte
er sich 1556 in die
Dienste des bayerischen
Herzogs Albrecht V. in
München begeben. Bis zu
seinem Tode. last vier
Jahrzehnte lang. war er
die plagende Kraft einer
„Münchener Musik", die
sich als ein
geschlossener Stilkreis
auch in zahlreichen
Handschriften und
Notendrucken, kostbaren
Raritäten der alten
Hofbibliothek.
abzeichnet.
Ein Dokument dieser
Münchener "Ära" ist zum
Beispiel jener um 1560
von dem bayerischen
Hofmaler Hans Müelich
mit bunten Miniaturen
ausgestattete Kodex, in
dem Lassos "Bußpsalmen"
festgehalten wurden,
lange vor ihrer
Veröffentlichung in
einem Druck. als ein
geheimer Besitz des
bayerischen Hofs und
befreundeter
Fürstenhauser. In der
stattlichen Reihe der
alten Drucke, die
Münchener Komponisten
bevorzugen, sehen wır
zum Beispıel jenen Band
des Jahres 1569 rnıt dem
Tıtel Musica de'
vırtuosi della florida
capella dell'... S.
Duca di Baviera,
mit dem ein
venezianischer Verleger
der „Münchener Schule"
huldigte. So ist es
ungemein interessant,
einen Blick in das
damalige Münchener
„Repertoire“ zu werfen,
in dessen Mittelpunkt
sich Lasso als magister
cappellae und als
Komponist befand. Der
äußere Rahmen, die sog.
„Neue Vest“, in deren
Kapellen und kleineren
Nebenräumen musiziert
wurde, ist schon im 18.
Jahrhundert einem Brande
zum Opfer gelallen.
Einzig in der
benachbarten Residenz
des Thronfolgers Wilhelm
V., der Burg Trausnitz
bei Landshut, haben sich
die Räume erhalten, in
denen jene Musik
festlich erklang.
Wilhelm V. stand vor
seiner Thronbesteigung
(1579) in herzlichem
Briefwechsel mit Lasso.
Als er seine Vermählung
mit Renata von
Lothringen 1568 feierte,
erreichten die
vereinigten Landshuter
und Münchener Kapellen
ihren größten Bestand
mit etwa 18 Singknaben,
je 4-6 Altisten,
Tenoristen und Bassisten
(unter ihnen bedeutende
Gesangsvirtuosen
italienischer Abkunft)
und 20-30
Instrumentisten. Seit
1580 verstärkte man den
Diskant in steigendem
Maße mit Kastraten.
Aufgezeichnet wurde die
Musik entweder in
einzelnen Stimmbüchern
(also für jede Stimmlage
ein einzelnes Heft) oder
in einem großen
„Chorbuch" in dem alle
Stimmen zugleich, und
zwar nacheinander
erschienen, so daß der
ganze Chor aus einem
einzigen solchen Buch,
dessen Noten groß gemalt
waren, singen konnte.
Eine moderne „Partitur“
mit durchgezogenen
Taktstrichen gab es noch
nicht ın dieser Praxis.
Die zeitgenössischen
Abbildungen der
Münchener Kapelle
zeigen, daß man -
wenigstens außerhalb des
Gottesdienstes - viele
Instrumente die Stimmen
des Chores mitspielen
ließ, Dabei wird man
sich auch der freien
Improvisation und
Auszierung einzelner
Tonschrıtte bedient
haben, wie sie aus
Lehrbüchern dieser Zeit
uns bekannt ist. Doch
der Generalbaß, jene
schlicht-akkordische
Stütze des Klangs, war
noch unbekannt. So
entfaltete sich in
München am Ende der
Renaissance jene edle
Linienkunst der „alten
Niederländer“, die
altklassische
Polyphonie, zu ihrer
letzten Blüte, kurz
bevor sie der
frühbarocken "Monodie"
weichen mußte Diese
Musik gilt bis heute als
ein Ideal reiner Kunst
und hat nichts von ihrem
geheimnisvollen Zauber
eingebußt, den man ihr
schon in alter Zeit mit
dem Ausdruck "Musica
Reservata" heımaß. In
zwei prachtvollen
Bildern ist in dem
erwähnten Münchener
Müelıch-Kodex die Vokal-
und Instrumentalkapelle
Lassos um 1560
festgehalten. In dem
Bildsockel sehen wır die
Namen verschiedener
älterer und jüngerer
Komponisten dieser Zeit
eingelassen, die damals
in München besonders
geschätzt waren. Unter
ihnen zum Beispiel
Cipriano de Rore, der
mit Lasso gewiß noch
persönlich in
Oberitalien bekannt
geworden ist. Andere
Quellen, wie etwa die
Münchener Chorbücher,
die Lasso selbst
schreiben ließ für seine
Kapelle, ergänzen den
Personenkreis. Endlich
aber wurde das Bild
jener bayerischen
Renaissance-Kapelle von
der älteren Münchener
Tradition mitbestımmt,
als deren Marksteine wir
den blinden Organisten
Conrad Paumann (1450
nach München berufen)
und Ludwig Senfl (1523
primus musicus intonator
der herzoglichen
Kapelle) kennen. Die
klanglichen Neuerungen
unter Lasso 1570-1590
sind nur auf dem
Hintergrund dieser
Münchener Lokaltradition
denkbar, die sich auf
das solide Handwerk des
Kontrapunkts und auf
humanistische
Gelehrsamkeit berief.
Von der Musik, die am
bayerischen Hof unter
Lasso geschätzt war,
soll unsere Platte einen
Eindruck aus vıer
Hauptgattungen
vermitteln. Es sind jene
vier Satztypen, die im
wesentlichen auch das
riesige Schaffen von
Lasso selbst (etwa 2000
Nummern) kennzeichnen;
wir unterscheiden je
nach der Sprachebene des
Textes: 1. die
lateinische Motette, 2.
das italienische
Madrigal, 3. die
französische Chanson und
4. den polyphonen
deutschen Liedsatz.
Prof.
Dr. Wolfgang
Boetticher
Motette · Madrigal ·
Chanson · Deutscher
Liedsatz
Im 16. Jahrhundert ist
die Motette die
wichtigste, fast immer
geistliche und
lateinisch textierte
mehrstimmige Form.
Gegenüber der
Meßkomposition, deren
Text feststand, konnte
der Musiker Worte und
Bilder aus den Psalmen,
Evangelien, Episteln der
Bibel, aber auch aus
freier neulateinischer
Dichtung wählen.
Manchmal benutzte man
für eine Stimme eine
gegebene Melodie (ın der
sogenannten
cantus-fırmus-Motette),
doch war das Ganze nicht
liedmäßig gegliedert,
sondern durchaus frei je
nach den einzelnen
Motiveintritten
fortgesponnen. Man
gliederte eine solche,
meist 4- bis 6stimmige
Motette in größere
Abschnitte (prırna pars,
secunda pars etc.). Ein
oft vertonter
Motettentext war O
sacrum convivium,
von dem Lasso selbst
einen 5stimmigen Satz
hinterlassen hat. Auf
unserer Platte erklingt
die Komposition Andrea
Gabrielis (um
1510-1586): deren
instrumentale Wiedergabe
läßt die Klangfülle und
erstaunliche Satzstrenge
dieser zu Venedig an der
Kirche San Marco
heimischen Kunst ahnen.
Naturlich ist die
Motette dieser Zeit
primär Chormusik, wenn
auch oft durch
ınstrumentales Ensemble
verstärkt. Lassos In
hora ultima zeigt
dies im glanzvollen
sechsstimmigen Verband.
Eine typische
Fest-motette Münchens.
die Lasso abseits von
seinen großen zyklischen
Motettenbüchern
entworfen hat und die
erst nach seinem Tode im
Druck erschienen ist.
Ihr ernst mahnender Ton
trifft sich mit Lassos Princeps
Marte potens,
Guilielmus,
ebenfalls ein posthumes
Stück. das zweifellos
als Huldigung für
Wilhelm V. gedacht war.
Der vierstimmige Satz
ist in neun kürzere
Abschnitte aufgeteilt,
um am Schluß sich
doppelchörig zu 8
Stimmen zu erweitern.
Die zweite Gattung. das
italienische Madrigal,
reicht von
höfisch-weltlicher
Musikpflege bis zu
exklusiv-religiöser
Musiksprache. Das
Madrigal für den
bayerischen Thronfolger
Wilhelm V. Al gran
Guilielmo
nostro steht in
Nachbarschaft zu der
vorgenannten
lateinischen Motette und
läßt erkennen, wie sich
diese Form dem
"Madrigal" (ursprünglich
von mandra = Herde,
daher: Hirtengesang) in
der späten Renaissance
genähert hat. Lassos
Huldigungs-madrigal für
Wilhelm V. ist in einem
sehr raren Pariser Druck
(erstautgelegt 1584)
enthalten, von dem sich
nur einzelne Stimmbücher
erhalten hatten. Erst
jüngst hat der Verfasser
dieses Artikels den Satz
mit neu aufgefundenen
Fragmenten ergänzen und
damit zum ersten Male
veröffentlichen können
(Ges. Ausg. Lasso, Neue
Folge, Bd. I. 1956).
Wahrscheinlich war der
äußere Anlaß für dieses
großartige "motettische"
Madrigal Lassos die
Thronbesteigung Wilhelms
V. im Jahre 1579. Von
älteren und jüngeren
Zeitgenossen, die am
Münchener Hof in hohem
Ansehen standen. ruhren
die übrigen Madrigale
her.
Alessandro Striggio (um
1535-1587).
Holkapellmeister zu
Mantua, schrieb die
Caccia (caccıa = Jagd),
ein in raschen Motiven
wırbelndes Madrigal (Il
gioco dı primiera).
Canzonetten„ also
ebenfalls in raschem
Silbenvonrag gehaltene,
heitere Madrigale sind
dıe vorliegenden Stücke
von Fallamero und
Ferrabosco. Deren
deutsche Abart, auch
deutsche Villanelle
(villanesca = bäuerlich)
genannt, also das
kurzhebige, vierzeilige
Tanzliedchen, wurde nach
1570 schnell berühtnt.
Von dem Hauptmeister
dieser Form, dem
Innsbrucker Hofmusikus
Jacob Regnart
(1540-1600), stammen
zwei Sätze (Venus, du
und dein Kind und
Nach meiner Lieb viel
hundert Knaben
trachten). Hierin
begegneten sich südlıche
Beweglichkeit und
tänzerische Freude mit
der schwerblütiegen
Anlage Regnarts, der wıe
Lasso eıgentlich
„Niederlander“ war, und
zwar an einem
deutschsprachigen Hof:
Innsbruck, das
künstlerisch seıt jeher
ın engem Austausch mit
München stand. Das
Renaissance-Madrigal
verflüchtigte sich aber
nicht nur in solchen
wirbelnden Canzonetten
und Vıllanellen. Fast
gleichzeitig (1575-1595)
verfärbte es die
weltliche Liebeslyrik
und den Weltschmerz ins
Religiöse, und es
entstehen die
"geistlichen Madrigale"
(madrigali spirituali),
von denen der Satz Sacro
tempio d'honor des
Giovanni Gabrieli
(Neffen des Andrea)
zeugt. Schon das ältere
Madrigal des Cipriano de
Rore verrät den dunklen
Glanz jenes reifenden
Madrigals am Ende einer
Epoche (O sonno o
della queta humida
ombrosa).
Die französische
Chanson, die Lasso mit
über hundert Sätzen
bedacht hat, ist auf
unserer Platte mit zwei
Proben vertreten (Si
le long tems und Un
aduocat...). Nicht
immer ist es der
plapperndfrivole
Vortrag, wie wir ihn aus
der (textlich oft
gewagten) Chanson der
französischen
Kleinmeister um 1550
kennen: Lasso überhöht
den witzigen Text
wiederum mit
motettischen Mitteln und
beseelt eine Kleinkunst,
für die ihm der
befreundete französische
Hof die Anregung
gestiftet hatte. Nicht
überhörbar ist der
besondere "gallische
Esprit", den man am
bayerischen Hof
bewunderte.
Von den deutschen
Liedsätzen polyphoner
Prägung sehen wir
einiges aus den Drucken
des unter Lasso
dienenden, früh
verstorbenen Belgiers
Ivo de Vento
festgehalten. Zuerst ein
strengeres
cantus-firmus-Lied, dann
ein feines Flechtwerk im
nur dreistimmigen Satz (Vor
etlich wenig Tagen),
endlich ein
villanellenähnlicher
Tanz. Lassos Beitrag Wie
lang, o Gott ist
seiner frühesten
Sammlung Deutscher
Lieder (1567) entnommen,
die er mit Vatter
unser im Himmelreich
eröffnet hatte und in
der er - der Münchener
Tradition eines L. Senfl
bewußt - das ältere
deutsche
cantus-firmus-Lied
wieder aufgriff und mit
den Farben seiner neuen
Sakralmotette
bereicherte.
Das Bild dieser
Mümchener Musik die dem
ordo ecclesiasticus und
dem ordo saecularis
untertan war, bliebe
unvollständig ohne einen
Blick auf die rein
instrumentale
Spielmusık. Deren
eınfachste Form waren
"Tanz" und
(beschleunigtdreihebiger)
,Nachtanz'. So dienten
Rondo und Saltarello
eines Tilman Susato als
Tischmusik.
Susato ein aus Köln
zugewanderter
Antwerpener
Musikverleger, der mit
Lasso in dessen
Jugendzeit befreundet
war, erfreute sich mit
solcher
,.Gebrauchsmusık“ an den
europäischen Höfen
besonderer
Wertschätzung. Ähnlich
ist der Aufzug
(eine Intrada) eines
anonymen Meisters. Aus
solch festlichen
Praeludien und dem
beschriebenen Tanzpaar
hat sich dann nach 1600
die Instrumentalsuıte
(Praeludium, Allemande,
Courante, Sarabande,
Gigue) entwickelt, die
ihren Hohepunkt mit
Johann Sebastian Bach
erreicht. Vorerst aber
spielte man nur paarige
Tanzgruppen, wie nach
dem Gesetz Schwer-Leicht
die Stücke Pavana -
Gaillarde.
Welch stolze Haltung
verraten die
gleichlautenden Tänze
alla ferrarese
(also am estensischen
Hof zu Ferrara
gebildeten Suitenteile)
in der Fassung des zu
Löwen wirkenden
Musikdruckers und
-sammlers P. Phalesius
(Phaleijs) und die
einzeine Allemande!
Die Allemande
(eigentlich „deutscher“
Tanz) hören wir hier
noch nach einer sehr
frühen Quelle (um 1550);
erst nach 1600 stieg sie
zum Modetanz auf und
verdrängte damit die
ältere "Pavana". Intime
Hausmusik ist das
Tanzpaar aus einer
süddeutschen Handschrift
für Laute und jenes
Programmstück über eine
Schlacht (Pavane „La
Bataille“). Dabei
sollte der für uns heute
ungewohnte schwirrende
und summende Klang der
Renaissance-Instrumente
nicht unbeachtet
bleiben: die alte Laute
(mit sechs- bis
siebenpaarig
angeordneten Saiten aus
Schafdarm, mächtigem
Korpus, beweglichen
Bünden aut der
Griffplatte), das
Krummhorn (mit
Doppelrohrblatt, das
jedoch über eine
Windkapsel angeblasen,
also nicht mit den
Lippen gefaßt wurde),
die Posaune (mit engerer
Röhre. auch in höherer
Lage gebräuchlich).
Gamben, Zinken.
Blockflöten, Pommer,
(Bomharten, d. h.
Schalmeien, bis zur
Baßgröße), Dulcian,
Spinett (auch
Spinettino) treten
hinzu. Zupf- und
Tasteninstrumente
spielte man aus einer
"Tabulatur", einer
Griffschrift in Ziffern
oder Buchstaben.
So wird in diesen
Klängen eine Welt
lebendig, die keineswegs
nur auf einen höfischen
Kreis beschränkt blieb.
Der städtische
Gemeinsinn und die
Spielleute,
„Bierfiedler“ haben
diese Musik mitgezeugt,
die in manch harmlosen
Tänzchen aber doch eine
besondere grandezza
verrät. Über allem aber
strahlte die
Sakralmotette den Odem
eines Genius aus, der in
der Künstlerschaft
Orlando di Lassos der
Münchener Hofkapelle
europäichen Rang
verlieh.
Prot.
Dr. Wolfgang
Boettucher
(Columbia C 91 108)
|
|