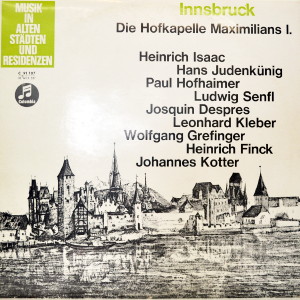 |
|
1 LP -
C 91 107 - (p) 1962
|
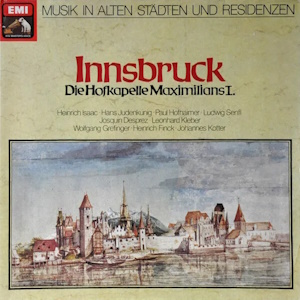 |
| 1 LP - 1
C 037-46 523 - (p) 1962 |
|
| INNSBRUCK - Die
Hofkapelle Maximilians I. |
|
|
|
|
|
| Heinrich
Isaac (vor 1450-1517) |
Innsbruck, ich
muß dich lassen - (Fassung II)
in DTÖ XIV/1, herausgegeben von
Johannes Wolf, Wien 1919
|
0' 58" |
A1
|
|
Alfred Lessing,
Diskant-Gambe | Gerhard Naumann,
Alt-Gambe | Heinrich Haferland und
Horst Hedler, Tenor-Gambe
|
|
|
| Heinrich
Isaac |
Mein Freud allein
- (Fassung II) in DTÖ XIV/1,
herausgegeben von Johannes Wolf,
Wien 1919 |
3' 07" |
A2 |
|
Fritz
Wunderlich, Tenor |
|
|
|
Gerhard Naumann,
Alt-Gambe | Frtjof Fest, Nicolo |
Otto Steinkopf, Baß-Dulcian |
Gerhard Kastner, Tenor-Blockflöte
| Gerhard Tucholski,
Renaissance-Laute |
|
|
| Hans
Judenkünig (um 1450-1526) |
Zucht, Ehr und
Lob - in DTÖ XVIII/2,
herausgegeben von A. Koczirz, Wien
1919 |
1' 52" |
A3 |
|
Eugen
Müller-Dombois,
Renaissance-Laute |
|
|
| Paul
Hofhaimer (1459-1537) |
Zucht, Ehr und
Lob - aus Georg
Forsters "Frische teutche
Liedlein" 1. Teil, Nürnberg
1539-56 |
1' 50" |
A4 |
|
Jeanne
Deroubaix, Mezzosopran | Theo
Altmeyer und Dietrich Lorenz,
Tenor | Claus Ocker, Baß |
Gerhard Kastner, Regal |
|
|
| Paul
Hofhaimer |
a) Nach Willen
dein - aus Georg
Forsters "Frische teutche
Liedlein" 1. Teil, Nürnberg
1539-56 |
1' 20" |
A5 |
Theo Altmeyer,
Tenor | Alfred Lessing,
Diskant-Gambe | Gerhard Naumann,
Alt-Gambe | Horst Hedler,
Tenor-Gambe
|
|
|
|
Eugen
Müller-Dombois und Michael
Schäffer, Renaissance-Laute |
|
|
| Paul
Hofhaimer |
b) Nach Willen
dein - aus "Kotters
Tabulaturbuch" |
|
|
|
Johannes
Brenneke, an der histor. Orgel
der Jakobi-Kirche zu Lübeck
|
|
|
| Paul
Hofhaimer |
Meins Traurens
ist Ursach - aus
Georg Forsters
"Frische teutche
Liedlein" 1. Teil,
Nürnberg 1539-56
|
1' 41" |
A6 |
|
Der
RIAS-Kammerchor
| Helmut
schmitt,
alt-Posaune |
Harry Barteld,
Tenor-Posaune |
Kurt Federowitz,
Baß-Posaune |
Günther Arndt,
Leitung
|
|
|
| Ludwig
Senfl (um 1490-1543) |
Mag
ich Englück nit widerstahn - aus
Georg Forsters
"Frische teutche
Liedlein" 1. Teil,
Nürnberg 1539-56 |
1' 40" |
A7
|
| Der
RIAS-Kammerchor
| Fritjof Fest,
Diskant-Pommer |
Otto Steinkopf,
Alt-Pommer |
Heinrich
Göldner,
Tenor-Pommer |
|
|
|
Gerhard
Tuchtenhagen,
Baß-Pommer |
Günther Arndt,
Leitung |
|
|
| Heinrich
Isaac |
All mein Mut
- in DTÖ XVIII/2,
herausgegeben von A. Koczirz, Wien
1919 |
2' 15" |
A8 |
|
Theo
Altmeyer, Tenor | Alfred Lessing,
Alt-Gambe | Horst Hedler,
Tenor-Gambe
|
|
|
| Heinrich
Isaac |
Süßer Vater,
Herre Gott - in DTÖ XIV/1,
herausgegeben von A. Koczirz, Wien
1919 |
1' 10" |
A9 |
|
Johannes
Brenneke, an der
histor. Orgel der
Jakobi-Kirche zu
Lübeck
|
|
|
| Heinrich
Isaac |
Innsbruck, ich
muß dich lassen - (Fassung
I) 2. und 3. Vers - in DTÖ
XIV/1, herausgegeben von
A. Koczirz, Wien 1919
|
1' 25" |
A10 |
|
Theo Altmeyer,
Tenor | Claus Ocker, Baß | Otto
Steinkopf, Nicolo | Alfred
Lessing, Diskant-Gambe | Horst
Hedler, Tenor-Gambe
|
|
|
| Ludwig
Senfl |
Pacientiam
muß ich han - aus
Georg Forsters
"Frische teutche
Liedlein" 1. Teil,
Nürnberg 1539-56 |
1' 00" |
A11
|
|
Fritjof Fest,
Diskant-Pommer | Helmut Schmitt,
Alt-Pommer | Otto Steinkopf,
Tenor-Pommer | Kurt Federowitz,
Baß-Pommer |
|
|
| Heinrich Isaac |
Motette
"Illumina oculos meos" - in
A. W. Ambros "Geschichte der
Musik" V, Leipzig 1882 |
7' 46" |
A12 |
|
Die Männerchor
des RIAS-Kammerchors | Helmut
Schnitt, Alt-Posaune | Harry
Barteld, Tenor-Posaune | Kurt
Federowitz, Baß-Posaune |
|
|
| Heinrich Isaac |
Innsbruck, ich
muß dich lassen - in DTÖ
XIV/1, herausgegeben von
Johannes Wolf, Wien 1919
|
1' 22" |
B1 |
|
Eugen
Müller-Dombois, Renaissance-Laute
|
|
|
Josquin Despres
(um 1450-1521)
|
Adieu
mes amours - in "Codex
membranaico, O. V. 208. S. 106 der
Casanatenensis in Rom"
|
1' 48" |
B2 |
|
Theo
Altmeyer, Tenor | Claus
Ocker, Baß | Alfres
Lessing, Diskant-Gambe |
Gerhard Naumann,
Alt-Gambe
|
|
|
| Josquin Despres |
Plus
nulz regretz - in
"Werken van Josquin de
Près", Wewldlijke Werken,
Deel 1; herausgegeben von
A. Smijers, Amsterdam 1925
|
2' 39" |
B3 |
|
Jeanne
Deroubaix, Mezzosopran |
alfred Lessing,
Alt-Gambe | Heinrich
Göldner, Tenor-Dulcian |
Horst Hedler,
Tenor-Gambe
|
|
|
| Leonhard Kleber
(um 1490-1556) |
Preambulum
in Sol b-moll - aus
"Klebers Tabulaturbuch",
vgl. G. Adler "Das
Handbuch der
Musikgeschichte", Berlin
1930 |
2' 25" |
B4 |
|
Johannes
Brenneke, an der
histor. Orgel der
Jakobi-Kirche zu
Lübeck |
|
|
| Josquin Despres |
J'ai
bien cause (a
cappella) - in "Werken van
Josquin de Près",
Wewldlijke Werken, Deel 1;
herausgegeben von A.
Smijers, Amsterdam 1925 |
3' 20" |
B5 |
|
Der
RIAS-Kammerchor |
Günther Arndt, Leitung
|
|
|
| Heinrich
Isaac |
Questo
mostrarsi adirata di fore -
in DTÖ
XIV/1, herausgegeben von
Johannes Wolf, Wien 1919
|
1' 21" |
B6
|
|
Maria
Friesenhausen, Sopran |
Eugen Müller-Dombois und
Michael Schäffer,
Renaissance-Laute
|
|
|
| Hans Judenkünig
(um 1450-1526) |
Rossina ain
welscher Dantz - Ain
niederlandisch runden Dantz
- in DTÖ
XVIII/2, herausgegeben von
A. Koczirz, Wien 1919
|
2' 28" |
B7 |
|
Eugen
Müller-Dombois,
Renaissance-Laute |
|
|
| Wolfgang
Grefinger (geb. um 1480) |
Wohl kömmt der
Mai (a cappella) - aus
Georg Forsters
"Frische teutche
Liedlein" 1. Teil,
Nürnberg 1539-56 |
1' 20" |
B8 |
|
Der
RIAS-Kammerchor |
Günther Arndt, Leitung |
|
|
| Ludwig
Senfl |
Mag ich,
Herzlieb, erwerben ich (a
cappella) - aus
Georg Forsters
"Frische teutche
Liedlein" 1. Teil,
Nürnberg 1539-56 |
1' 00" |
B9 |
|
Der
RIAS-Kammerchor |
Günther Arndt, Leitung |
|
|
| Heinrich
Isaac |
Sempre giro
piangendo - in DTÖ
XIV/1, herausgegeben von
Johannes Wolf, Wien 1919
|
1' 38" |
B10 |
| Friedrich
Schmidtmann,
Sopran-Blockflöte |
Eugen Müller-Dombois und
Michael Schäffer,
Renaissance-Laute |
|
|
| Heinrich Finck
(1445-1527) |
O schönes Weib
- aus
"Schöne und auserlesene
Lieder des hoch berümpten
Heinrici Finckens",
Nürnberg 1536
|
1' 50" |
B11 |
Fritz
Wunderlich, Tenor |
Gerhard Tucholski,
Renaissance-Laute |
Gerhard Kastner,
Tenor-Blockflöte |
Gerhard Naumann,
alte-Gambe | Otto
Steinkopf, Baß-Dulcian
|
|
|
| Johannes Kotter
(um 1485-1541) |
Proömium in re
- aus
"Kotters Tabulaturbuch"
|
0' 50" |
B12 |
|
Johannes
Brenneke, an der
histor. Orgel der
Jakobi-Kirche zu
Lübeck |
|
|
| Ludwig
Senfl |
Mein Fleiß und
Müh - aus
Georg Forsters
"Frische teutche
Liedlein" 1. Teil,
Nürnberg 1539-56 |
1' 37" |
B13 |
|
Maria
Friesenhausen,
Sopran | Theo
Altmeyer und
Dietrich Lorenz,
Tenor | Claus
Ocker, Baß |
Gerhard Kastner,
Regal
|
|
|
| Paul
Hofhaimer |
In Gottes Namen
fahren wie - vgl.
H. J. Moser "Paul
Hofhaimer, ein
Lied- und
Orgelmeister des
deutschen
Humanismus", 1929 |
1' 49" |
B14 |
|
Fritjof
Fest,
Sopran-Krummhorn
| Otto
Steinkopf,
Nicolo |
Heinrich
Göldner,
Tenor-Pommer |
Gerhard Kastner,
Baß-Krummhorn
|
|
|
| Heinrich
Isaac |
Innsbruck, ich
muß dich lassen - (Fassung II)
a cappella in DTÖ XIV/1,
herausgegeben von Johannes Wolf,
Wien 1919 |
1' 10" |
B15 |
|
Der
RIAS-Kammerchor | Günther Arndt,
Leitung
|
|
|
|
|
|
Interpreters (see
above).
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
- |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Fritz
Ganss / Gerd Berg / Christfried
Bickenbach / Horst Lindner |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- C 91 107 - (1 LP) - durata 52'
41" - (p) 1962 - Analogico |
|
|
Altre edizioni
LP
|
|
EMI
Electrola - 1 C 037-46 523 - (1
LP) - durata 52' 41" - (p) 1962 -
Analogico |
|
|
Edizioni CD |
|
- |
|
|
Cover |
|
Ansicht
von Innsbruck (um 1495) von
Albrecht Dürer
|
|
|
|
|
Kaiser
Maximilians Residenz
am Inn
Keine Gestalt in der
wechselvollen Reihe der
Kaiser des Heiligen
Römischen Reiches
Deutscher Nation ist so
umstritten wie die des
ersten Maximilian. Er
trug ein wundertliches
Erbe. Sein Vater, Kaiser
Friedrich III., war der
erfolgloseste Träger
dieser Krone gewesen,
ein Mann jedoch, der
sich mit fanatischem
Glauben an die magischen
Buchstaben AEIOU - Alles
Erdreich ist Österreich
untertan - klammerte und
als erster von einem
neuen Großreich, dem
habsburgischen, träumte,
nachdem das heilige
römische wegen der
Fürsten Egoismus und
Selbstsucht nicht mehr
zu retten war. Die
Mutter Eleonore, eine
portugiesische
Königstochter, schwärmte
von einem anderen Ideal,
dem König Artus, einem
Màrchenprinzen und
ritterlichen Helden. Der
polnische Fürst, der ihm
den Namen Maximilian
gab, erhoffte den Retter
vor dem Ansturm des
Halbmonds im Osten. Und
Maximilian war von
alledem etwas. Adelige
und höfische Sitten,
Turnier und
Mummerıschanz
kennzeichnen den
„letzten Ritter".
Sie waren aber nur
Mittel zum Ziele, das
jenseits aller höfischen
Töndeleí den andern
Maximilian deutlich
werden läßt, den Mann,
der für alle neuen Ideen
seiner stürmischen Zeit
aufgeschlossen war und
nicht selten sich zu
ihrem Schrittmacher
erhob. Alles, was die
Grenzen
landschaftlicher,
mittelalterlicher Enge
sprengen wollte,
unterstützte Maximilian;
sein Ziel war das
habsburgische Imperium,
ein Weltreich, das über
die alten Grenzen hinweg
zu einer neuen Einheit
führen sollte. Vieles
und Unmögliches hat
Maximilian versucht;
seine Kräfte schienen
sich zu zersplittern.
Aber hinter aller
Planlosigkeit stand doch
jenes habsburgische
Imperium, das, durch
Heirat und
Feldschlachten
vorangetrieben, bei
seinem Tode Gestalt
angenommen hatte. Wenn
je eine Prophezeiung in
Erfüllung ging, dann war
es jene, die die
Astrologen bei der
Geburt Maximilians
verkündet hatten: „Ein
reiches, ein freudiges
und hochgemutes Leben,
viel Kampf und Mühen,
hohe Pläne und
leichtfertlges Hoffen,
viel Enttäuschungen,
aber auch ein volles Maß
bleibender Erfolge."
Maximilians unstetes
Wanderleben durch ein
neues, im Werden
begriffenes Reich kannte
nur zwei Plätze, die
Heimat und Halt
bedeuteten: Augsburg und
Innsbruck. Das goldene
Augsburg war die Bühne,
die dem Kaiser bei den
Reichstagen und
Empfängen die große Welt
erschloß; nadı Augsburg
kam er immer, wenn er
der Welt einen Triumph
vermelden konnte - oder
wenn er von Jakob Fugger
Geld brauchte. Doch
Innsbruch war die
Residenz nach seinem
Herzen. Sie suchte er,
wenn eine Aktion
verloren oder das
Söldnerheer ihm
entlaufen war. Augsburg
war eine freie
Reichsstadt, Innsbruck
eine Stadt in seinen
Erblanden. In ihr konnte
er bestimmen; sie bot
ihm und seinem Hofstaat
Heimatrecht und
Sicherheit inmitten der
Felsenburg Tirol. Wohl
führte auch ihn das
Wanderleben, das fast
allen Kaisern des
Mittelalters wegen des
Fehlens eíner
Reichshauptstadt
aufgezwungen war, von
Stadt zu Stadt; aber in
Innsbruck konnte er
seine künstlerischen und
geistigen Ideen
Wirklichkeit werden
lassen.
Maıximilian war von der
mittelalterlichen
Kaiseridee durchdruıngen
und wollte, daß die
Krone für immer mit dem
Hause Habsburg-
verbunden bliebe. Um dem
Kaisertum neues Ansehen
zu verleihen, umgab er
sich mit einer
glanzvollen Hofhaltung,
in der Gelehrte und
Künstler den Ton
bestimmten. Den Glanz
einstiger
Kaiserherrlichkeit
wiederzuerwecken,
richtete er seinen Blick
ebenso in die
Vergangenheit wie in die
Zukunft. So ist er nur
mit einem Teil seines
Wesens der „letzte
Ritter", der zur
Erhöhung der Glorie
seiner Familie und
seines eigenen Namens
die Geschichtsschreibung
fördert. Nicht weniger
ist er ein homo novus,
der dem Humanismus und
der Renaissance
angehört. Die Humanisten
erforschen die römische
Geschichte und verankern
die Legitimität des
Kaisertums weit zurück
bis zu jenem ersten
Imperator Augustus. Die
Antike verkörpern der
Humanistenkreis, den
Maximilian um sich
sammelt mit Konrad
Peutinger und Willibald
Pirkheimer, sowie die
Wiener Universität mit
Conrad Celtis und den
Tirolern Johannes
Fuchsmagen und Peter
Tritonius.
Am Innsbrucker Hof stand
die mittelalterliche
idee des „letzten
Ritters" im Vordergrund.
Der Tiroler Marx
Treitzsaurwein schrieb
als kaiserlicher
Sekretär das Turnierbuch
des Freydal, das
Versepos der Brautfahrt
Maximilians, den
„Teuerdank", und die bis
zum Vater Friedrich III.
zurückreichende
Selbstbiographie des
Kaisers, den
„Weißkunig". In
Innsbruck entstand das
Ambraser Heldenbuch, die
kostbare Aufzeichnung
der mittelhochdeutschen
und germanischen
Heldensagen, die die
einzige Abschrift des
Gudrunliedes bewahrt. Im
nahen Hall baute der
kaiserliche Protonotar
Florian Waldauf von
Waldenstein in echt
mittelalterlicher
Tradition seine große
Heiltumschau auf, eine
der größten
Reliquiensammlungen
seiner Zeit.
Innsbruck als
kaiserliche Residenz war
aber nicht so sehr von
der Wissenschaft als von
der Kunst bestimmt. Nur
hier gab es eine
kaiserliche Hofkunst,
einen maximilianischen
Stil. In dem Hofmaler
Jörg Kölderer fand
Maximilian den Künstler,
der im knorrigen, der
reichen spätgatischen
Tradition Tirols
entwachsenen Stil die
Prachtbücher
illustrierte und die
politischen Absichten
seines Herrschers in das
künstlerische Gewand
kleidete. Kölderer malte
die Zeugbücher, das
Jagd- und Fischereibuch
und entwarf den
farbenprächtigen
Aufmarsch des
kaiserlichen Hofstaates
im „Triumphzug".
In Innsbruck steht das
Goldene Dachl, das
einzigartige
Hochzeitsdenkmal des
Kaisers, geschaffen im
Jahre 1500 zur
Erinnerung an die
Eheschließung (1494) mit
der Mailänder
Herzogstochter Maria
Bianca Sforza. Es ist
der Abschiedsgruß des
Kaisers an das
Mittelalter. Der
Hofsteinmetz Nikolaus
Türing rneißelte in den
bildsamen Sandstein - in
den verrenkten und
verschlungenen Gestalten
der Maruschkatänzer -
eine Huldigung der
letzten Gotik an den
Kaiser; der Hofmaker
Kölderer ließ in dem
Narrenaufzug das
verspielte,
mittelalterlich höfische
und in den
bannertragenden
Landsknechten das neue,
gewalttätige Zeitalter
anlclirıgen. Die
vergoldeten
Kupferplatten des Daches
künden noch heute vom
Glanz der kaiserlichen
Majestät. Verschollen
sind die prunkvollen,
perlenbestickten
Goldornate und der
Kaisermantel, den der
Hofseidensticker
Leonhard Straßburger
genäht hatte, sowie die
Pokale und Scmucketten
des Innsbrucker
Hofgoldschmiedes Michael
Zeißl.
Maximilian sah in der
Kunst die Möglichkeit,
durch künstlerisch
geformte
Gebrauchsgegenstände das
Leben genußvoll zu
verschönen, diese aber
auch zu Kündern
kaiserlicher Macht zu
erheben. Sogar die
Waffen des Krieges und
des kriegerischen
Turniersports erhielten
edelste künstlerische
Gestaltung und warben
für den Kaiser. Die
Harnische, die in der
Innsbrucker
Hofplattnerel geschlagen
wurden, dienten als
diplomatische Geschenke
an Fürsten und Gesandte.
Der Hofplattner Konrad
Seusanhofer schuf,
unterstützt von
Vergoldern und
Ätzmalern, jene Riefel-
und Faltenrockharnische,
die modísch und
künstlerisch zugleich
waren und das Ansehen
des Kaisers in aller
Welt verkündeten. Die
Geschütze der
kaiserlichen Artillerie,
die die Innsbrucker
Meister Jörg Endorfer
und Peter Löffler
gossen, waren unerreicht
als moderne
Kriegswaffen, und
darüber hinaus vertraten
sie im künstlerischen
Schmuck ihrer Wappen und
Embleme den
Machtanspruch
Maximilians. Das Kaisers
Forderung an Techniker
und Künstler galt immer
der Verbindung von
Zweckmäßigkeit, Werbung
für seine Politik und
künstlerischer
Schönheit.
Den Höhepunkt und die
Zusammenfassung der
kulturellen Tätigkeit
Maximilians bildet sein
großangelegtes Grabmal
in der Innsbrucker
Hofkirche. Alle Ideen
sind in dieser
„Begräbnus" vereinigt:
das Totengeleite, wie es
an den Königsgräbern der
Gotik in Frankreich und
Burgund vorgebildet lag;
die Legalität der von
den antiken Herrschern
abgeleiteten römischen
Kaiserwürde; die in den
Hausheiligen der
Habsburger
repräsentierte
kirchliche
Sonderstellung der
Familie; der von den
ritterlichen
christlichen Königen der
germanischen Frühzeit
(Theoderich, Chlodwig,
Artus und Karl dem
Großen) stammende,
religiöse Mythos der
herrscherlichen Würde
als Beschützer der
Christenheit;
schließlich der in den
eigenen Vorfahren und
der angeheirateten
Verwandtschaft
begründete Vorrang des
Hauses Habsburg vor
anderen Königen als dem
einzigen würdigen Träger
der Kaiserkrone. So
enthält das Grabmal in
seiner künstlerischen
Hülle die geheimen
Wünsche, die erreichten
Ziele und das politische
Vermächtnis Kaiser
Maximilians. Die
Ausführung dieses
größten abendländischen
Kalsergrabes in
kostbarer Bronze zog
sich über ein halbes
Jahrhundert hin.
Maximilian hat es 1502
begonnen; die Vollendung
erlebte er nicht, aber
sie geschah nach seinem
Programm. 28
überlebensgroße
Ahnenstatuen, 23
Sippenheilige und 20
Büsten römischer Kaiser
sind das imposanteste
Gelelt, das je ein
Kaisergrab schmückte.
Die Künstler des Kaisers
in Innsbruck - Gilg
Sesselschreiber, Stefan
Godi, Leonhard Magt,
Gregor Löffler - und
berühmte Meister von
auswärts - Albrecht
Dürer, Peter Vischer,
Christof Amberger, Hans
Leinberger - schefen ein
Werk von europäischem
Rang: ein Vermächtnis,
das neben den
literarischen
Unternehmungen und dem
musikalischen Opus
seiner berühmten
Hofkapelle den Begriff
der maximilanischen
Kunst umschließt.
Als der tpdkranke Kaiser
Maximilian im Herbst
1518 seinem Sterbelager
Weis entgegenzog, führte
ihn sein letzter Weg in
das geliebte Innsbruck.
Als er durch die
Stadttore hinaus nach
Osten weiterfuhr, klang
ihm wphl die wehmütige
Weise des alten Liedes
nach, das sein
Hofmusiker Heinrich
Isaac bearbeitet hatte:
„Innsbruck, Ich muß dich
lassen..."
ERICH
EGG
Der letzte Ritter -
Mäzen der frühen
deutschen
Renaissance-Musik
Maximilian - als Erbe
seines Vaters Kaiser
Friedrichs III. und
seines Schwiegervaters
Herzog Karls des Kühnen
von Burgund erst
Deutscher König, dann
Römischer Kaiser
Deutscher Nation - ist
nur ganz vorübergehend
zu Wien ansässig
gewesen; seine besten
Tage hat er in Innsbruck
verbracht, wo er als
junger „Weißkunig"
geschwärmt, bis er dann
1490 von seinem
verrotteten Oheim
Erzherzog Sigismund dem
Münzreichen das
Grafentum von Tirol
übernahm. (Seit etwa der
Jahrhundertwende wurde
er zu Augsburg in dem
Grade heimisch, daß die
Franzosen ihn als
„Bürgermeister von
Augsburg" belächelten.)
Wie er die Stadt am Inn
geliebt hat, wo er
vielleicht heimliche
Lust erster Leidenschaft
erfahren, spiegelt sich
in dem Volksglauben,
wonach das
Handwerksburschenlied
„Innsbruck, ich muß dich
lassen" der junge
habsburgische Erzherzog
selbst gedichtet und
melodiert habe, bevor er
als Freier der edien
Maria von Burgund gen
Gent und Brügge ritt.
Mag sein, daß die schöne
Weise, die heute noch
als „O Welt, ich muß
dich lassen" oder zu
„Nun ruhen alle Wälder"
im Volksmund lebt, audı
aus seinem Herzen
gesungen war; sehr
wahrscheinlich sogar, da
sie im älteren Satz
(Tenarkanon) als Christe
eleison jener Missa
carminum oder
Quodlibetmesse erstmals
auftaucht, die sein
Hotkomponíst Heinrich
Isaac zur
niederländisch-spanischen
Hochzeit (Antwerpen
1496) zwischen
Maximilians Tochter
Margarethe und dem
iberíschen Thronerben
Don Juan geschrieben zu
haben scheint (sie
beginnt mit dem Liedkopf
„Es wurb einmal eins
Königs Sohn wohl um ein
Keyserínne"). Isaac -
ein Niederländer, der
schon in den seligen
Brauttagen zwischen Max
und Maria den Vertrauten
gespielt - hat außer
diesem noch einen
zweiten, in seiner
schwebenden Schönheit
und Durchsichtigkeit
weit berühmter
gewordenen Ouartettsatz
zum "Innsbruck" Lied
geschrieben: hier
erstrahlt die Weise im
Diskant, und das weit
ausschwingende
Schlußmelisma „wo ich im
E-lend bin" wird von
„weinenden”
(thronodischen)
Quartparallelen
affekthaft begleitet und
ausgezeichnet. Heinrich
Rietsch, dann Th. Kroyer
haben treffend den
renaissancehaft-humanistischen
Zug dieser späteren,
etwa auf 1510
anzusetzenden
Komposition gegenüber
dem
unkörperlich-letztgotischen
Konstruktivismus der
tenoralen Erstfassung
betont - eine
Zeitstílscheide erster
Ordnung! Adam von Fulda,
der entschieden
spätgotisch gesonnene
Hofkapellmeister
Friedrldıs des Weisen in
Torgau, hat zwar über
solche Sopransätze
gegrämeit, die könne
Jeder Dilettant
schreiben - aber es war
der neue
Jugenddurchbruch von
Italien her, dem sich
auch Isaac mit Glück
unterwarf, die
Beseeltheit von Josquins
Ausdruckskunst, die uns
als „Musica reservata"
noch beschäftigen wird.
Der herrlich klare
Sopransatz, den unsere
Platte neben dem andern,
so kunstreich
gebosselten mit seinem
Mittelstimmen-Doppelcantus
fírmus bringt, schwingt
- bis auf die kurze
Strecke „in fremde Land
dahin", wo das
quadratische Mauerwerk
der gleichschreitenden
Urbauweise durchlugt -
im 3/2-Takt; das moderne
evangelische
Kirchengesangbuch bietet
die Melodie halb
ausgeplättet im
6/4-Metrum des
Eislebener Cantuals von
1598 und (zu P.
Gerhardts Abendlied) im
neuzeitlichen 4/4-Maß,
in dem wieder das
älteste Schema
hervortritt.
Als echter fürstlicher
Mäzen hat Maximilian an
Heinrich Isaac
gehandelt. Dieser große
Musiker - der großartige
Messen schrieb und für
das Konstanzer
Domkapitel jenen
Proprienjahrgang
„Choralis Constantinus"
verfaßte, der sich neben
Maximilians Triumphzug
von Hans Burgkmair oder
Dürers Gesangbuch für
den Kaiser stellt - war
mit einer Florentinerin
(von seiner
Organistenzelt am Arno
her) vermählt, weshalb
ihn z. B. Macchiavell in
Konstanz besuchte, um
ihm namens der
toskanischen Republik
über die Italienpläne
des Herrschers
auszuholen. Als der
Hofkomponist, alt und
krank geworden, vom
Kaiser endgültigen
Urlaub erbat - der ihn
als seinen
Geschäftsträger längst
wieder zu den Medícis
entsandt hatte -,
wollten die Tiroler Räte
die Bezüge des Musikers
streichen - der letzte
Ritter aber verbot dies,
„wann er uns dort nützer
dann hier". Isaac war
derweil in seinem Hofamt
längst de facto durch
seinen Meisterschüler
Ludwig Senfl abgelöst
worden und starb 1517 in
Italien.
Als Max die Residenz
Innsbruck übernahm (man
sehe Dürers Aquarell),
traf er einen hier
bereits zehn Jahre lang
tätigen Künstler an, von
dem Paracelsus, der
große Arzt, gesagt hat:
was der Dürer „auf der
Malerei, das sei dieser
auf der Orgel": Paul
Hofhaimer aus Radstadt
in den Salzburger Tauern
- den größten
Tastenkünstler seines
Jahrhunderts, aber auch
einen der lieblichsten
Setzer deutscher Lieder,
unerschöpflich im
Fantasieren,
unübertroffen im
Wohlklang seiner
Harmonik, überdies ein
Lehrer, zu dem sich alle
deutschen und sogar
führende venezianische
Talente drängten. Der
Kaiser ließ ihm in
Innsbruck ein Haus und
mehrere wunderbare
Orgelwerke nach
Hofhaimers Plänen bauen;
er sicherte ihm Renten
und Zölle zu (von denen
er dann freilich infolge
ewiger Geldnot und
politischer Unrastigkeit
manches schuldig bleiben
mußte, so daß sein
Oberorganist schließlich
zu den Fuggers nach
Augsburg, zu Friedrich
dem Weisen, schließlich
zu Maximilians
Günstlirıg,
Fürsterzbischof Matthäus
Lang, nach Salzburg zu
gehen gezwungen war).
Isaac, Hofhaimer und
Ludwig Senfl, im Alter
jeweils durch eine
Halbgeneration von 15
Jahren getrennt, waren
vertraute Freunde und
bildeten eine
vorbildliche
Künstlergemeinschaft:
Vokalsätze Isaacs
überzog Hofhaimer mit
dem Filigrangespinst
seines „organistisch
reißwercks“, und von
Senfl ist kürzlich in
Kärnten ein Orgelstück
hervorgetreten, das ihn
als unverkennbaren
„Paulomimen“ (so nannte
man damals bewundernd
die Hofhaimer-Schüler)
kundtut; auch haben
Hofhaimer und Senfl zu
Passau eine gemeinsame
Doppelhochzeit gefeiert,
und es gibt Briefe
Beider voll rührender
gegenseitiger
Anteilnahme. Isaac
bevorzugte derbe
Volkslieder, die er bei
der Kürze ihrer Strophen
gern mehrmals
hintereinander in einem
Satz abschnurren ließ.
Ein drolliges
Wettbewerbsunternehmen
bildet etwa das Tiroler
Spottlied „Greiner,
Zanner, Schnöpfltzer, wie
gefällt dir das“, das
Hofhaimer als Terzett
vom Baß über den Tenor
in den Diskant, metrisch
immer gedrängter,
aufsteigen läßt, das
Isaac meisterlich
normal, schließlich aber
der alte gewaltige
Heinrich Finck aus
Bamberg übermütig als
instrumentalen
Quintettsatz wirbeln
läßt.
Wenn derlei auf unserer
Platte beiseite bleibt,
so eben wegen der
„Residenz“ - das war
Musikantenspaß, während
in der habsburgischen
„Kammer“ einer edieren
Kunst gehuldigt wurde:
dem
Hofweisen-Repertoire.
Gegenüber der
Dinghaftigkeit von
„Bauer, Maidlein, Ring
und Schwert, Wald und
Vögelein“ ist es durch
die Neigung zu
abstrakten Begriffen
gekennzeichnet; man gehe
nur die Liedanfänge
unseres Programms durch,
so trifft man auf Freud,
Zucht, Ehr, Lob, Willen,
Trauren, Ursach,
Unglück, Mut, Geduld
(Pecientia), regret,
cause, Fleiß und Müh -
lauter Worte, die sich
leicht ins
Humanistenlatein
übersetzen ließen und
Renaissancedenken
spiegeln; freilich
begegnen einem auch
Übergangserscheinungen
wie „Mißgunst hat einen
breiten Fuß" . . . Aber
diese Hofweisen (wie sie
Rochus vcın Liliencron
nach dem weit älteren
Ausdruck modus curialis
getauft hat) sind nicht
nur dichterisch als
Begegnung des
abgesunkenen Minnesangs
mit dem jungen
Renaissanceerlebnis
gekennzeichnet (man
könnte auch aus der
Vorliebe für Stellworte
u. dgl. ihren
Ursprung am Schreibtisch
erweisen), sondern auch
musikalisch: durch die
außerordentlich
feinsinnige und
weiträumige
Melodieplanung, die
solche linearen
Tongebilde vielfach
kirchentonartlich reich
disponiert, nach
Spitzentönen, nach
verschieden großen
Ausdrudcsmelismen, nach
rhythmisch
gegensätzlichen Finessen
abgestuft zeigt. Es sind
- wie die von Kaiser Max
bei Hofhaímer als dem
Zentralrepräsentanten
der Gattung offenbar
bestellten, an
fürstliche Bräute
gerichteten
Werbegedichte - edle, ja
raffinierte
Goldschmiedsarbeiten in
musicis, den goldenen
Salzfüssern eines
Cellini oder den
wunderbaren
Plattner-Rüstungen des
Innsbrucker Hofs in
Schloß Arnbras in etwa
zu vergleichen.
Das 19. Jahrhundert, das
sich erstmals dieser
Kunst wieder annahm, hat
sie sich nur als A
Cappella-Chörlein von
Madrigalvereinígungen
vorzustellen vermocht
und in seinen Neudrukken
durch willkürliche
Textierung aller Stimmen
mißverstanden und
umgefülscht. Gewiß, seit
1536 - in den
Nachlaßliedrn von Finck,
bei Schöffer und
Apiarius, in der ersten
Lieferung von Forsters
„Auszug“ - ist eine
solche nachträgliche
Vokalisierung - manchmal
nicht ohne etwas Gewalt
- unter dem Einfluß des
literaturbesessenen
Humanismus an Sätzen der
Altmeister durchgeführt
worden; jedoch die
meisten Hofweisen der
Zeit von Lochamers
Nürnberger Liederbuch um
1460 bis zu Maximilians
Tod (1519) sind
unzweifelhaft dem Tenor-
(bzw. Bariton-) Sololied
mit instrurnentalen
Begleitstimmen (von
Renaissance-Ausnahmen
wie „Innspruck" II
abgesehen) zugehörig;
was schon daraus
hervorgeht, daß alle die
zuständigen Drucke - wie
Öglin, Arnt von Aich,
Schöffer, die die Praxis
der Hofrnusiker des
Kaisers, des Bischofs
von Augsburg, des
Herzogs von Württemberg
nachbilden, später die
bürgerlichen Drucke von
Egenolf in Frankfurt,
dann die
Senfl-Fugger-Handschriften
- die Singtexte einzig
im Tenorheft bieten.
Man konnte solchen Satz
auch völlig
instrumentalisieren, für
Blöckflötenchor, für
eine Krummhörnergruppe
(falls die Einzelstimme
eine None nicht
überschritt), für
Poscıunen- oder
Zinkenensemble, und man
sieht noch an einem der
Musikantenwagen des
„Triumphzugs", wie
offenbar ein
Ouintettsatz mit
Deppelkernweise besetzt
wurde: der kantable rote
Faden durch zwei Gumben,
die drei
Kontrapunktlinien aber
sichtlich durch drei
Zupfinstrumente. Auch
Intavolierungen für die
Laute (so von
Judenkünig, Gerle,
Neusiedler) oder für
Tasteninstrumente (von
Schlick oder den
Paulomimen Hans Buchner,
Kotter, Kleber, W.
Grefínger, Sicher etc.)
begegnen, natürlich
reichlich mit den
superinventiones
(Zusatzerfindungen)
instrumenteneigner
Ornamentik ausziseliert,
wobei dann eine Stimme,
etwa der letzterfundene
Altus-Vagans,
eingespart, aber im
Orgelfall auch noch eine
fünfte hinzuerfunden
werden konnte. Im ganzen
gilt, daß die Sätze vor
1500 drei Stimmen, nach
1500 ihrer vier, seit
1530 gern 5-6 zählen.
Wenn in der zweiten
Hälfte unseres Programms
mehrere Chansonsätze von
Josquin Despres
erscheinen, so ist
dieser zwar anscheinend
nicht, wie sein
Kunstrivale Jakob
Obrecht, des Kaisers
persönlicher Gast in der
Innsbrucker Hofburg
gewesen; er hat aber -
wie die gesamte Epoche,
so auch - die Tonmeister
zu Innsbruck (Senfl
voran) mit seiner Kunst
vom Raffaelschen Rom
oder vom
wallonisch-flämischen
Condé her - seinem
Geburts- und Sterbeort -
stark angestrahlt. Wie
stark, das lehrt auch
eines der schönsten
Hofhaimer-Stücke, die
Liebesklage „Meins
Traurens ist Ursach",
die ihren phrygisch
nothaften Themenbeginn
(genau wie die
Wittembergische
Luthermelodie „Aus
tiefer Not") einem
Josquinschen Themenkopf
verdankt oder frei
nachgebildet hat. Luther
sprach nur die
Bewunderung des ganzen
Zeitalters aus, wenn er
rühmte: „Josquin ist der
Noten Meister, die
haben's machen müssen
wie Er gewollt - die
andern Sangmeister
machen meist nur, wie's
die Noten wollen“.
Josquins Musica
reservata bedeutet
„Musik nur für Kenner";
damit meinte er:
durchseelte,
vermenschlichte
Ausdruckstonkunst. Sie
war das Kernprodukt der
Renaissance als einer
„Wiedergeburt des (ideal
antiken) Menschen", und
es beleuchtet die mehr
letztgotische
Handwerklichkeit Isaacs
im Gegensatz zu Josquins
grandseigneuralem
Artismus des neuen 16.
Jahrhunderts, wenn ein
Zeitgenosse berichtet:
„Isaac kann immer
schaffen, Josquin
dagegen nur, wenn er
Laune hat." Die
Chansonkunst hatte
vorzugsweise am
Burgunderhof durch
Dufay, Binchois,
Ockeghem geblüht; wenn
Despres sie nach Rom
verpflanzte, so trug
auch das dazu bei, die
Weltführung aus den
Südniederlanden nach
Italien zu verlegen.
Dach wenn Kaiser
Maximilian jenen
vertonten
Liebesgedichten
lauschte, so waren sie
ihm Inbegriff
unwiederbringlich holder
Tage - jener kurzen
Glüclszeit, die ihm der
Name seiner
Einziggeliebten
umschloß, der Maria von
Burgund - die Erinnerung
an sie umschwebte ihn
auch in der Stadt des
„goldnen Dachls", obwohl
Maria Innsbruck nie
gesehen hatte.
HANS
JOACHIM MOSER
(Columbia C 91 107)
|
|