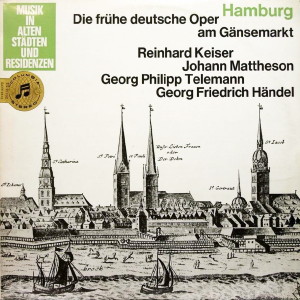 |
|
1 LP -
C 91 102 - (p) 1961
|
 |
| 1 LP - 1
C 037-45 570 - (p) 1961 |
|
| HAMBURG
- Die frühe deutsche Oper am Gänsemarkt |
|
|
|
|
|
| Reinhard Keiser
(1674-1739) |
|
|
| "Der hochmüthige,
gestürtzte und wieder erhabene
Croesus" - (1730) |
28' 12" |
A
|
| -
Ouvertüre (Sinfonia) |
|
|
| - Chor: "Croesus
herrsche" |
|
|
| -
Arie des Croesus: "Prangt die
allerschönste Blume" |
|
|
| -
Bauernszene - Ritornello |
|
|
| -
Bauernszene - Tanzlied: "Kleine
Vöglein, die ihr springet" |
|
|
| - Bauernszene -
Rezitativ: "Seht, wie Herr Elcius
ist ein Politicus" |
|
|
| - Bauernszene - Arie
mit Chor: "Mein Kätchen ist ein
Mädchen" |
|
|
| - Ballett von Bauren
und Baurenkindern" |
|
|
| - Duett Orsanes -
Eliates: "Ich sä' auf wilde Wellen" |
|
|
| - Arie der Elmira:
"Ihr stummen Fische" |
|
|
| - Szene des Croesus:
"Götter, übt Barmherzigkeit" |
|
|
Hermann Prey -
Croesus, Bariton | Lisa Otto -
Elmira, sopran | Manfred Schmidt
- Orsanes, Tenot | Theo Adam -
Eliates, Baß
|
|
|
| Karl-Ernst
Mercker - Elcius, Tenor | Ursula
Schirrmacher - Bauerkund, Sopran |
|
|
Eugen
Müller-Dombois, Laute | Heinz
Friedrich Hartig, Cembalo
|
|
|
Ein Kinderchor |
Die Berliner Philharmoniker |
Wilhelm Brückner-Rüggeberg,
Dirigent
|
|
|
| Johann Mattheson
(1681-1764) |
|
|
| "Boris
Goudenow" oder Der durch
Verschlagenheit erlangte Trohn
- Drama per Musica (1710) |
10' 14" |
B1
|
| - Szene mit Chor und
Irina: "Hochbeglückte Zeiten" |
|
|
| - Arie des Boris:
"Empor! Empor! soll mein steter
Wahispruch bleiben" |
|
|
| - Arie des Iwan:
"Vorrei scordarmi del Idol mio" |
|
|
| - Chor der alten
Männer und Kinder: "Schau Boris uns
in Gnaden an" |
|
|
Theo Adam -
Boris, Baß | Manfred Schmidt -
Iwan, Tenor | Marlies Siemeling
- Irina, Sopran
|
|
|
Eugen
Müller-Dombois, Laute | Heinz
Friedrich Hartig, Cembalo |
Irmgard und Fritz Helmis, Harfen
|
|
|
| Günther
Arndt-Chor | Die Berliner
Philharmoniker | Wilhelm
Brückner-Rüggeberg, Dirigent |
|
|
| Georg Philipp Telemann
(1681-1767) |
|
|
| "Pimpinone"
oder Die Ungleiche Heirat -
Ein lustiges Zwischenspiel |
5' 10" |
B2
|
| - Rezitativ und
Duett Vespetta - Pimpinone: "Was
aber denkt ihr nun zu tun? - Mein
Herz, erfreut sich in der Brust!" |
|
|
Herbert Brauer -
Pimpinone, Bariton | Shige Yano -
Vespetta, Sopran
|
|
|
| Eugen
Müller-Dombois, Laute | Heinz
Friedrich Hartig, Cembalo |
Eberhard Finke, Violoncello |
|
|
| Die Berliner
Philharmoniker | Wilhelm
Brückner-Rüggeberg, Dirigent |
|
|
| Georg Friedrich Händel
(1685-1759) |
|
|
"Der
in Kronen erlangte Glückswechsel"
oder Almira, Königin in Kastilien
- (1705)
|
5' 10" |
B3
|
-
Ballettmusik: Courante · Bourrèe ·
Menuet · Rigaudon · Rondeau ·
Chaconne · Saraband
|
|
|
| Eugen
Müller-Dombois,
Laute | Heinz
Friedrich Hartig,
Cembalo | Irmgard
und Fritz Helmis,
Harfen
|
|
|
| Die
Berliner
Philharmoniker |
Wilhelm
Brückner-Rüggeberg,
Dirigent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Interpreters (see
above).
|
|
|
|
|
|
Luogo
e data di registrazione |
|
- |
|
|
Registrazione:
live / studio |
|
studio |
|
|
Producer /
Engineer |
|
Fritz
Ganss / Gerd Berg / Christfried
Bickenbach / Horst Lindner |
|
|
Prima Edizione
LP |
|
Columbia
- C 91 102 - (1 LP) - durata 48'
46" - (p) 1961 - Analogico |
|
|
Altre edizioni
LP
|
|
EMI
Electrola - 1 C 037-45 570 - (1
LP) - durata 48' 46" - (p) 1961 -
Analogico |
|
|
Edizioni CD |
|
- |
|
|
Cover |
|
Hamburg
(2. Hälfte 18. Jahrhundert) -
Kupferstich von Hoemann.
Privatsammlung, Leverkusen
|
|
|
|
|
Die
frühe deutsche Oper am
Gänsemarkt zu Hamburg
Die Hamburger Oper am
Gänsemarkt war eine vom
Bürgertum getragene
Volksoper.
Kunstbeflissene Bürger
riefen in der Hansestadt
die erste selbständige
deutsche Oper ins Leben
- Jahrzehnte vor
Lessings Wirken in
Hamburg und seinem
Entwurf eines deutschen
Nationaltheaters,
Dank der klugen
Neutralitätspolitik
seiner Stadtväter hatte
sich Hamburg aus den
Wirren einer Deutschland
schwer heimsuchenden
Zeit herauszuhalten
vermocht. Selbst der
Dreißigjährige Krieg,
dessen Wogen bis an die
Mauern der Stadt
brandeten, gefährdete
das blühende
Wirtschaftsleben des
Stadtstaates nicht
ernshaft. Ein mächtiges,
wohlhabendes Bürgertum
wußte sich inmitten des
in kleine Feudalstaaten
zerrissenen Deutschland
eine Sonderexistenz zu
bewahrem. Nirgends boten
sich günstigere
Voraussetzungen für eine
betont bürgerliche
Kunstpflege. Kein
fürstlicher Souverän,
sondern der Kaufmann und
Ratsherr Gerhard Schott
war es, der hier im
Jahre 1678 ein
Opernunternehmen
gründete, dessen Ruhm
bald über Hamburgs
Grenzen strahlte.
Mit dem Paradiesspiel
"Adam und Eva oder der
erschaffene, gefallene
und wiederaufgerichtete
Mensch", zu dem der
Heinrich Schütz-Schüler
Johann Theile die Musik
beisteuerte, wurde das
Haus am Gänsemarkt
eröffnet. Um dem Argwohn
der Geistlichkeit
gegenüber der hier und
dort als heidnisch
verschrieenen
Kunstgattung zu
begegnen, bevorzugte man
in den ersten Jahren
biblische Stoffe - "Die
Geburt Christi",
"Esther" oder "Kain und
Abel". Bald jedoch
wurden diese Sujets
durch historische,
mythologische und
pastorale Libretti in
den Hintergrund
gedrängt. Eine für die
Hamburger Oper typische
Note wahrte man in der
Vorliebe für lokal
gebundene stoffe, für
farbige, satirische
Sittenbilder oder
fesselnde Begebenheiten
aus der Hamburger
Geschichte. Das
abenteuerliche Schicksal
der Seeräuber
Störtebecker und Joedge
Michaels gestaltete ein
Sänger der Hamburger
Oper namens Hotter in
einem von Reinhard
Keiser vertonter
Libretto. Typisch für
die Volkskunst in
Hamburg ist schließlich
auch die gegen 1700
aufgeführte Oper "Der
Hamburger Jahr-Markt".
Das vorwiegend von
materiellen Trieben
bestimmte Leben der
Bewohner des
"Kaiser-Hoffs" - einst
Hamnurgs größter Gasthof
- diente hier dem
Librettisten Johann
Philipp Praetorius als
Zielschelbe einer
treffenden Satire. In
den aus dem alltöglichen
Leben gegriffenen
Gestalten des
kapitalkräftigen,
einfältigen
"Gerne-Groß", des
gewissenlosen,
geldgierigen
Hausknechtes Lucas oder
der leichtlebigen
Wirtstochter Capricciosa
hielt der berühmte
Librettist de, Hamburger
Opernpublikum einen -
nichts beschönigenden -
Spiegel vor. An den
lebendig gezeichneten
Lokaltypen und dem oft
saftigen Realismus
mochten sich die
Hamburger Bürger
dessenungeachtet immer
wieder ergötzt haben.
In der Stoffwahl, aber
auch im Aufführungsstil
frönte man in der Oper
am Gänsemarkt dem
Geschmack eines
Publikums, das
verschiedenste soziale
Schichten erfaßte: der
nach sensationen
gierenden Schaulust.
Hinrichtungen auf
offener Szene, bei denen
Blut aus Schweinsblasen
über die Bühne floß,
waren freilich auch dem
Theater Shakespeares
nicht fremd.
Einespezifisch
volkstümliche Note
wahrte die Hamburger
Oper in der
detaillierten Ausmalung
solcher "Hauptund
Staatsaktionen" in
gleicher Weise wie in
der Vorliebe für
artistische Vlownerien,
recht derbe Possen und
zotige Späße. Als
beispielsweise im Kahre
1716 Johann David
Heinichens Opera seria
"Mario" in Hamburg über
die Bühne ging, fügte
man gänzlich unmotiviert
einen "Tanz alter Weiber
mit Branntweinflaschen"
ein. Eine regelrechte
Artistenszene findet
sich in Johann Philipp
Kriegers Oper "Pyramus
und Thisbe".
Die Hamburger Oper am
Gänsemarkt war in einer
Zeit nationaler
Überfremdung deutlich
national gerichtet.
Offen nahm sie für die
bürgerliche Kultur
Partei. Scharf geißelte
man das Hofleben, so in
der Oper "Thalestris"
das lächerliche Gebaren
eines "galant homme",
der kritiklos jede
französische Mode
nachäfft. Besonders die
organisch in die
Handlung eingefügte,
nirgendwo
schablonenhafte
"komische Person", die
in keiner Oper fehlen
durfte, diente
wiederholt als
Sprachrohr einer
nationalen, bürgerlichen
Gesinnung.
Die Hamburger Oper am
Gänsemarkt bewahrte sich
innerhalb der
frühdeutschen Oper in
mancher Hinsucht eine
Sonderstellung. Im
Gegensatz zu
Opernbetrieben an großen
Residenzen und an
Duodezfürstenhöfen wurde
in der Hansestadt
jahrzehntelang durchweg
in deutscher Sprache
gesungen. In einer
stadt, in der sich
damals sogar Predigten
und
Gerichtsverhandlungen
des niederdeutschen
Dialekts bedienten,
bekannte man sich auch
in der Oper zum
heimatlichen
sprachlichen Idiom.
anfangs freilich blieb
der Dialekt
ausschließlich der
"komischen Person"
vorbehalten. Bald jedoch
ging man dazu über, in
manche Opern gröére
Dialektszenen
einzufügen. Zusammen mit
den verbreiteten
Volksszenen - den
farbigen
Ausrufer-Szenen, den
Auftritten von Soldaten,
betrunkenen Bauern,
Handwerkern oder
Bergleuten - kamen diese
Dialektszenen dem
Geschmack des
vielschichtigen
Publikums entgegen. Daß
die Bergwerksszene in
Georg Philipp Telemanns
"Adelheid" einer
Venezianischen Oper
nachgebildet war,
unterstreicht deutlich,
welch enge Beziehungen
zwischen der Hamburger
Oper und der Oper in
Venedig bestanden. Ein
bezeichnendes Licht
fällt dabei auf die Oper
am Gänsemarkt: es war
eben die jedermann
zugängliche, oft
volkstümliche
Venezianische Oper, zu
der sich hier und
anderswo mancherlei
Fäden knüpfen.
Genau sechs Jahrzehnte
lang konnte sich die
Hamburger Oper, die
anfangs heftig von der
Geislichkeit befehdet
wirde, am Leben halten.
Geldmittel, die
finanzkräftige Bürger
der Stadt zur Verfügung
stellten, ermöglichten
eine Ausstattungspracht,
die sich durchaus mit
dem Aufwand an großen
Hofopern messen konnte.
Textdichter wie Lucas
von Bostel, Christian
Postel, Heinrich
elmenhorst, Christian
Hunold oder Bartholt
Feind sorgten für
Libretti, die ein
bemerkenswertes Niveau
aufwiesen. Besondere
Beachtung verdient
jedoch die Tatsache, daß
die junge Oper in
Hamburg einige
erstrangige Komponisten
in die Hansestadt zu
ziehen vermochte. Der
Schütz-Schüler Johann
Theile, der
Geigenvirtuose Nicolaus
Adam Strungk, der
treffliche Liedmeister
Johann Wolfgang Franck
und der in Hamburg auch
als Arzt praktizierende
Johann Philipp Förtsch
traten in den ersten
Jahren hervor. Mit
Johann Sigismund Kusser
kam dann ein glänzender
Organisator und
unermüdlicher
Orchesterzieher an die
Hamburger Bühne.
Unlösbar ist das
Schicksal der Oper am
Gänsemarkt mit der
Persönlichkeit Reinhard
Keisers verknüpft, des
aus Sachsen gebürtigen
"Klassiker der
frühdeutschen Oper".
Zwar stellten auch Georg
Philipp Telemann, der
vielseitige Mattheson
und der junge Händel ihr
Können in den Dienst der
Hamburger Oper. Reinhard
Keiser ist es in erster
Linie zu danken, daß die
Oper am Gänsemarkt für
längere Zeit hohes
Ansehen genoß. Den
Niedergang des
Operninstituts, dessen
Leitung ihm einige Jahre
anvertraut war, konnte
er freilich nicht
verhindern. Hellmuth
Christian Wolff, der
beste Kenner der
Geschichte der Hamburger
Oper, sieht in der neuen
rationalistischen
Geisteshaltung, die
alles Unnatürliche
konsequent ablehnte, die
wesentlichste Ursache
für diese Entwicklung;
ein Chronist des 18.
Jahrhunderts gibt dem
über handnehmenden
Geschäftsgeist der
Hamburger die Schuld.
Kurzum - im Jahre 1738
mußte die Oper am
Gänsemarkt ihre Pforten
schliessen. Zwölf Jahre
später wurde das Haus
auf Abbruch verkauft. In
Gastspielen dder
Mingottischen
Operngesellschaft, im
Reithaus nahe am
Stadtwall, dominierte
fortan auch in Hamburg
die italienische Oper.
Hans
Christoph Worbs
Komponisten der Oper
am Gänsemarkt
Das abenteuerliche Leben
des hochbegabten
Reinhard Keiser ist aufs
engste mit der
Geschichte der
frühdeutschen Oper
vrknüpft. 1674 zu
Teuchern bei Weißenfels
geboren, ging der
ehemalige Leipziger
Thomaner im Alter von 18
Jahren nach
Braunschweig, wo er
neben seinem Gönner
Johann Sigismund Kusser
seine ersten
Opernerfolge errang. Die
Hauptstätte seines
langjährigen Wirkens
wurde die Hamburger Oper
am Gänsemarkt. Keiser
war auch einige Jahre
dänischer
Hofkapellmeister und vor
seinem Tode im Jahre
1739 Kantor am Hamburger
Dom. Noch 1773 rühmte
Johann Adolf scheibe den
einst mit reichen ehren
Bedachten als das
"vielleicht größte
Originalgenie, das
Deutschland jemais
hervorgebracht" habe.
Johann Mattheson gilt
als eine der
fesselndsten
Musikerpersönlichkeiten
der damaligen Zeit. 1681
in Hamnurg geboren, 1764
daselbst gestorben,
machte sich der
selsteitle, geschäftige
Meister nicht nur als
Komponist, als Sänger
und Cembalist einen
geachteten Namen. Der
vielseitig gebildete
Musiker, der bereits mit
neuen Jahren juristische
Vorlesungen hörte, stand
als Legationsrat auch
jahrelang erfolgreich im
diplomatischen Dienst.
Uberragende Bedeutung
gewann vor allem der
Musikschriftsteller
Mattheson. Von seinen
zahlreichen
Publikationen seien sein
theoretisches Hauptwerk
"Der vollkommene
Capellmeister", die
erste deutsche
musikalische
Monatsschrift "Critica
musica" und die
"Grundlage einer
Enrenpforte", eine
bedeutsame Sammlung von
Musikerbiographien,
genannt.
Im Jahre 1681 in
Magdeburg geboren, bezog
Georg Philipp Telemann
wie Händel anfangs zum
Studium der Rechte die
Universität. Die
Berufung zur Musik
setzte sich jedoch
erfolgreich durch.
Leipzig, Sorau, Eisenach
und Frankfurt am Main
waren die Hauptstätten
seines Wirkens, bis er
im Jahre 1721, bereits
auf der Höhe seines
Ruhms, in Hamburg als
Musikdirektor der fünf
Hauptkirchen eine
Lebensstellung fand.
Telemann, im Jahre 1767
in Hamburg gestorben,
Zeitgenosse Johann
Sebastian Bachs,
vertritt weit mehr als
der Thomaskantor den Typ
des modernen, aus seiner
beruflichen Isolierung
herausstrebenden
Künstlers. Als Leiter
eines studentischen
Collegium musicum in
Leipzig, der Frankfurter
Konzerte im
Frauensteinschen Palais
am Römerberg oder der
ebenfalls bürgerlichen
Konzerte im Hamburger
Drilljaussaal drängte es
ihn jederzeit in die
breite Öffntlichkeit.
Mit 18 Jahren kam Georg
Friedrich Händel aus
seiner Geburtsstadt
Halle nach Hamburg.
Schnell stieg er hier
vom Orchestergeiger zum
Cembalisten und
geachteten Komponisten
auf. Von seinen vier
Opern, die damals über
die Bühne der Hamburger
Oper gingen, hat sich
allein die "Almira"
erhalten. Händel, dessen
späteres Opernschaffen
in Italien und England
ungemein fruchtbas war,
debütierte mit diesem
erfolgreichen Werk im
Jahre 1705 als
Opernkomponist.
H. C.
W.
Aus der Blütezeit der
Hamburger Oper
Unter Reinhard Keisers
für die Bühne am
Gänsmarkt komponierten
Opern genoß der
"Croesus" besondere
Popularität. Zwanzig
Jahre nach der ersten
Aufführung des Werkes,
vier Jahre, nachdem as
im Still der Hamburger
Lokalsingspiele köstlich
parodiert worden war,
legte Keiser im Jahre
1730 eine zweite Fassung
dieser Oper vor. Die von
Lucas von Bostel
bearbeitete Geschichte
des reichen, hochmütigen
Lydierkönigs, der sich,
vom Perserkönig Cyrus
besiegt, plötzlich der
Vegänglichkeit aller
irdischen Macht bewußt
wird, war in Hamburg
"jederzeit mit
ungemeinem beyfall
aufgeführet worden".
Lucas von Bostel hatte
sein Libretto an eine
italienische Oper
Niccolo Minatos
angelehnt.
Bezeichnenderweise
stehen bei ihm die
komischen Szenen weit
stärker im Vordergrund
des Geschehens als bei
Minato: auch im
"Croesus" wußte der
Hamburger Librettist dem
Geschmack seiner
Landsleute Rechnung zu
tragen.
In Trompetenglanz
getaucht sind die
"italienische" Ouverture
und der Einleitungschor
der Oper. Die Verwendung
des Zuffolo, einer
Oktavflöte, läßt Keisers
Streben nach klanglicher
Vielfalt erkennen. In
der
idyllisch-genrehaften
Bauernszene begegnet uns
ein für die Hamburger
Oper typisches
Volksbild. Gleichwohl
hat Hellmuth Christian
Wolff nachgewiesen, daß
gerade diese reizende
Szene fremden Vorlagen
verpflichtet ist.
Schalmei und Sackpfeife
(die Keiser im Orchester
durch Oboen, Fagotte,
Violoncelli und
Kontrabaß nachahmt)
hatte schon Minato in
seinem "Creso" als
instrumentale Begleitung
auf der Bühne
vorgeschrieben. Das
Duett "Kleine Vöglein"
erinnert in seiner
synkopischen Thythmik an
englische Volksmusik. Im
Gegensatz zu dem
leidenschaftlich
bewegten Duett "Ich sä'
auf wilde Wellen" ist
die von Geigen- und
Bratschenklängen
umwobene Arie der
fischenden Elmira in
stimmungsreiche Poesie
getaucht. Vielleicht war
hier eine Stelle in
Lullys "Armide" (1686)
Keisers Vorbild. Einen
Hähepunkt der Oper
gestaltete Keiser in dem
ergreifenden Klagegesang
des besiegten
Lydierkönigs. Croesus'
selbstsichere
Unberk+mmertheit
(musikalisch gespiegelt
in seiner Menuett-arie
"Prangt die
allerschönste Blume")
hat sich als eitler Trug
erwiesen. Unter Zulauf
einer schaulustigen
Menge wird der König nun
zum Scheiterhaufen
geführt. angesichts
seines Todes fleht er
noch einmal um
Barmherzigkeit. Für die
bemerkenswert frei
geformte Szene "Götter,
übt Barmherzigkeit" hat
sich Keiser (worauf
Heinz Becker in dem
Keiser-artikel der
Enzyklipädie "Musik in
Geschichte und
Gegenwart" hinweist) die
in der Oper einzig hier
verwandte Tonart es-dur
aufgespart.
In dem von ihm selbst
verfaßten Textbuch zu
dem dreiaktigen "Drama
per musica" "Boris
Goudenow" schildert
Mattheson, wie Boris
durch Verschlagenheit
auf den Zarenthorn
gelangt, wie seine
Rechnung, als
uneigennütziger Retter
des Vaterlandes gefeiert
zu werden, wunschgemäß
aufgeht. Freilich nur
zum Schein erklärt der
machthungrige Boris, mit
seiner Schwester Irina
sein Leben friedvoll im
Kloster zu beschließen.
Das Volk will den
Zarenthron nicht länger
verwaist sehen. Eine
"Menge alter
graubärtiger Männer in
schwartz gekleidet" und
ein "Haufe junger Kinder
in weiss" ziehen vor dem
Kloster auf. In einem
von kühner Harmonik
bestimmten Wechselgesang
wenden sie sich mit der
inbrünstigen Bitte an
Boris, das Land nicht
länger im Stich zu
lassen (Chor der alten
Männer und Kinder "Schau
Boris uns in Gnaden
an"), Nun sieht Boris
den Augenblick für
gekommen, das Szepter
anzunehmen. Mattheson
hat in seine 1710
komponierte, an
Chorszenen ungewöhnlich
reiche Oper auch eine
Anzahl italienischer
Arien eingelegt. Wie er
im Vorwort seiner Oper
schreibt, wollte er
hiermit der "Mode"
entgegenkommen.
Gleichzeitig jedoch gab
er auch zu verstehen,
daß "die Italienische
Sprache der Musique sehr
geneigt" sei.
Georg Philipp Telemanns
Intermezzo "Die
ungleiche Heyrath
zwischen Vespetta und
Pimpinone", die
Geschichte von einem
reichen Hagestolz und
dessen gewitztem
Kammermädchen, erinnert
in seinem Sujet an
Pergolesis acht Jahre
später entstandene "La
serva padrona". Auch die
treffende musikalische
Charakteristik, die
Vorliebe für
schlagkräftige, sich oft
wiederholende Motive
verbindet Telemanns
Intermezzo mit
Pergolesis genialem
kleinen Werk. - In dem
köstlichen Duett "Mein
Herz erfreut sich in der
Brust" greift Vespetta
immer wieder die
musikalischen Motive
auf, die vorher
Pimpinone übertragen
sind. Allem anschein
nach geht sie auf die
Wünsche des Hagestolzes
ein, zeigt dann aber in
a parte (beseite) Reden
ihr wahres Gesicht.
In dem jungen Georg
Friedrich Händel, der im
Jahre 1703 nach Hamburg
kam, erwuchs Reinhard
Keiser bald ein
beachtlicher
Nebenbuhler. Etwa
zwanzigmal ging 1705
seine erste Oper
"Almira" über die Bühne.
Freilich mochte zu
diesem großen Erfolg das
dem aufgeklärten
Bürgertum Hamburgs
durchaus zeitgemäß
erscheinende Libretto
Friedrich Christian
Feustkings beigetragen
haben, in dem die
verstohlene Liebe der
Königin Almira zu dem
ihr keineswegs
ebenbürtigen Fernando
Mittelpunkt der
Haundlung ist. Aus der
umfangreichen
Ballettmusik dieser Oper
verdient die Sarabande
besondere Beachtung.
Einige Jahre später hat
Händel die erste Periode
dieses Tanzes fast
unverändert in seinem
"Trionfo del Tempo" und
dem berühmten
Klagegesang "Lascia ch'
io pianga" der Oper
"Rinaldo" wieder
aufgegriffen.
H. C.
W.
Von der "schönen
Conradin" und andere
Gesangssternen am
Hamburger Gänsemarkt
"Ella canta come una
tedesca" (sie singt wie
eine Deutsche) hieß es
noch um 1765 beim Debüt
der nachmals gefeierten
Primadonna Friedrichs
ses Großen, Gertrud
Elisabeth Schmelling,
der "Mara". Dieser
bittere Ausspruch läßt
die deutsche
Gesangskunst jener Zeit
in einem so trüben
Lichte erscheinen, daß
man sich fragt, wie denn
überhaupt ein
Unternehmen gleich der
deutschen Oper am
Gänsemarkt volle sechzig
Jahre hindurch (1678 bis
1738) bestehen konnte.
Zunächst mag denn wohl
auch in Hamburg recht
norddeutsch-temperiert,
im schlichten
Kantorenstil Oper
gesungen worden sein.
Aus der reichen Praxis
der Kirchenmusik
allerdings wuchsen der
Bühne Kräfte zu, deren
Fähigkeiten nicht zu
niedrig eingeschätzt
werden dürfen. So ließ
sich 1667 Laspar Förster
der Jüngere, der
weitgereiste Danziger
Kapellmeister, in
Weckmanns berühmtem
Collegium musicum
vernehmen, und Mattheson
schreibt darüber in der
"Ehrenpforte", seine
Stimme sei "im Saal wie
ein Stiller, angenehmer
Sub-Baß zu hören
gewesen, außer dem Saal
aber als eine Posaune".
Mit dem Auftreten
Kussers, der die
"Italiänische Sing-Art"
einführte, wird das
Niveau der Aufführungen
merklich angestiegen
sein. Auch die "ältesten
Sänger mußten wieder
Schüler werden" und in
regelmäßigen Proben, vom
Kapellmeister
genauestens instruiert,
ihre Partien gründlich
studieren. Die
wachsenden Ansprüche der
Komponisten an die
Kehlfertigkeit der
Hamburger Sänger lassen
sich aus den noch
erhaltenen Partituren
leicht herauslesen. Daß
mit zunehmendem Können
jedoch auch die
Gagenforderungen der
begehrteren Akteure
sprunghaft in die Höhe
kletterten, ist eine
Tatsache, die den
Theaterdirektoren von
jeher vertraut war und
ist. Blanke tausend
Taler erhielten
schlioßlich die
berühmtesten Mitglieder
des Ensembles.
Während man sich in der
Hansestadt dem
triumphalen Ansturm der
Kastraten auf die
europäischen Opernbühnen
lange Zeit erfolgreich
zu widersetzen wußte,
waren die Falsettisten
eine vertraute
Erscheinung in den
Kirchen und auf der
Szene. Der junge Georg
Kaspar Schürmann erwarb
am Gänsemarkt als
Altfalsettist erste
Opernerfahrung;
besonders gerühmt aber
wird die "zärtliche und
natürliche Stimme" des
englischen Altisten John
Abell, der mehrfach in
Hamburg gastierte.
Mattheson, der bereits
neunjährig im "Aeneas"
auf der Bühne gestanden
hatte, soll nach der
Mutation noch
Sopranpartien "in der
Fistel" gesungen haben.
Bis zum Jahre 1705 (die
ketzten acht Jahre in
tragenden Tenorrollen)
war er eine der
Hauptstützen der
Operntruppe und wurde
als Sänger wie als
Darsteller gleichermaßen
geschätzt. In Händels
"Almira" und "Nero" trat
er zum letzten Mal
singend vor das
Hamburger Publikum. Mit
einer "wohlklingenden,
elastisch-weichen"
Tenorstimme begabt,
begann auch Johann adolf
Hasse seine steile
Karriere als Opernsänger
in Hamburg.
Im Gegensatz zu den
Italienern, die vor
allem die hohen Stimmen
bevorzugten, wurden in
den Hamburger Opern die
Bässe mit dankbaren
Aufgaben bedacht. Häufig
wird der virtuose und
"angenehme Bassist"
Johann Gottfried
Riemschneider erwähnt.
Er stammte aus Halle und
war ein Jugendfreund
Händels, dem er 1729
vorübergehend nach
London folgte. Er galt
allgemein als besonders
sattelfester
Konzertsänger, auf der
Bühne bewährte er sich
im seriösen wie im
komischen Fach und wurde
1739 (nach der auflösung
der Oper) Kantor an
Hamburger Dom. Sechs
Jahre lang wirkte neben
ihm der spätere
Vizekapellmeister in
Weißenfels, Gottfried
Grünewald, als
stimmgewaltiger Bassist.
In seiner wohl für
Hamburg geschriebenen
Oper "Germanicus" sang
er selbst die
Titelrolle.
Die ungeteilte Sympathie
des Hamburger
Theaterpublikums galt
zweifellos den Komikern,
die in mannigfacher, oft
lokal-gefärbter
Abwandlung der
altvertrauten Figur des
"Pickelherings" in der
Gestalt einfältiger
Diener, Boten, Soldaten,
als Bucklige und
Stotterer ihre derben
Späße trieben. Auch die
Kupplerinnen und
komischen Alten wurden
nach venezanischem
Vorbild von Männern
dargestellt. Ein
Monsieur Buchhöfer, des
als Bzffotenor und
grotesker Tänzer der
Hamnurger Truppe ständig
angehörte, erfreute sich
solcher Beliebtheit, daß
eigens seinetwegen eine
Croesus-Parodie erschien
mit dem Titel:
Buchhöfer / Der stumme
Printz Atis /
In
einem / Intermezzo / Auf
dem / Hamburger /
Schau-Platze /
vorgestellet / Im Jahre
1726
(Musik von Reinhard
Keiser)
In den komischen
Intermezzi der späteren
Jahre, vor allem in
denen Telemanns,
brillierten "Mad. Monjo
die Jüngere" und der
bereits erwähnte "Ms.
Riemschneider" sowie
"die berühmten Acteurs
Ms. und Mad. Denner".
Was aber wäre eine Bühne
ohne den Liebreiz, ohne
die Launen und
Slandälchen der
Primadonnen. Freilich -
den Liebreiz ausgenommen
- konnten sich die
Hamburger Damen hier
wohl kaum mit den
Italienerinnen messen,
auch mögen ihnen die
"Trillerchen und
Cadenzen" nicht gar so
geschmeidig aus der
Kehle gehüpft sein wie
etwa einer Faustina
Hasse-Bordoni oder der
hitzigen Francesca
Cuzzoni, die selbst
einem Händel zu schaffen
machte. Immerhin
vermochte zum Beispiel
die jugebdliche Barbara
Oldenburg durch die
"bezaubernde Anmut und
Innigkeit wie
entzükkende Reinheit des
Vortrags" das Herz ihres
späteren Gatten Reinhard
Keiser nachdrücklich zu
rühren, und als die
"schöne Demoiselle
Conradini" - eine
Schülerin Matthesons mit
einer exzeptionell
umfangreichen
sopranstimme - sich 1711
mit dem Grafen Gruzewska
vermählte und nach
Berlin davonging, da war
das "für die Direction
ein herber Schlag", und
nur Madame Keyser gelang
es, ihr Andenken weniger
fühlbar zu machen.
Der Vollständigkeit
halber sollen noch die
Damen Schober und
Rischmüller, der Tenor
Dreyer und Hotter (der
Librettist des
"Störtebecker" 1701)
erwähnt sein, lauter
Namen, deren Nennung
nichts von der
flüchtigen Kunst ihrer
Träger heraufbeschwört -
immerwährendes Schicksal
aller Komödianten!
Mit dem beginnenden 18.
Jahrhundert dürfte auch
im Theater am Gänsemarkt
der brillante
Kunstgesang
italienischer Provenienz
vorgeherrscht haben. Die
Freude an blitzenden
Koloraturen und
Verzierung aller Art,
dieser spielerische Hang
zu improvisierter,
affekthaft gesteigerter
Auszierung der
allbeherrschenden
Gesangsmelodie, das
alles gehört ebenso gut
zur hochbarocken Oper
wie die perspektivische
illusion der tiefen,
dreifach hintereinander
gestaffelten
Kulissenbühne, wie die
raffinierten
Lichteffekte und der
Laterna-magica-Zauber
auf den Prospekten, die
verblüffenden
Verwandlungen und
schwebenden Wunder der
Flugmaschinen -
Illusionswirkungen, wie
sie nur der Phantasie
eines barocken Künstlers
vom Format eines Johann
Oswald Harms entspringen
konnten. Dazu gehörten
aber auch die
großflächigen, heftigen,
pathetischen aktionen
der Darsteller, die
wehenden Schleppen und
Schleier, die engen
Corsagen und
weitfallenden Röcke der
Damen mit den
hochaufgetürmten
Frisuren (Fontange), die
"römischen Justaucorps"
der männlichen Helden
und Götter mit wakkenden
Federbüschen auf Helmen
und Hüten, dazu gehörte
schließlich die ganze
Menagerie der Tiere,
Fabelwesen und Ungeheur,
die groteske Erscheinung
und die Masken der
komischen Personen.
Das Beispiel immer
häufiger auftauchender
italienischer
Gesangsvirtuosen blieb
gewiß nicht ohne einfluß
auf den Stil der
einheimischen Sänger. So
wird von dem
nachhaltigen Erfolg des
Antonio Campioli in der
neuen Oper "Die
Hamburger Schlachtzeit"
berichtet. Campioli war
einer der bedeutendsten
Altkastraten seiner Zeit
und ein ebenso
hervorragender, später
unter Lotti in Dresden
wirkender Lehrer. auch
der deutschstämmige
Kastrat Cajetan
Berenstadt wird auf
seiner Reise nach
London, wo er unter
Händels Leitung im
"Flavio", "Ottone" und
"Julius Cäser" (1724)
sang, in Hamburg Station
gemacht haben.
In den zahlreichen
volkstümlichen Szenen
der Hamburger Oper mit
ihrem stark liedhaften
Einschlag aber wurde ein
Ton angeschlagen, den
die Italiener, die der
Opernbühne "mitreißen,
begeistern, erschütten"
wollten, nicht kannten.
Eher läßt sich in den
lieblichen Airs der
Franzosen eine Parallele
suchen. Vielleicht lag
hier eine der Wurzeln
elnes wieder
aufblühenden,
eigenständigen deutschen
Gesangsstils, und es
sollte nicht lange mehr
währen, daß der Satz
"Ella canta come una
tedesca" seine
Bitterkeit völlig
verlor.
Gerd
Berg
(Columbia C 91 102)
|
|