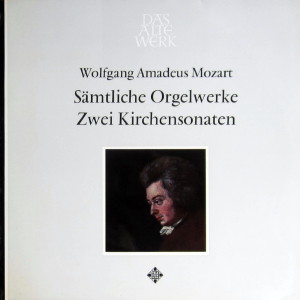 |
1 LP -
SAWT 9555-B - (p) 1969
|
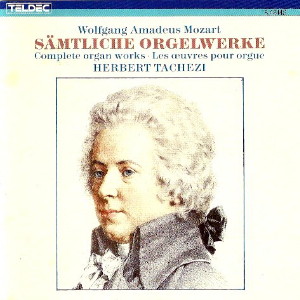 |
| 1 CD -
8.43442 ZK - (c) 1986 |
|
| Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791) |
|
|
|
|
|
|
|
| Sämtliche Orgelwerke - Zwei
Kirchensonaten |
|
|
|
|
|
|
|
Adagio und Allegro (Adagio)
f-moll für eine Orgelwalze, KV 594
|
|
|
|
- Adagio - Allegro - Adagio
|
|
12' 42" |
A1 |
| Kirchesonate F-dur für 2
Violinen, Baß (Violoncello) und Orgel,
KV 244 |
|
|
|
| - Allegro |
|
5' 50" |
A2 |
Veroneser Allegro, KV 72a
|
|
|
|
- Molto Allegro
|
|
1' 18" |
A3 |
| Leipziger Gigue in G, KV 574 |
|
|
|
| - Allegro |
|
2' 10" |
A4 |
| Phantasie f-moll, KV 608 |
|
|
|
- Allegro - Andante -
(Allegro)
|
|
12' 15"
|
B1 |
Kirchesonate C-dur für 2
Violinen, Baß (Violoncello) und Orgel,
KV 328 (317c)
|
|
|
|
| - Allegro |
|
5' 00" |
B2 |
| Andante für eine Walze in
eine kleine Orgel F-dur, KV 616 |
|
|
|
| - Andante Ursprünglich:
Larghetto |
|
7' 10"
|
B3 |
|
|
|
|
Herbert
Tachezi, Orgel (erbaut um
1800) der Basilika Maria Treuin
Wien, Piaristenkirche
|
|
| Alice
Harnoncourt, Walter Pfeiffer,
Barockvioline (Jacobus Stainer,
Absam 1665) |
|
| Walter
Pfeiffer, Barockvioline
(Matthias Albanus, Bozen 1712) |
|
| Nikolaus
Harnoncourt, Barockcello
(Andreas Castagneri, Paris 1744) |
|
|
Luogo
e data di registrazione
|
| Basilika
Maria Treu, Vienna (Austria) - 1-4
marzo 1969 |
|
Registrazione
live / studio
|
| studio |
Producer
/ Engineer
|
Wolf
Erichson
|
Prima Edizione CD
|
Teldec
- 8.43442 ZK - (1 cd) - 47' 09" - (c)
1986 - ADD
|
Prima
Edizione LP
|
Telefunken "Das
Alte Werk" - SAWT 9555-B
- (1 lp) - 47'
09"
- (p) 1969
|
|
|
|
Die abwechslungsreiche
Zusammenstellung diser Schallplatte
mit Mozart-Orgelwerken bringt drei
Kompositionen für eine Orgelwalze,
zwei Kirchesonaten und zwei kleine
einsätzige Meisterwerke zu Gehör.
Am Ende seines Lebens erhielt Mozart
den Auftrag, etwas für die Orgelwalze
im Müllerschen Kunstkabinett des
Grafen Deym in Wien zu screiben.
1790/91 gab er sich an diese Arbeit,
die ihm wenig Freude, aber Geld
einzubringen versprach. Er schrieb an
seine Frau: "Ich habe mir so fest
vorgenommen, gleich das Adagio für den
Uhrmacher zu schreiben, dann meinem
lieben Weibchen etwelche Ducaten in
die Hände zu spielen; that es auch -
war aber, weil es eine verhasste
Arbeit ist, so unglücklich, es nicht
zu Ende bringen zu können - ich
schreibe alle Tage daran - muss aber
immer aussetzen, weil es mich ennuirt
- und gewiss, wenn es nicht einer so
wichtigen Ursache wegen geschähe,
würde ich es sicher hanz bleiben
lassen - so hoffe ich aber doch es so
nach und nach zu erywingen..." Kaum
hatte er angefangen, so geriet ihm die
Komposition nicht nach Willkür,
sondern es kam so, "dass der
dämonische Geist seines Genies ihn in
der Gewalt hatte, so dass er ausführen
musste, was jener gebot", wie Goethe
einmal von ihm sagte. Auf diese Weise
ging die Musik weit über eine in
Auftrag gegebene Gelegenheit hinaus.
Nur das andante KV 616 wurde in
verküryter Fassung auf die Walze einer
Flötenuhr gestochen. Die beiden
anderen Werke in f-moll schrieb Mozart
in einem vierstimmigen, von einem
bestimmten instrumentalen Klang
abstrahierten Satz.
KV 594 beginnt mit einem Adagio im
strengen Satz, und das folgende kutze
Allegro ist ganz vom Gesetz der
Sonatenform gebändigt. Dazu kommt noch
die Ordnung der Dreiheit durch die
Wiederholung des Adagio, das sich
inhaltlich noch ausdrucksvoller
erweitert und beruhigend abschließt.
In KV 608 geben die Bach' sche
Polyphonie und der Toccatenstil mit
Abwechslung von akkordischerm,
subjektivem Ausdruck und streng
polyphoner Fuge als Gegensatz dem Werk
das Gespräge, wobei im Allegro die
Dämonie des Don Juan sich nachwirkend
mit überirdischer Gewalt geltend
macht. Das Andante bringt auf erhöhter
geistiger Ebene eine wehmütige
Beruhigung, die in den anschließenden
Variationen noch intensiviert wird.
Eine Kadenz mit leidenschaftlicher
Trillerbewegung leitet über in die
Wiederholung des durch ein neues
Gegenthems noch stärker dämonistierten
Allegros, das bis zuletzt durch die
tiefsinnige Leidenschaftlichkeit des
späten Mozart erregt. Es ist
bemerkenswert, daß beide Werke sich
als Abschriften in Beethovens Nachlaß
befanden und ihm in ihrer Eigenart
bedeutsam erschienen sein müssen. Das
Autograph ist nur von KV 616 erhalten,
während die beiden anderen
Handschriften verloren und nur in
Abschriften und in sp#teren Ausgaben
für Klavier zu zwei und vier Händen
existieren. Die Kirchesonaten KV 244
und 328 von 1776 und 1799 sind in
Mozarts Salzburger Zeit entstanden.
Dort wurde damals beim Hochamt
zwischen Gloria und Credo ein kurzes
Instrumentalstück eingerfügt. Mozart
schrieb für diesen Zweck 17 einsätzige
Kirchensonaten, denen weniger ein
kirchlicher Geist als eine allgemeine
Fröhlichkeit und die rhzthmische wie
klangliche Lebendigkeit weltlicher
Instrumentalmusik innewohnt. Die
beiden Sonaten in F-dur und C-dur sind
im klassichen Sonatensatz mit zwei
Themen, Durchführung und Reprise für 2
Violinen, Baß und Orgel geschrieben,
wobei dem Orgelpart eine selbständige
Stimmführung zugeteilt ist. Mozart ist
an der Orgel gewiß darauf bedracht
gewesen, sich einen Hauptanteil an der
Musik zu sichern. Im Durchführungsteil
wird musikalisch die Spannung durch
eine gewisse Problematik der
Empfindung erhöht und dann in der
Reprise wieder ins Gleichgewicht
gebracht.
Das Veroneser Allegro enstand 1769 auf
der italienischen Reise in Verona, wo
der 13jähige mit gr0ßer Bergeisterung
aufgenommen wurde. Als er in S.
Tommaso die Orgel spielte, zu der er
nur gelangen konnte, indem die Patres
ihn in ihre Mitte nahmen und so einen
Weg durch die andrängenden Zuschauer
bahnten, berichtete die Zeitung: "Da
es vorbei war, war der Lärm noch
frößer, denn jeder wollte den kleinen
Organisten sehen." Damals wirde ein
großes Bild Wolfgangs am Klavier in Öl
gemalt. Der Maler Cignaroli hat die
auf dem Notenpult aufgeschlagenen
Noten so genau wiedergegeben, daß man
darauf das "Veronerser Allegro"
ablesen und annehmen kann, daß Mozart
es damals auf der Orgel gespielt haben
wird.
Die Leipziger Gigue ist eine
musikalische Huldigung an den Genius
loci - Johann Sebastian nach -, von
dessen Musik Mozart in Leipzig 1789
einen entscheidenden tiefen Eindruck
gewann, als er beim Besuch des
damaligen Thomaskantors Johann
Friedrich Doles auf dem Speicher der
Thomasschule Bach'sche Motetten
entdeckte. In einer freudigen und
gehobenen Stimmung schrieb er seinem
Gastfreund, dem Horforganisten Engel,
mit dem Worten: "Zum Zeichen wahrer
ächter Freundschaft und Liebe" die
Noten dieser Gigue ins Stammbuch. Ohne
eine Bach'sche Stilkopie zu liefern,
ist es ein Meisterstück an
kontrapunktischer Freiheit des Spiels
mit dem Thema, der rhzthmischen und
harmonischen Überraschungen und
originellen Einfälle des Mozart'schen
Geistes.
Otto von Irmer
|
|
Nikolaus
Harnoncourt (1929-2016)
|

|

|
|