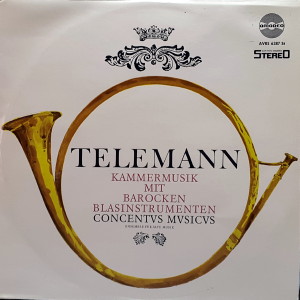 |
|
1 LP -
AVRS 6387 - (rec) 1965*
|
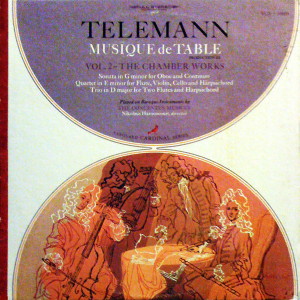 |
1 LP -
1965 VCS 10009 - (c) 1967
|
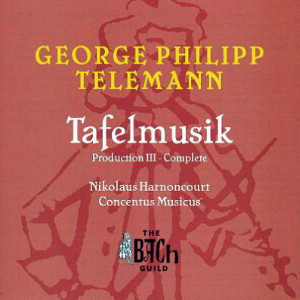 |
| 2 CD -
ATM-CD-1275 - (p) 2003 |
|
Georg Philipp
Telemann (1681-1767)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kammermusik
mit Barocken Blasinstrumenten - Musique
de Table (Production III), Vol. 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Sonata
für Oboe und Basso continuo, g-moll |
|
14' 17" |
|
- Largo
|
3' 26" |
|
A1 |
| - Presto |
5' 40" |
|
A2 |
| - Andante |
1' 31" |
|
A3 |
| - Allegro |
3' 28" |
|
A4 |
|
|
|
|
| Quatuor
für Flûte traversière, Violine,
Violoncello und Cembalo, e-moll |
|
17' 47" |
|
| - Adagio |
6' 32" |
|
A5 |
| - Allegro |
2' 17" |
|
A6 |
| - Dolce |
6' 36" |
|
B1 |
- Allegro
|
2' 11" |
|
B2 |
|
|
|
|
Trio für
zwei Flûtes traversière und Basso
continuo, D-dur
|
|
12' 06" |
|
| - Andante |
3' 32" |
|
B3 |
| - Allegro |
2' 30" |
|
B4 |
- Grave / Largo
|
3' 20" |
|
B5 |
| - Vivace |
2' 40" |
|
B6 |
|
|
|
|
| CONCENTVS
MVSICVS, Ensemble für alte Musik |
INSTRUMENTARIUM: |
|
| -
Alice Harnoncourt, Violin |
Violine: Jakobus
Stainer, Absam, 1658 |
|
| -
Jürg Schaeftlein, Barockoboe |
Barockoboe:
P. Paulhahn, deutsch um 1720 |
|
-
Leopold Stastny, Flûte
traversière
|
Flûte
traversière: A. Grenser, Dresden um
1750 |
|
-
Gottfried Hechtl, Flûte
traverisère
|
Flûte
traversière: Pourto, Paris um 1780 |
|
-
Nikolaus Harnoncourt, Violoncello
und Viola da gamba
|
Violoncello: Andrea
Castagneri, Paris, 1744 |
|
| -
Herbert Tachezi, Cembalo |
Viola da gamba: Jacob
Precheisn, Wien 1670 |
|
|
Cembalo: Kopie eines
italienischen Kielflügels um 1700 von M.
Skowroneck, Bremen |
|
|
Luogo e data
di registrazione
|
| Vienna (Austria) - 1965* |
|
Registrazione
live / studio
|
| studio |
Producer / Engineer
|
-
|
Prima Edizione
CD
|
Artemis Classics "The Bach
Guild" - ATM-CD-1275 - (2 cd) - 51' 16"
+ 44' 12" - (c) 2003
|
Prima
Edizione LP
|
-
Amadeo - AVRS 6387 - (1 lp) - 44'
12" - (rec) 1965*
- Vanguard
"Cardinal Series" - VCS 10009 - (1 lp) -
44' 12" - (c) 1967
|
| Nota |
| * I
riferimenti al luogo di
registrazione ed alla data di
pubblicazione non sono riportati
nelle note a corredo del disco ma
sono desunti nei seguenti testi:
""Die Seltsamsten Wiener der Welt"
(Mertl, Turković, Residenz
Verlag,2003 ) e "Wir sind eine
Entdeckergemeinschaft" (A. &
N. Harnoncourt, Residenz Verlag,
2017). |
|
|
Notes
|
|
Telemamn war wohl
unbestritten der berühmteste deutsche
Komponist seiner Zeit. Er hatte, als er
sich 1721 endgültig als Director Musices
in Hamburg niederließ, bereits eine
bewegte musikalische Vergangenheit.
Schon als Kind spieite er Blockflöte,
Violine und Cembolo. Mit 20 Jahren
gründete er in Leipzig 1701 ein
Collegium Musicum von Studenten und
komponierte für die Thomoskirche. 1704
wurde er Kopellmeister des Grafen von
Promnitz in Sorau. 1708 Konzertmeister
und bald darauf Kapellmeister und
herzoglicher Sekretär in
Sachsen-Eisenach, 1712 Kapellmeister der
Barfüßerkirche in Frankfurt. Überall
hatte er sich Freunde gemacht, sein
Genie und seine schier unerschöpfliche
Schaffenskraft verbreiteten seinen Ruhm.
Darüber hinaus war er ein sehr
geschickter Geschäftsmann, der sein
Licht nicht unter den Scheffel stellte.
So ist der große Erfolg und die weite
Verbreitung seiner Werke verständlich.
Die Komponisten jener Zeit konnten mit
einem auf umfassender musikalischer
Bildung basierenden Verständnis ihres
Publikums rechnen. Es gehörte zur
Allgemeinbildung, mindestens ein
Musikinstrument ordentlich spielen zu
können und die Grundsätze der
Musiktheorie zu beherrschen. Musik
begleitete das ganze Leben, von den
hohen kirchlichen und höfischen Festen
bis zur Tauf-, Geburtstags- oder
Totenfeier im Bürgerhause. Sie war ein
ebenso wesentlicher Bestandteil des
Lebens kultivierter Menschen wie etwa
die Wohnkultur oder die modische
Kleidung; und wie man sich (ouch heute
tut man das noch) für jeden besonderen
Anloß neue Kleider nach letzter Mode
anfertigen lassen mußte, so mußte auch
immer wieder neue Musik, auch nach
letzter Mode, für diese Anlässe besorgl
werden. Bekannte Werke vor demselben
Publikum mehrmals aufzuführen, wäre
ebenso unmöglich, wie immer wieder
dieselbe Staafsrobe in Gesellschaft zu
tragen. - Jeder gebildele Zuhörer war
mit der musikalischen Sprache der Zeit
auf das engste vertraut. So wurde
natürlich auch jeder musikalische Spaß,
jede harmonische Kühnheit, jede im
damaligen musikalischen Vokabular
ungewohnte Wendung sofort bemerkt und
beifällig oder ablehnend aufgenommen.
Für dieses Publikum war Telemanns
reiches Schaffen an Kammermusik jeder
nur denkbaren instrumentalen Kombination
gedacht. Hier fand seine raffinierte und
die klangliche Eigenart jedes
Instrumentes genial nutzende
Schreibweise dankbare und begeisterte
Zustimmung.
Im Solo für Oboe und Generalbaß zeigt
sich der eminente Klangsinn Telemanns.
Der größte Teil der Sonatenliteratur
jener Zeit ist auf jedem
Melodieinstrument ausführbar, - in
dieser Sonate ist das Idiom der Oboe,
des wandlungsfähigsten
Holzblasinstrumentes, in unfehlbarer
Weise getroffen und in jeder Richtung
ausgeschöpft: sehnsüchtighirtenhaft und
von reinstem Ausdruck beseelt in den
langsament Sätzen, trompetig und doch
kantabel in den schnellen Sätzen.
In der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts begann die sensible
Querflöte ihren Siegeszug als
Soloinstrument. Der stilistische Wandel
von der Barockmusik zur Vorklassik geht
Hand in Hand mit Verschiebungen im
Instrumentarium; die Blockflöte, das
solistische Blasinstrument der
Barockzeit schlechthin, wird langsam von
der Querflöte, dem Instrument der
"Empfindsamkeit" verdrängt. Das
hauchzarte und schwärmerische Trio für
zwei Querflöten trifft wunderbar die
,"romantische" Grundstimmung dieses
Instrumentes. Dazu kommt, daß die bei
dieser Aufnahme verwendeten
Originalinstrumente, mit ihrem ständigen
Klangfarbenwechsel zwischen "gedeckten”
und ,"offenen" Tönen, Telemanns
chromatische Klangspiele erst richtig
verständlich machen.
Im Quartett bedient sich Telemann
weitgehend des italienischen Stils.
Ungewöhnlich ist die vollwertige
Partnerschaft, die er dem
Generalbaß-Cembalo als viertem
Instrument einräumt, obwohl es sich an
mehreren Stellen mit dem Cello zur
Continuogruppe vereinigt. - Die beiden
langsamen Sätze wurden in Anlehnung an
Telemanns "Methodische Sonaten" von 1728
mit quasi improvisierenden Verzierungen
wiederholt.
Nikolaus
Harnoncourt
|
|
Nikolaus
Harnoncourt (1929-2016)
|

|

|
|