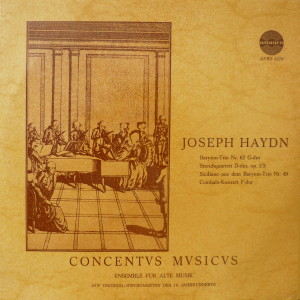 |
1 LP -
AVRS 6178 - (rec) 1960*
|
|
| Haydn auf
"Originalinstrumenten" |
|
|
|
|
|
|
|
| Joseph Haydn (1732-1809) |
|
|
|
| Divertimento a tre per il
Baryton, Viola e Basso, G-dur |
|
|
|
| - Allegro / Menuet / Finale,
Presto |
|
9' 20" |
A1 |
Quartett für zwei Violinen,
Viola und Violoncello, D-dur, op.1/3
|
|
|
|
| - Adagio / Menuetto / Presto
/ Menuetto / Presto |
|
13' 25" |
A2 |
Siciliano aus dem
Baryton-Trio Nr. 49 A-dur
|
|
2' 16" |
B1 |
| Concerto per il
Cembalo concertato accompagnato da due
Violini, Violetta e Basso, F-dur |
|
19' 10" |
B2 |
| - Allegro |
10' 05" |
|
|
| - Largo cantabile |
4' 45" |
|
|
| - Finale, Presto |
4' 20" |
|
|
|
|
|
|
| CONCENTVS
MVSICVS, Ensemble für alte Musik |
INTRUMENTARIUM: |
|
| -
Alice Harnoncourt |
Violine: Jakobus
Stainer, Absam, 1677 |
|
| -
Kurt Theiner |
Violine: Klotz,
Mittenwald, Anfang des 18.
Jahrhunderts |
|
| -
Josef de Sordi |
Tenorbratsche:
Marcellus Hollmayr, Wien, 17.
Jahrhundert |
|
| -
Nikolaus Harnoncourt |
Violoncello:
Antony Posch, Wien, 1721 |
|
| -
Ernst Knava |
Violone: Antony
Stefan Posch, Wien, 1729 |
|
| -
Eduard Hruza |
Baryton (Kopie
eines Instruments von Seelos aus
dem Linzer Landesmuseum) von J.
Krenn, Wien |
|
| -
Peter Ronnefeld |
Cembalo (Kopie
eines italienischen Kielflügels um
1700) von M. Skowroneck, Bremen |
|
|
Bögen aus dem 18.
Jahrhundert |
|
|
|
|
| Um dem zarteren
Klang der Originalinstrumente auch
un der Wiedergabe so nahe als möglich
zu kommen, möge
man den Lautsprecher etwas weniger
laut einstellen, als man es
normalerweise tut. |
|
|
Luogo e data
di registrazione
|
| Casino Baumgarten, Vienna
(Austria) - 1960* |
|
Registrazione
live / studio
|
| studio |
Producer / Engineer
|
-
|
Prima Edizione
CD
|
-
|
Prima
Edizione LP
|
Amadeo - AVRS 6178 - (1 lp) -
44' 11" - (rec) 1960*
|
| Nota |
| * I
riferimenti al luogo di
registrazione ed alla data di
pubblicazione non sono riportati
nelle note a corredo del disco ma
sono desunti nei seguenti testi:
""Die Seltsamsten Wiener der Welt"
(Mertl, Turković, Residenz
Verlag,2003 ) e "Wir sind eine
Entdeckergemeinschaft" (A. &
N. Harnoncourt, Residenz Verlag,
2017). |
|
|
Notes
|
Wie hat die Musik Haydns
zu seiner Zeit geklungen, welchen Klang
hatte er im Ohr, als seine Quartette,
seine Symphonien und Divertimenti
schrieb? - Ist dieser Klang vom heutigen
Instrumentalklang so verschieden daß es
gerechtfertigt ist, seine Werke auf
"Originalinstrumenten" der Zeit
aufzuführen?
Das Instrumentarium, das Haydn zu Beginn
seiner Komposotionstätigkeit worfand,
war in der Hauptsache dasselbe, das
schon im frühen 18. Jahrhunder benßtyt
wurde; dieselben Streichinstrumente,
dieselben Blasinstrumente. - Der große
Geschmackswandelm der sich im Laufe der
Jahrhunderte vollzog und der zu
bedeutenden Veränderungen aller
musikalischen Formen führte, hatte bis
dahin noch nicht sehr viel am
Klangkörper geändert. Um die
Jahrhundertwende aber änderte sich diese
Situation: den Forderungen der
"modernen" Komponisten folgend, wurde
das gesamte Instrumentarium von einer
Welle tiefgreifender Änderungen erfaßt,
die in relativ kurzer Zeit zum modernen
Orchesterklang führten. (Eine Reihe von
technischen Erfindungen an den
Instrumenten fällt in diese Epoche) -
Man hat auch damals diese Änderungen als
sehr einschneidend empfunden, z. B.
haben sich konyervative Musiker noch
lange gegen die ihnen zu gleichmäßig
klingenden vielklappigen Flöten und
Oboen gesträubt. Alle instrumente wurden
klangstärker konstruiert Dies führte
schließlich auch zu einen radikalen
Umbau der bis dahin seit Jahrhunderten
fast unveränderten Streichinstrumente.
Die meisten großen Geiger unserer Zeit
spielen auf "alten", meist italienischen
Instrumenten, die alle zu Beginn des 19.
Jahrhunderts oder später umgebaut worden
waren. Was wurde nun an diesen
verändert, um sie in "moderne", d. h.
lautere Instrumente umzuwandeln? - Man
verstärkte die Besaitung und stellte den
Geigenhals schräg nach hinten, was den
Druck auf die Decke des Instruments
wesentlich erhöhte. Diesem Druck konnte
der alte Baßbalken nicht standhalten, er
mußte einem neuen weichen, der etwa das
fünffache Volumen hat. Der diesem
umgebauten Instrument entsprechende
moderne Bogen wurde um dieselbe Zeit von
Tourte entwickelt. Diese wirklich
einschneidenden Veränderungen am Bau der
damals schon etwa 300 Jahre alten Geige
veränderten ihren Klang ganz erheblich.
Die dünnere Besaitung und der viel
leichtere Bogen der nicht modernisierten
Geige verlangten eine ganz andere
Spielweise, andere Tempi und eine andere
Phrasierung, als man es heute gewohnt
ist. Die Violinschulen von Leopold
Mozart, Geminiani und viele andere Werke
geben über all das genaue Auskunft.
Haydns Schaffen fällt zum Großteil in
die Zeit vor den großen Veränderungen an
den Musikinstrumenten. Seine
Streichquartett erklangen noch auf den
nicht umgebauten Instrumenten. Er
schrieb ungezählte Werke für das
"Baryton", ein gambenähnliches
Instrument, das noch den
Barockinstrumenten zugehört. Seine
frühen Klavierkonzerte sind noch ganz
eindeutig für das Cembalo, und nicht für
das damals langsam aufkommende
Hammerklavier bestimmt.
----------
In vielen
Kompositionen Haydns wird das Baryton,
das Lieblingsinstrument seines Fürsten
Nikolaus Esterhazy, als Soloinstrument
verlangt. Diese Werke sind in ihrer
Originalgestalt praktisch für das
Musikleben verloren, da es nur noch sehr
wenige alte Barytons gibt und nur ganz
wenige Musiker dieses diffizile
Instrument überhaupt spielen können. -
Das Baryton, das zur damaligen Zeit sehr
beliebt war, wird in der Violinschule
Leopold Mozarts so beschrieben:
"...Dieses Instrument hat, gleich der
Gamba, 6 bis 7 Seyten. Der Hals ist sehr
breit und dessen hinterer Teil hohl und
offen, wo 9 oder auch 10 messingene und
stählerne Seyten hinunter gehen, die mit
dem Daumen berühret, und geknippet
werden; also zwar, daß zu gleicher Zeit,
als man mit dem Geigenbogen auf den oben
gespannten Darmseyten die Hauptstimme
abgeiget, der Daume durch das Anschlagen
der unter dem Hals hinabgezogenen Seyten
den Baß dazu spiele. Und eben deswegen
müssen die Stücke besonders dazu
gesetzet seyn. Es ist übrigens eines der
anmuthigsten Instrumente..." Da die in
D-dur gestimmten Zupfsaiten, auch wenn
sie gerade nicht gespielt werden,
ständig mitschwingen, erklingt die Musik
wie durch einen ätherischen
Klangschleier. Auf dem wegen der
Zupfsaiten ausgehöhlten Griffbrett ist
durch die verstärkte Resonanz jede
Fingerbewegung als Klopfen stark hörbar.
Das hier gespielte Streichquartett, es
wird in den frühen Quellen noch als
Divertimento oder als Cassatio
bezeichnet, ist eines der ersten Werke
seiner Gattung. Es ist noch ganz der
ausgehenden Baroclzeit verpflichtet.
Besonders im ersten Satz wird man stark
an die Triosonaten der ersten
Jahrhunderthälfte erinnert. Im zweiten
Menuett läßt Haydn die Instrumente
paarweise in Oktaven gehen, was man
damals als besonderen Effekt empfand.
Ernst L. Gerber schreibt um 1790:
"...Haydn war es nämlich, der die
Manier, die erste und zweite Violinen in
Oktaven einhergehen zu lassen, ...in
diesen seinen Quatros zuerst einführte."
Das Cembalokonzert wirde nicht auf einem
der üblichen modernen Instrumente
gespielt, sondern auf einem vor allem
klanglich den Originalinstrumenten
entsprechenden Cembalo. Die Saiten
werden dabei nicht wie bei diesen mit
Lederstückchen, sondern mit Federkielen
angezupft, was einen viel schärferen und
glänzenderen Klang ergibt, wie ihn die
alten Instrumente besitzen.
Alle auf dieser Platte gespielten Werke
Haydns zeigen deutlich die Stellung
Haydns zwischen zwei grundsätzlich
verschiedenen musikalischen
Stil-epochen. Gerade in diesen
Kompositionen seiner jungen Jahre sieht
man seine starken Bindungen an die
Vergangenheit, man erkennt aber vor
allern auch das schöpferische Genie, das
immer neue, noch nie begangene Wege in
die Zukunft sucht.
|
|
Nikolaus
Harnoncourt (1929-2016)
|

|

|
|